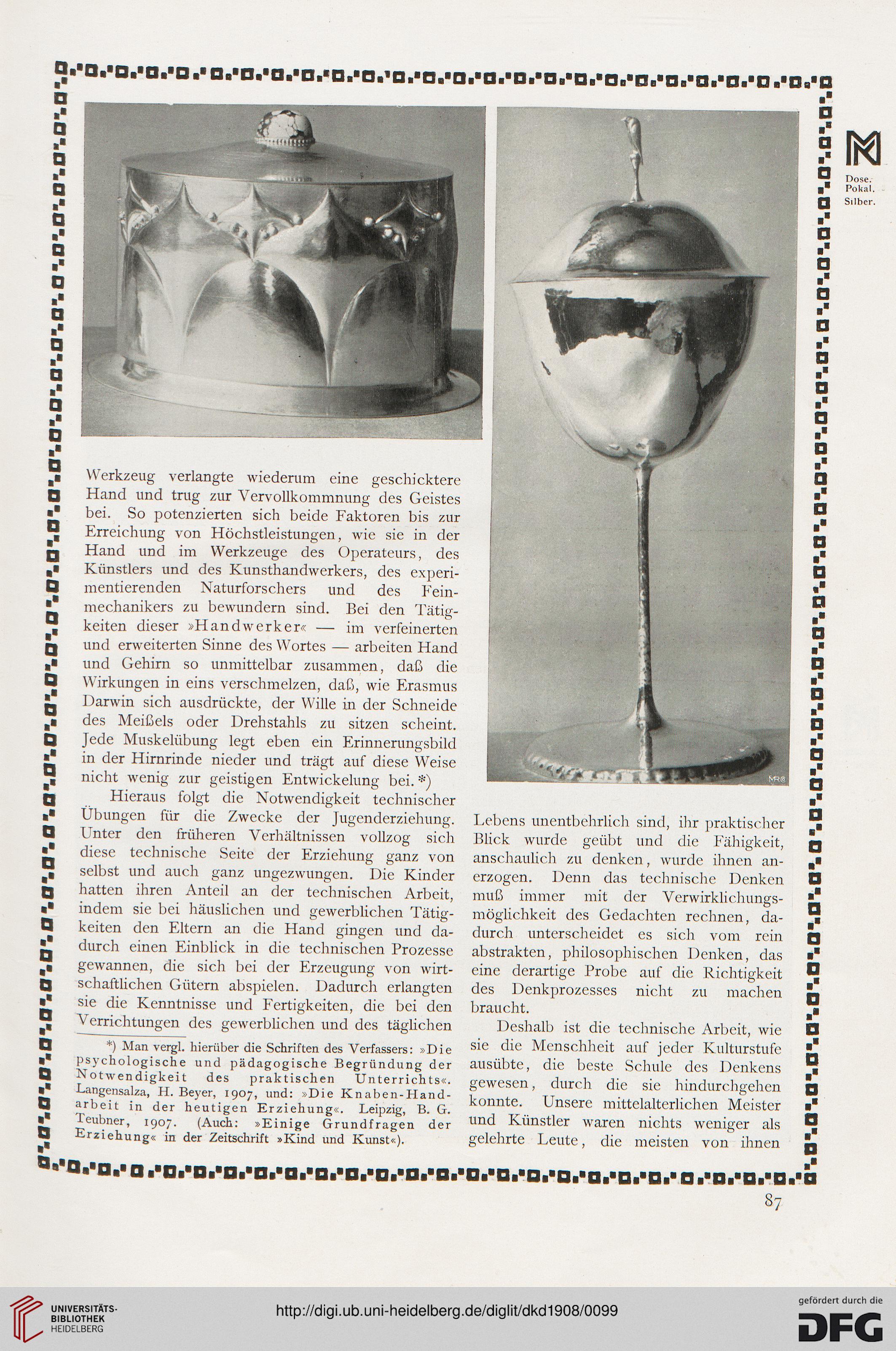«■
O
n
■■
a
«■
D
■•
O
o
D
i«
D
«■
Q
»-
a
«■
0
a
D
Werkzeug verlangte wiederum eine geschicktere
Hand und trug zur Vervollkommnung des Geistes
bei. So potenzierten sich beide Faktoren bis zur
Erreichung von Höchstleistungen, wie sie in der
Hand und im Werkzeuge des Operateurs, des
Künstlers und des Kunsthandwerkers, des experi-
mentierenden Naturforschers und des Fein-
mechanikers zu bewundern sind. Bei den Tätig-
keiten dieser »Handwerker« — im verfeinerten
und erweiterten Sinne des Wortes — arbeiten Hand
und Gehirn so unmittelbar zusammen, daß die
Wirkungen in eins verschmelzen, daß, wie Erasmus
Darwin sich ausdrückte, der Wille in der Schneide
des Meißels oder Drehstahls zu sitzen scheint.
Jede Muskelübung legt eben ein Erinnerungsbild
in der Hirnrinde nieder und trägt auf diese Weise
nicht wenig zur geistigen Entwickelung bei. *)
Hieraus folgt die Notwendigkeit technischer
Übungen für die Zwecke der Jugenderziehung.
Unter den früheren Verhältnissen vollzog sich
diese technische Seite der Erziehung ganz von
selbst und auch ganz ungezwungen. Die Kinder
hatten ihren Anteil an der technischen Arbeit,
indem sie bei häuslichen und gewerblichen Tätig-
keiten den Eltern an die Hand gingen und da-
durch einen Einblick in die technischen Prozesse
gewannen, die sich bei der Erzeugung von wirt-
schaftlichen Gütern abspielen. Dadurch erlangten
sie die Kenntnisse und Fertigkeiten, die bei den
Verrichtungen des gewerblichen und des täglichen
*) Man vergl. hierüber die Schriften des Verfassers: »Die
psychologische und pädagogische Begründung der
Notwendigkeit des praktischen Unterrichts«.
Langensalza, H. Beyer, 1907, und: »Die Knaben-Hand-
arbeit in der heutigen Erziehung«. Leipzig, B. G.
Teubner, 1907. (Auch: »Einige Grundfragen der
Erziehung« in der Zeitschrift »Kind und Kunst«).
Lebens unentbehrlich sind, ihr praktischer
Blick wurde geübt und die Fähigkeit,
anschaulich zu denken, wurde ihnen an-
erzogen. Denn das technische Denken
muß immer mit der Verwirklichungs-
möglichkeit des Gedachten rechnen, da-
durch unterscheidet es sich vom rein
abstrakten, philosophischen Denken, das
eine derartige Probe auf die Richtigkeit
des Denkprozesses nicht zu machen
braucht.
Deshalb ist die technische Arbeit, wie
sie die Menschheit auf jeder Kulturstufe
ausübte, die beste Schule des Denkens
gewesen, durch die sie hindurchgehen
konnte. Unsere mittelalterlichen Meister
und Künstler waren nichts weniger als
gelehrte Leute, die meisten von ihnen
q Dose.
f* Pokal.
Q Silber.
■ ■
a
■«
a
□
a
■
a
a
a
■■
D
D
a
■■
D
.«
D
a
□
■
a
a
n
.«
a
_■
D
a
D
.«
D
_■
■
a
87
O
n
■■
a
«■
D
■•
O
o
D
i«
D
«■
Q
»-
a
«■
0
a
D
Werkzeug verlangte wiederum eine geschicktere
Hand und trug zur Vervollkommnung des Geistes
bei. So potenzierten sich beide Faktoren bis zur
Erreichung von Höchstleistungen, wie sie in der
Hand und im Werkzeuge des Operateurs, des
Künstlers und des Kunsthandwerkers, des experi-
mentierenden Naturforschers und des Fein-
mechanikers zu bewundern sind. Bei den Tätig-
keiten dieser »Handwerker« — im verfeinerten
und erweiterten Sinne des Wortes — arbeiten Hand
und Gehirn so unmittelbar zusammen, daß die
Wirkungen in eins verschmelzen, daß, wie Erasmus
Darwin sich ausdrückte, der Wille in der Schneide
des Meißels oder Drehstahls zu sitzen scheint.
Jede Muskelübung legt eben ein Erinnerungsbild
in der Hirnrinde nieder und trägt auf diese Weise
nicht wenig zur geistigen Entwickelung bei. *)
Hieraus folgt die Notwendigkeit technischer
Übungen für die Zwecke der Jugenderziehung.
Unter den früheren Verhältnissen vollzog sich
diese technische Seite der Erziehung ganz von
selbst und auch ganz ungezwungen. Die Kinder
hatten ihren Anteil an der technischen Arbeit,
indem sie bei häuslichen und gewerblichen Tätig-
keiten den Eltern an die Hand gingen und da-
durch einen Einblick in die technischen Prozesse
gewannen, die sich bei der Erzeugung von wirt-
schaftlichen Gütern abspielen. Dadurch erlangten
sie die Kenntnisse und Fertigkeiten, die bei den
Verrichtungen des gewerblichen und des täglichen
*) Man vergl. hierüber die Schriften des Verfassers: »Die
psychologische und pädagogische Begründung der
Notwendigkeit des praktischen Unterrichts«.
Langensalza, H. Beyer, 1907, und: »Die Knaben-Hand-
arbeit in der heutigen Erziehung«. Leipzig, B. G.
Teubner, 1907. (Auch: »Einige Grundfragen der
Erziehung« in der Zeitschrift »Kind und Kunst«).
Lebens unentbehrlich sind, ihr praktischer
Blick wurde geübt und die Fähigkeit,
anschaulich zu denken, wurde ihnen an-
erzogen. Denn das technische Denken
muß immer mit der Verwirklichungs-
möglichkeit des Gedachten rechnen, da-
durch unterscheidet es sich vom rein
abstrakten, philosophischen Denken, das
eine derartige Probe auf die Richtigkeit
des Denkprozesses nicht zu machen
braucht.
Deshalb ist die technische Arbeit, wie
sie die Menschheit auf jeder Kulturstufe
ausübte, die beste Schule des Denkens
gewesen, durch die sie hindurchgehen
konnte. Unsere mittelalterlichen Meister
und Künstler waren nichts weniger als
gelehrte Leute, die meisten von ihnen
q Dose.
f* Pokal.
Q Silber.
■ ■
a
■«
a
□
a
■
a
a
a
■■
D
D
a
■■
D
.«
D
a
□
■
a
a
n
.«
a
_■
D
a
D
.«
D
_■
■
a
87