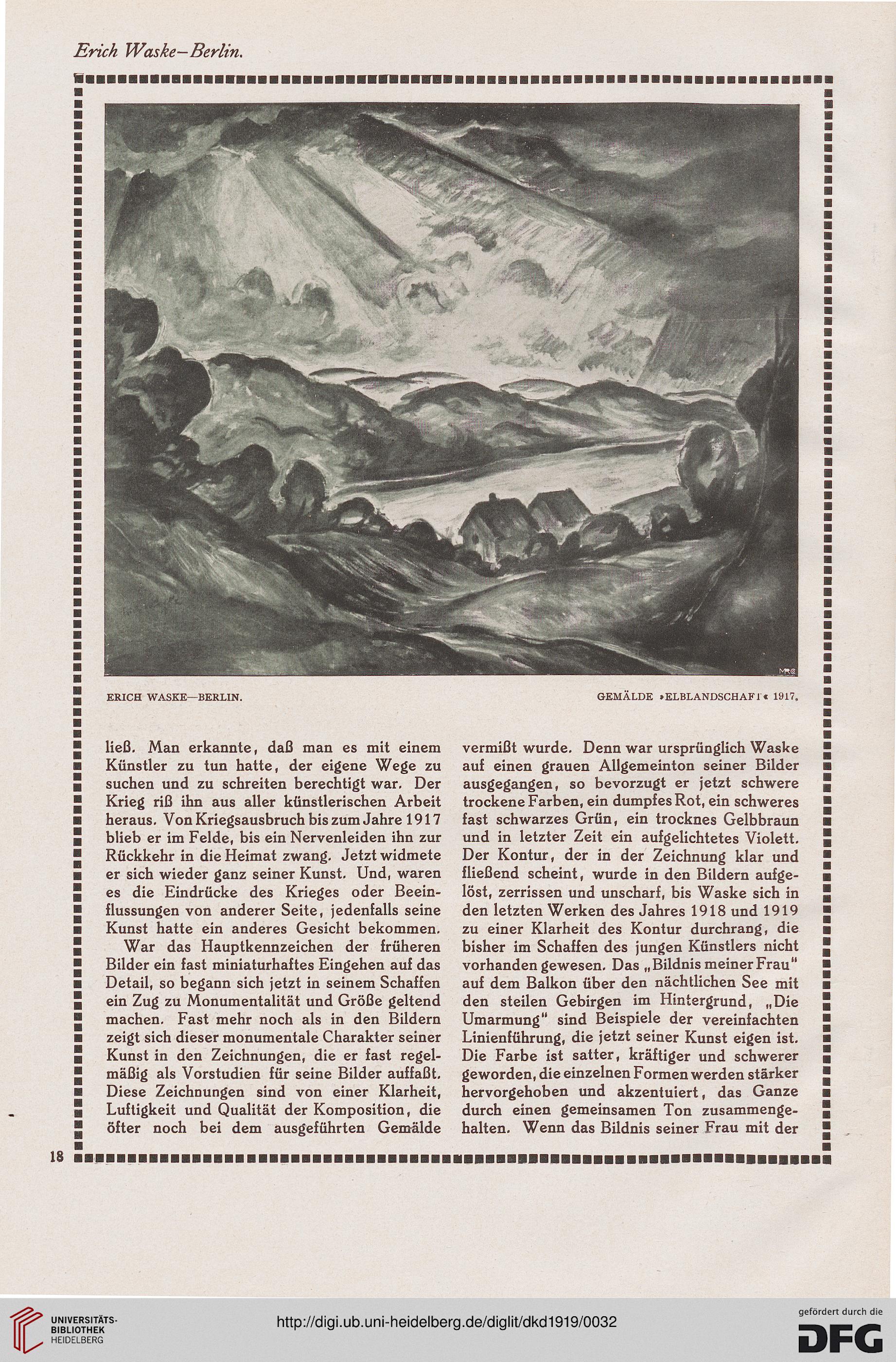Erich Waske—Berlin.
ERICH WASKE—BERLIN.
GEMÄLDE »ELBLANDSCHAF I« 1917.
ließ. Man erkannte, daß man es mit einem
Künstler zu tun hatte, der eigene Wege zu
suchen und zu schreiten berechtigt war. Der
Krieg riß ihn aus aller künstlerischen Arbeit
heraus. Von Kriegsausbruch bis zum Jahre 1917
blieb er im Felde, bis ein Nervenleiden ihn zur
Rückkehr in die Heimat zwang. Jetzt widmete
er sich wieder ganz seiner Kunst. Und, waren
es die Eindrücke des Krieges oder Beein-
flussungen von anderer Seite, jedenfalls seine
Kunst hatte ein anderes Gesicht bekommen.
War das Hauptkennzeichen der früheren
Bilder ein fast miniaturhaftes Eingehen auf das
Detail, so begann sich jetzt in seinem Schaffen
ein Zug zu Monumentalität und Größe geltend
machen. Fast mehr noch als in den Bildern
zeigt sich dieser monumentale Charakter seiner
Kunst in den Zeichnungen, die er fast regel-
mäßig als Vorstudien für seine Bilder auffaßt.
Diese Zeichnungen sind von einer Klarheit,
Luftigkeit und Qualität der Komposition, die
öfter noch bei dem ausgeführten Gemälde
vermißt wurde. Denn war ursprünglich Waske
auf einen grauen Allgemeinton seiner Bilder
ausgegangen, so bevorzugt er jetzt schwere
trockene Farben, ein dumpfes Rot, ein schweres
fast schwarzes Grün, ein trocknes Gelbbraun
und in letzter Zeit ein aufgelichtetes Violett.
Der Kontur, der in der Zeichnung klar und
fließend scheint, wurde in den Bildern aufge-
löst, zerrissen und unscharf, bis Waske sich in
den letzten Werken des Jahres 1918 und 1919
zu einer Klarheit des Kontur durchrang, die
bisher im Schaffen des jungen Künstlers nicht
vorhanden gewesen. Das „Bildnis meiner Frau"
auf dem Balkon über den nächtlichen See mit
den steilen Gebirgen im Hintergrund, „Die
Umarmung" sind Beispiele der vereinfachten
Linienführung, die jetzt seiner Kunst eigen ist.
Die Farbe ist satter, kräftiger und schwerer
geworden, die einzelnen Formen werden stärker
hervorgehoben und akzentuiert, das Ganze
durch einen gemeinsamen Ton zusammenge-
halten. Wenn das Bildnis seiner Frau mit der
ERICH WASKE—BERLIN.
GEMÄLDE »ELBLANDSCHAF I« 1917.
ließ. Man erkannte, daß man es mit einem
Künstler zu tun hatte, der eigene Wege zu
suchen und zu schreiten berechtigt war. Der
Krieg riß ihn aus aller künstlerischen Arbeit
heraus. Von Kriegsausbruch bis zum Jahre 1917
blieb er im Felde, bis ein Nervenleiden ihn zur
Rückkehr in die Heimat zwang. Jetzt widmete
er sich wieder ganz seiner Kunst. Und, waren
es die Eindrücke des Krieges oder Beein-
flussungen von anderer Seite, jedenfalls seine
Kunst hatte ein anderes Gesicht bekommen.
War das Hauptkennzeichen der früheren
Bilder ein fast miniaturhaftes Eingehen auf das
Detail, so begann sich jetzt in seinem Schaffen
ein Zug zu Monumentalität und Größe geltend
machen. Fast mehr noch als in den Bildern
zeigt sich dieser monumentale Charakter seiner
Kunst in den Zeichnungen, die er fast regel-
mäßig als Vorstudien für seine Bilder auffaßt.
Diese Zeichnungen sind von einer Klarheit,
Luftigkeit und Qualität der Komposition, die
öfter noch bei dem ausgeführten Gemälde
vermißt wurde. Denn war ursprünglich Waske
auf einen grauen Allgemeinton seiner Bilder
ausgegangen, so bevorzugt er jetzt schwere
trockene Farben, ein dumpfes Rot, ein schweres
fast schwarzes Grün, ein trocknes Gelbbraun
und in letzter Zeit ein aufgelichtetes Violett.
Der Kontur, der in der Zeichnung klar und
fließend scheint, wurde in den Bildern aufge-
löst, zerrissen und unscharf, bis Waske sich in
den letzten Werken des Jahres 1918 und 1919
zu einer Klarheit des Kontur durchrang, die
bisher im Schaffen des jungen Künstlers nicht
vorhanden gewesen. Das „Bildnis meiner Frau"
auf dem Balkon über den nächtlichen See mit
den steilen Gebirgen im Hintergrund, „Die
Umarmung" sind Beispiele der vereinfachten
Linienführung, die jetzt seiner Kunst eigen ist.
Die Farbe ist satter, kräftiger und schwerer
geworden, die einzelnen Formen werden stärker
hervorgehoben und akzentuiert, das Ganze
durch einen gemeinsamen Ton zusammenge-
halten. Wenn das Bildnis seiner Frau mit der