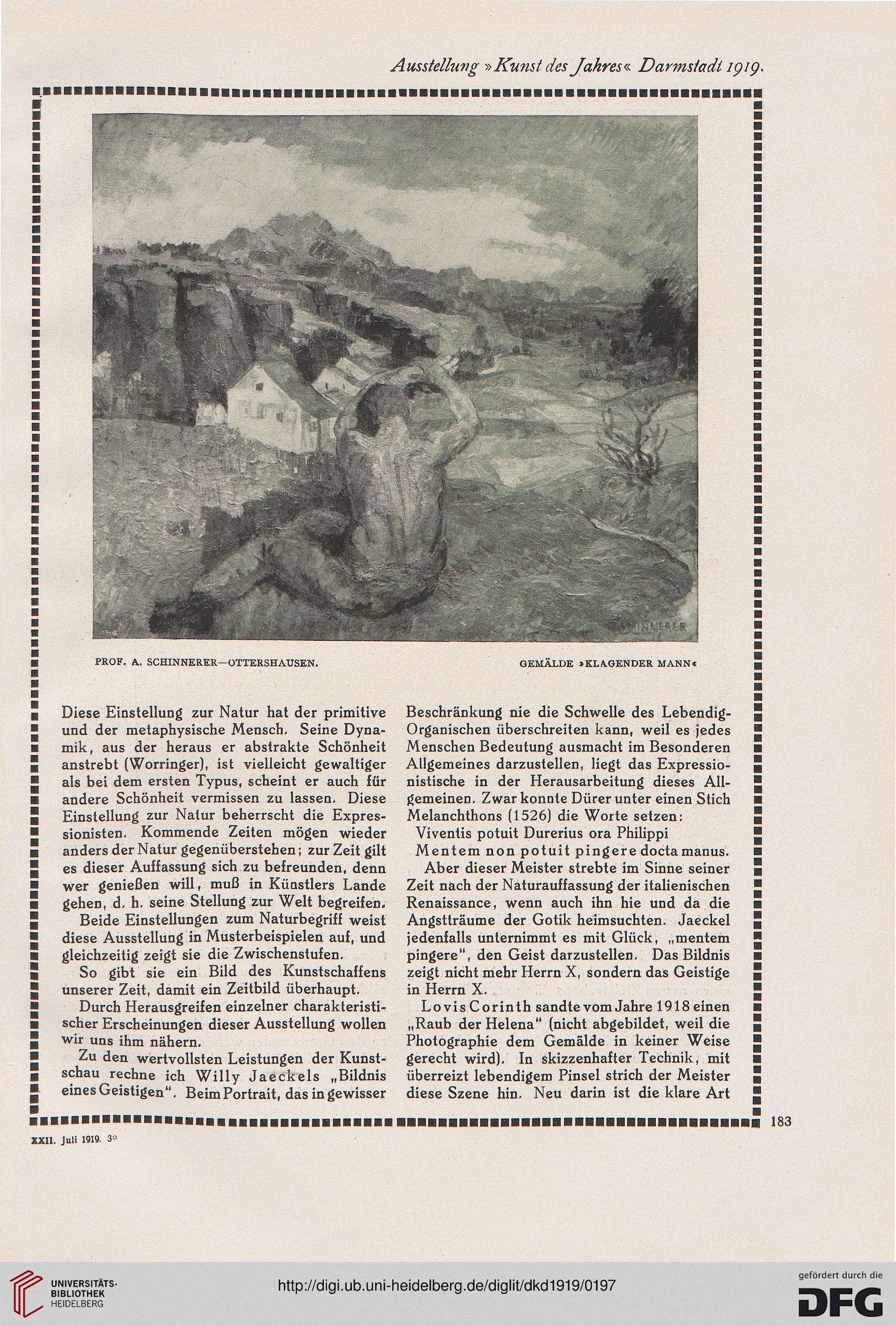Ausstellung » Kunst des Jahres«. Darmsiadt igig.
PROF. A. SCHTNNERER—OTTERSHAUSEN.
GEMÄLDE »KLAGENDER MANN«
Diese Einstellung zur Natur hat der primitive
und der metaphysische Mensch. Seine Dyna-
mik, aus der heraus er abstrakte Schönheit
anstrebt (Worringer), ist vielleicht gewaltiger
als bei dem ersten Typus, scheint er auch für
andere Schönheit vermissen zu lassen. Diese
Einstellung zur Natur beherrscht die Expres-
sionisten. Kommende Zeiten mögen wieder
anders der Natur gegenüberstehen; zur Zeit gilt
es dieser Auffassung sich zu befreunden, denn
wer genießen will, muß in Künstlers Lande
gehen, d. h. seine Stellung zur Welt begreifen.
Beide Einstellungen zum Naturbegriff weist
diese Ausstellung in Musterbeispielen auf, und
gleichzeitig zeigt sie die Zwischenstufen.
So gibt sie ein Bild des Kunstschaffens
unserer Zeit, damit ein Zeitbild überhaupt.
Durch Herausgreifen einzelner charakteristi-
scher Erscheinungen dieser Ausstellung wollen
wir uns ihm nähern.
Zu den wertvollsten Leistungen der Kunst-
schau rechne ich Willy Jaeckels „Bildnis
eines Geistigen". Beim Portrait, das in gewisser
Beschränkung nie die Schwelle des Lebendig-
Organischen überschreiten kann, weil es jedes
Menschen Bedeutung ausmacht im Besonderen
Allgemeines darzustellen, liegt das Expressio-
nistische in der Herausarbeitung dieses All-
gemeinen. Zwar konnte Dürer unter einen Stich
Melanchthons (1526) die Worte setzen:
Viventis potuit Durerius ora Philippi
Mentem non potuit pingere doctamanus.
Aber dieser Meister strebte im Sinne seiner
Zeit nach der Naturauffassung der italienischen
Renaissance, wenn auch ihn hie und da die
Angstträume der Gotik heimsuchten. Jaeckel
jedenfalls unternimmt es mit Glück, „mentem
pingere", den Geist darzustellen. Das Bildnis
zeigt nicht mehr Herrn X, sondern das Geistige
in Herrn X.
LovisCorinth sandte vom Jahre 1918einen
„Raub der Helena" (nicht abgebildet, weil die
Photographie dem Gemälde in keiner Weise
gerecht wird). In skizzenhafter Technik, mit
überreizt lebendigem Pinsel strich der Meister
diese Szene hin. Neu darin ist die klare Art
XXII. Juli 1919. 3*
PROF. A. SCHTNNERER—OTTERSHAUSEN.
GEMÄLDE »KLAGENDER MANN«
Diese Einstellung zur Natur hat der primitive
und der metaphysische Mensch. Seine Dyna-
mik, aus der heraus er abstrakte Schönheit
anstrebt (Worringer), ist vielleicht gewaltiger
als bei dem ersten Typus, scheint er auch für
andere Schönheit vermissen zu lassen. Diese
Einstellung zur Natur beherrscht die Expres-
sionisten. Kommende Zeiten mögen wieder
anders der Natur gegenüberstehen; zur Zeit gilt
es dieser Auffassung sich zu befreunden, denn
wer genießen will, muß in Künstlers Lande
gehen, d. h. seine Stellung zur Welt begreifen.
Beide Einstellungen zum Naturbegriff weist
diese Ausstellung in Musterbeispielen auf, und
gleichzeitig zeigt sie die Zwischenstufen.
So gibt sie ein Bild des Kunstschaffens
unserer Zeit, damit ein Zeitbild überhaupt.
Durch Herausgreifen einzelner charakteristi-
scher Erscheinungen dieser Ausstellung wollen
wir uns ihm nähern.
Zu den wertvollsten Leistungen der Kunst-
schau rechne ich Willy Jaeckels „Bildnis
eines Geistigen". Beim Portrait, das in gewisser
Beschränkung nie die Schwelle des Lebendig-
Organischen überschreiten kann, weil es jedes
Menschen Bedeutung ausmacht im Besonderen
Allgemeines darzustellen, liegt das Expressio-
nistische in der Herausarbeitung dieses All-
gemeinen. Zwar konnte Dürer unter einen Stich
Melanchthons (1526) die Worte setzen:
Viventis potuit Durerius ora Philippi
Mentem non potuit pingere doctamanus.
Aber dieser Meister strebte im Sinne seiner
Zeit nach der Naturauffassung der italienischen
Renaissance, wenn auch ihn hie und da die
Angstträume der Gotik heimsuchten. Jaeckel
jedenfalls unternimmt es mit Glück, „mentem
pingere", den Geist darzustellen. Das Bildnis
zeigt nicht mehr Herrn X, sondern das Geistige
in Herrn X.
LovisCorinth sandte vom Jahre 1918einen
„Raub der Helena" (nicht abgebildet, weil die
Photographie dem Gemälde in keiner Weise
gerecht wird). In skizzenhafter Technik, mit
überreizt lebendigem Pinsel strich der Meister
diese Szene hin. Neu darin ist die klare Art
XXII. Juli 1919. 3*