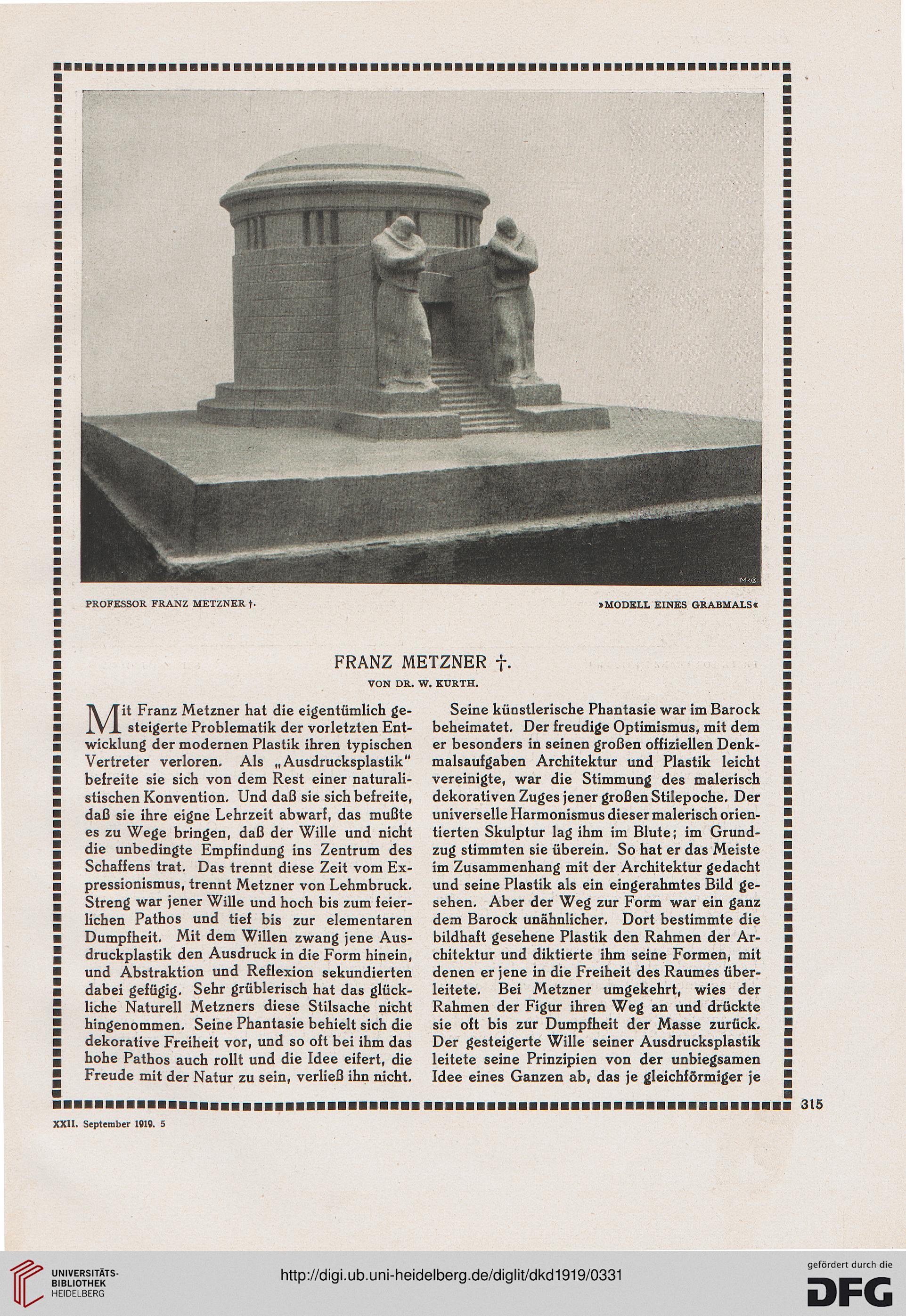PROFESSOR FRANZ METZNER t- »MODELL EINES GRABMALS«
FRANZ METZNER f.
VON DR. W. KURTH.
Mit Franz Metzner hat die eigentümlich ge-
steigerte Problematik der vorletzten Ent-
wicklung der modernen Plastik ihren typischen
Vertreter verloren. Als „Ausdrucksplastik"
befreite sie sich von dem Rest einer naturali-
stischen Konvention. Und daß sie sich befreite,
daß sie ihre eigne Lehrzeit abwarf, das mußte
es zu Wege bringen, daß der Wille und nicht
die unbedingte Empfindung ins Zentrum des
Schaffens trat. Das trennt diese Zeit vom Ex-
pressionismus, trennt Metzner von Lehmbruck.
Streng war jener Wille und hoch bis zum feier-
lichen Pathos und tief bis zur elementaren
Dumpfheit. Mit dem Willen zwang jene Aus-
druckplastik den Ausdruck in die Form hinein,
und Abstraktion und Reflexion sekundierten
dabei gefügig. Sehr grüblerisch hat das glück-
liche Naturell Metzners diese Stilsache nicht
hingenommen. Seine Phantasie behielt sich die
dekorative Freiheit vor, und so oft bei ihm das
hohe Pathos auch rollt und die Idee eifert, die
Freude mit der Natur zu sein, verließ ihn nicht.
Seine künstlerische Phantasie war im Barock
beheimatet. Der freudige Optimismus, mit dem
er besonders in seinen großen offiziellen Denk-
malsaufgaben Architektur und Plastik leicht
vereinigte, war die Stimmung des malerisch
dekorativen Zuges jener großen Stilepoche. Der
universelle Harmonismus dieser malerisch orien-
tierten Skulptur lag ihm im Blute; im Grund-
zug stimmten sie überein. So hat er das Meiste
im Zusammenhang mit der Architektur gedacht
und seine Plastik als ein eingerahmtes Bild ge-
sehen. Aber der Weg zur Form war ein ganz
dem Barock unähnlicher. Dort bestimmte die
bildhaft gesehene Plastik den Rahmen der Ar-
chitektur und diktierte ihm seine Formen, mit
denen er jene in die Freiheit des Raumes über-
leitete. Bei Metzner umgekehrt, wies der
Rahmen der Figur ihren Weg an und drückte
sie oft bis zur Dumpfheit der Masse zurück.
Der gesteigerte Wille seiner Ausdrucksplastik
leitete seine Prinzipien von der unbiegsamen
Idee eines Ganzen ab, das je gleichförmiger je
XXII. September 19ig. 5
FRANZ METZNER f.
VON DR. W. KURTH.
Mit Franz Metzner hat die eigentümlich ge-
steigerte Problematik der vorletzten Ent-
wicklung der modernen Plastik ihren typischen
Vertreter verloren. Als „Ausdrucksplastik"
befreite sie sich von dem Rest einer naturali-
stischen Konvention. Und daß sie sich befreite,
daß sie ihre eigne Lehrzeit abwarf, das mußte
es zu Wege bringen, daß der Wille und nicht
die unbedingte Empfindung ins Zentrum des
Schaffens trat. Das trennt diese Zeit vom Ex-
pressionismus, trennt Metzner von Lehmbruck.
Streng war jener Wille und hoch bis zum feier-
lichen Pathos und tief bis zur elementaren
Dumpfheit. Mit dem Willen zwang jene Aus-
druckplastik den Ausdruck in die Form hinein,
und Abstraktion und Reflexion sekundierten
dabei gefügig. Sehr grüblerisch hat das glück-
liche Naturell Metzners diese Stilsache nicht
hingenommen. Seine Phantasie behielt sich die
dekorative Freiheit vor, und so oft bei ihm das
hohe Pathos auch rollt und die Idee eifert, die
Freude mit der Natur zu sein, verließ ihn nicht.
Seine künstlerische Phantasie war im Barock
beheimatet. Der freudige Optimismus, mit dem
er besonders in seinen großen offiziellen Denk-
malsaufgaben Architektur und Plastik leicht
vereinigte, war die Stimmung des malerisch
dekorativen Zuges jener großen Stilepoche. Der
universelle Harmonismus dieser malerisch orien-
tierten Skulptur lag ihm im Blute; im Grund-
zug stimmten sie überein. So hat er das Meiste
im Zusammenhang mit der Architektur gedacht
und seine Plastik als ein eingerahmtes Bild ge-
sehen. Aber der Weg zur Form war ein ganz
dem Barock unähnlicher. Dort bestimmte die
bildhaft gesehene Plastik den Rahmen der Ar-
chitektur und diktierte ihm seine Formen, mit
denen er jene in die Freiheit des Raumes über-
leitete. Bei Metzner umgekehrt, wies der
Rahmen der Figur ihren Weg an und drückte
sie oft bis zur Dumpfheit der Masse zurück.
Der gesteigerte Wille seiner Ausdrucksplastik
leitete seine Prinzipien von der unbiegsamen
Idee eines Ganzen ab, das je gleichförmiger je
XXII. September 19ig. 5