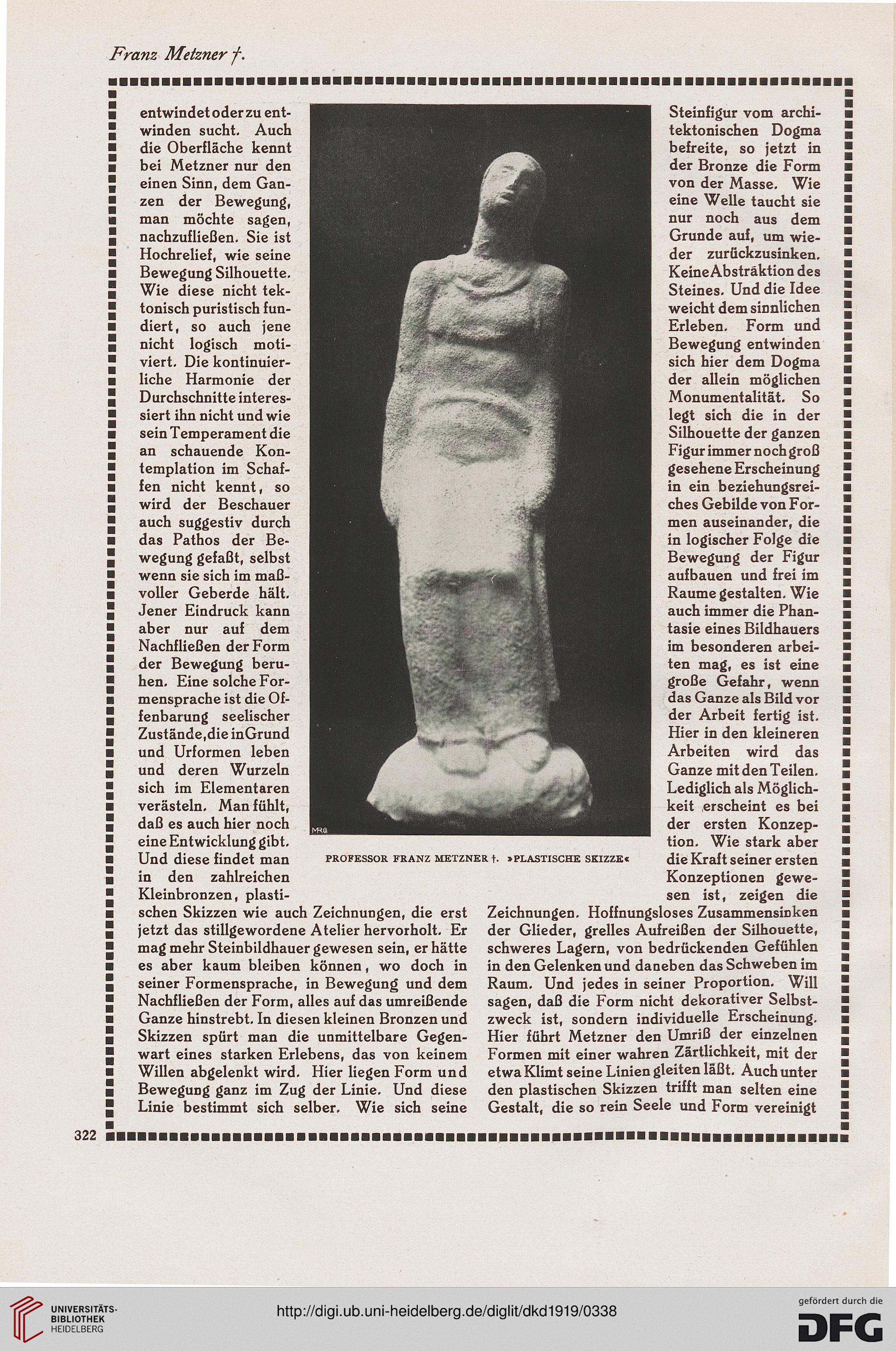Franz Metzner f.
entwindet oder zu ent-
winden sucht. Auch
die Oberfläche kennt
bei Metzner nur den
einen Sinn, dem Gan-
zen der Bewegung,
man möchte sagen,
nachzufließen. Sie ist
Hochrelief, wie seine
Bewegung Silhouette.
Wie diese nicht tele-
fonisch puristisch fun-
diert, so auch jene
nicht logisch moti-
viert. Die kontinuier-
liche Harmonie der
Durchschnitte interes-
siert ihn nicht und wie
sein Temperament die
an schauende Kon-
templation im Schaf-
fen nicht kennt, so
wird der Beschauer
auch suggestiv durch
das Pathos der Be-
wegung gefaßt, selbst
wenn sie sich im maß-
voller Geberde hält.
Jener Eindruck kann
aber nur auf dem
Nachfließen der Form
der Bewegung beru-
hen. Eine solche For-
mensprache ist die Of-
fenbarung seelischer
Zustände,die inGrund
und Urformen leben
und deren Wurzeln
sich im Elementaren
verästeln. Man fühlt,
daß es auch hier noch
eine Entwicklung gibt.
Und diese findet man
in den zahlreichen
Kleinbronzen, plasti-
schen Skizzen wie auch Zeichnungen, die erst
jetzt das stillgewordene Atelier hervorholt. Er
mag mehr Steinbildhauer gewesen sein, er hätte
es aber kaum bleiben können, wo doch in
seiner Formensprache, in Bewegung und dem
Nachfließen der Form, alles auf das umreißende
Ganze hinstrebt. In diesen kleinen Bronzen und
Skizzen spürt man die unmittelbare Gegen-
wart eines starken Erlebens, das von keinem
Willen abgelenkt wird. Hier liegen Form und
Bewegung ganz im Zug der Linie. Und diese
Linie bestimmt sich selber. Wie sich seine
PROFESSOR FRANZ METZNER t- »PLASTISCHE SKIZZE c
Steinfigur vom archi-
tektonischen Dogma
befreite, so jetzt in
der Bronze die Form
von der Masse. Wie
eine Welle taucht sie
nur noch aus dem
Grunde auf, um wie-
der zurückzusinken.
Keine Abstraktion des
Steines. Und die Idee
weicht dem sinnlichen
Erleben. Form und
Bewegung entwinden
sich hier dem Dogma
der allein möglichen
Monumentalität. So
legt sich die in der
Silhouette der ganzen
Figur immer n och groß
gesehene Erscheinung
in ein beziehungsrei-
ches Gebilde von For-
men auseinander, die
in logischer Folge die
Bewegung der Figur
aufbauen und frei im
Räume gestalten. Wie
auch immer die Phan-
tasie eines Bildhauers
im besonderen arbei-
ten mag, es ist eine
große Gefahr, wenn
das Ganze als Bild vor
der Arbeit fertig ist.
Hier in den kleineren
Arbeiten wird das
Ganze mit den Teilen.
Lediglich als Möglich-
keit erscheint es bei
der ersten Konzep-
tion. Wie stark aber
die Kraft seiner ersten
Konzeptionen gewe-
sen ist, zeigen die
Zeichnungen. Hoffnungsloses Zusammensinken
der Glieder, grelles Aufreißen der Silhouette,
schweres Lagern, von bedrückenden Gefühlen
in den Gelenken und daneben das Schweben im
Raum. Und jedes in seiner Proportion. Will
sagen, daß die Form nicht dekorativer Selbst-
zweck ist, sondern individuelle Erscheinung.
Hier führt Metzner den Umriß der einzelnen
Formen mit einer wahren Zärtlichkeit, mit der
etwa Klimt seine Linien gleiten läßt. Auch unter
den plastischen Skizzen trifft man selten eine
Gestalt, die so rein Seele und Form vereinigt
entwindet oder zu ent-
winden sucht. Auch
die Oberfläche kennt
bei Metzner nur den
einen Sinn, dem Gan-
zen der Bewegung,
man möchte sagen,
nachzufließen. Sie ist
Hochrelief, wie seine
Bewegung Silhouette.
Wie diese nicht tele-
fonisch puristisch fun-
diert, so auch jene
nicht logisch moti-
viert. Die kontinuier-
liche Harmonie der
Durchschnitte interes-
siert ihn nicht und wie
sein Temperament die
an schauende Kon-
templation im Schaf-
fen nicht kennt, so
wird der Beschauer
auch suggestiv durch
das Pathos der Be-
wegung gefaßt, selbst
wenn sie sich im maß-
voller Geberde hält.
Jener Eindruck kann
aber nur auf dem
Nachfließen der Form
der Bewegung beru-
hen. Eine solche For-
mensprache ist die Of-
fenbarung seelischer
Zustände,die inGrund
und Urformen leben
und deren Wurzeln
sich im Elementaren
verästeln. Man fühlt,
daß es auch hier noch
eine Entwicklung gibt.
Und diese findet man
in den zahlreichen
Kleinbronzen, plasti-
schen Skizzen wie auch Zeichnungen, die erst
jetzt das stillgewordene Atelier hervorholt. Er
mag mehr Steinbildhauer gewesen sein, er hätte
es aber kaum bleiben können, wo doch in
seiner Formensprache, in Bewegung und dem
Nachfließen der Form, alles auf das umreißende
Ganze hinstrebt. In diesen kleinen Bronzen und
Skizzen spürt man die unmittelbare Gegen-
wart eines starken Erlebens, das von keinem
Willen abgelenkt wird. Hier liegen Form und
Bewegung ganz im Zug der Linie. Und diese
Linie bestimmt sich selber. Wie sich seine
PROFESSOR FRANZ METZNER t- »PLASTISCHE SKIZZE c
Steinfigur vom archi-
tektonischen Dogma
befreite, so jetzt in
der Bronze die Form
von der Masse. Wie
eine Welle taucht sie
nur noch aus dem
Grunde auf, um wie-
der zurückzusinken.
Keine Abstraktion des
Steines. Und die Idee
weicht dem sinnlichen
Erleben. Form und
Bewegung entwinden
sich hier dem Dogma
der allein möglichen
Monumentalität. So
legt sich die in der
Silhouette der ganzen
Figur immer n och groß
gesehene Erscheinung
in ein beziehungsrei-
ches Gebilde von For-
men auseinander, die
in logischer Folge die
Bewegung der Figur
aufbauen und frei im
Räume gestalten. Wie
auch immer die Phan-
tasie eines Bildhauers
im besonderen arbei-
ten mag, es ist eine
große Gefahr, wenn
das Ganze als Bild vor
der Arbeit fertig ist.
Hier in den kleineren
Arbeiten wird das
Ganze mit den Teilen.
Lediglich als Möglich-
keit erscheint es bei
der ersten Konzep-
tion. Wie stark aber
die Kraft seiner ersten
Konzeptionen gewe-
sen ist, zeigen die
Zeichnungen. Hoffnungsloses Zusammensinken
der Glieder, grelles Aufreißen der Silhouette,
schweres Lagern, von bedrückenden Gefühlen
in den Gelenken und daneben das Schweben im
Raum. Und jedes in seiner Proportion. Will
sagen, daß die Form nicht dekorativer Selbst-
zweck ist, sondern individuelle Erscheinung.
Hier führt Metzner den Umriß der einzelnen
Formen mit einer wahren Zärtlichkeit, mit der
etwa Klimt seine Linien gleiten läßt. Auch unter
den plastischen Skizzen trifft man selten eine
Gestalt, die so rein Seele und Form vereinigt