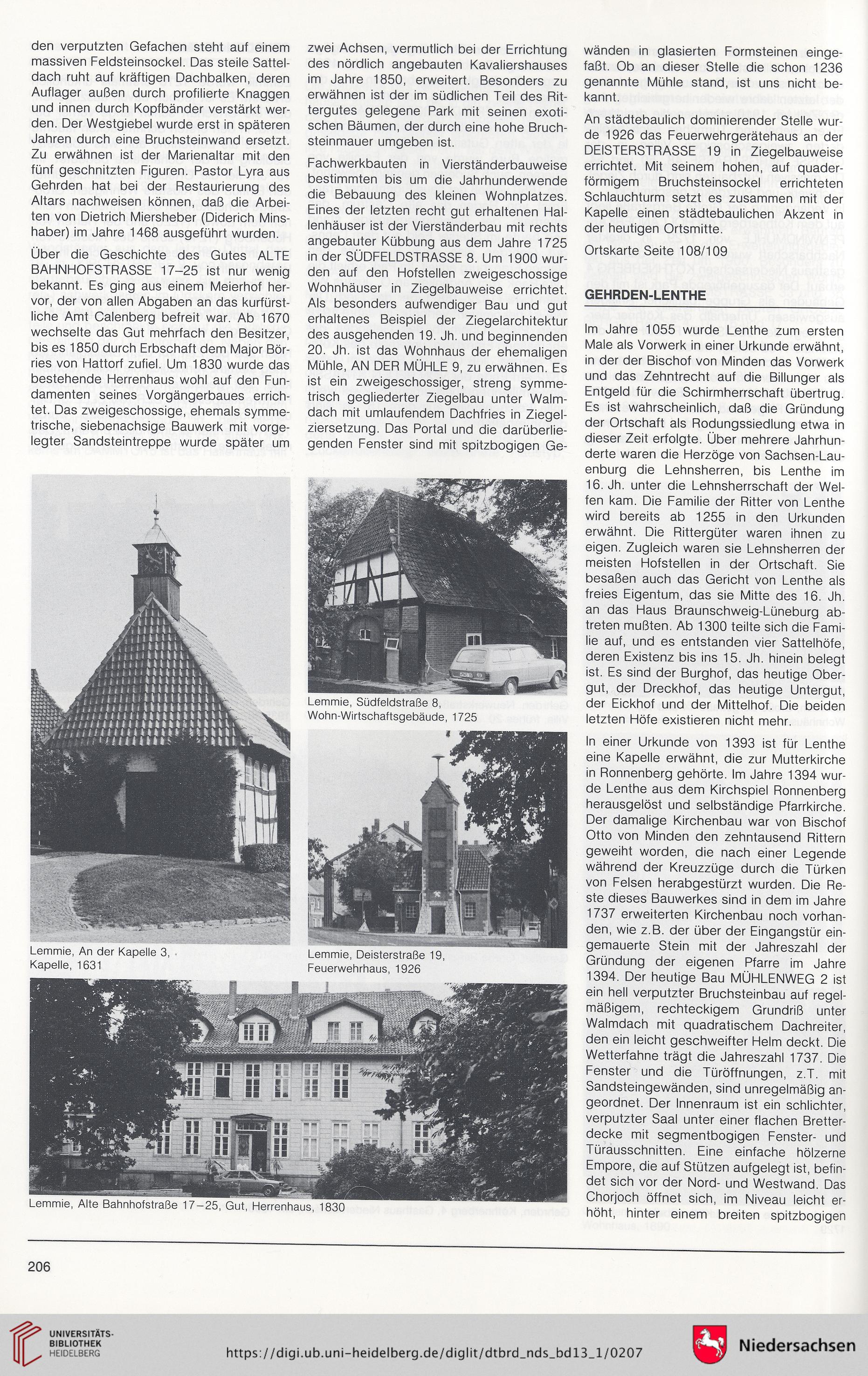wänden in glasierten Formsteinen einge-
faßt. Ob an dieser Stelle die schon 1236
genannte Mühle stand, ist uns nicht be-
kannt.
An städtebaulich dominierender Stelle wur-
de 1926 das Feuerwehrgerätehaus an der
DEISTERSTRASSE 19 in Ziegelbauweise
errichtet. Mit seinem hohen, auf quader-
förmigem Bruchsteinsockel errichteten
Schlauchturm setzt es zusammen mit der
Kapelle einen städtebaulichen Akzent in
der heutigen Ortsmitte.
Ortskarte Seite 108/109
GEHRDEN-LENTHE
Im Jahre 1055 wurde Lenthe zum ersten
Male als Vorwerk in einer Urkunde erwähnt,
in der der Bischof von Minden das Vorwerk
und das Zehntrecht auf die Billunger als
Entgeld für die Schirmherrschaft übertrug.
Es ist wahrscheinlich, daß die Gründung
der Ortschaft als Rodungssiedlung etwa in
dieser Zeit erfolgte. Über mehrere Jahrhun-
derte waren die Herzöge von Sachsen-Lau-
enburg die Lehnsherren, bis Lenthe im
16. Jh. unter die Lehnsherrschaft der Wel-
fen kam. Die Familie der Ritter von Lenthe
wird bereits ab 1255 in den Urkunden
erwähnt. Die Rittergüter waren ihnen zu
eigen. Zugleich waren sie Lehnsherren der
meisten Hofstellen in der Ortschaft. Sie
besaßen auch das Gericht von Lenthe als
freies Eigentum, das sie Mitte des 16. Jh.
an das Haus Braunschweig-Lüneburg ab-
treten mußten. Ab 1300 teilte sich die Fami-
lie auf, und es entstanden vier Sattelhöfe,
deren Existenz bis ins 15. Jh. hinein belegt
ist. Es sind der Burghof, das heutige Ober-
gut, der Dreckhof, das heutige Untergut,
der Eickhof und der Mittelhof. Die beiden
letzten Höfe existieren nicht mehr.
In einer Urkunde von 1393 ist für Lenthe
eine Kapelle erwähnt, die zur Mutterkirche
in Ronnenberg gehörte. Im Jahre 1394 wur-
de Lenthe aus dem Kirchspiel Ronnenberg
herausgelöst und selbständige Pfarrkirche.
Der damalige Kirchenbau war von Bischof
Otto von Minden den zehntausend Rittern
geweiht worden, die nach einer Legende
während der Kreuzzüge durch die Türken
von Felsen herabgestürzt wurden. Die Re-
ste dieses Bauwerkes sind in dem im Jahre
1737 erweiterten Kirchenbau noch vorhan-
den, wie z.B. der über der Eingangstür ein-
gemauerte Stein mit der Jahreszahl der
Gründung der eigenen Pfarre im Jahre
1394. Der heutige Bau MÜHLENWEG 2 ist
ein hell verputzter Bruchsteinbau auf regel-
mäßigem, rechteckigem Grundriß unter
Walmdach mit quadratischem Dachreiter,
den ein leicht geschweifter Helm deckt. Die
Wetterfahne trägt die Jahreszahl 1737. Die
Fenster und die Türöffnungen, z.T. mit
Sandsteingewänden, sind unregelmäßig an-
geordnet. Der Innenraum ist ein schlichter,
verputzter Saal unter einer flachen Bretter-
decke mit segmentbogigen Fenster- und
Türausschnitten. Eine einfache hölzerne
Empore, die auf Stützen aufgelegt ist, befin-
det sich vor der Nord- und Westwand. Das
Chorjoch öffnet sich, im Niveau leicht er-
höht, hinter einem breiten spitzbogigen
den verputzten Gefachen steht auf einem
massiven Feldsteinsockel. Das steile Sattel-
dach ruht auf kräftigen Dachbalken, deren
Auflager außen durch profilierte Knaggen
und innen durch Kopfbänder verstärkt wer-
den. Der Westgiebel wurde erst in späteren
Jahren durch eine Bruchsteinwand ersetzt.
Zu erwähnen ist der Marienaltar mit den
fünf geschnitzten Figuren. Pastor Lyra aus
Gehrden hat bei der Restaurierung des
Altars nachweisen können, daß die Arbei-
ten von Dietrich Miersheber (Diderich Mins-
haber) im Jahre 1468 ausgeführt wurden.
Über die Geschichte des Gutes ALTE
BAHNHOFSTRASSE 17-25 ist nur wenig
bekannt. Es ging aus einem Meierhof her-
vor, der von allen Abgaben an das kurfürst-
liche Amt Calenberg befreit war. Ab 1670
wechselte das Gut mehrfach den Besitzer,
bis es 1850 durch Erbschaft dem Major Bor-
ries von Hattorf zufiel. Um 1830 wurde das
bestehende Herrenhaus wohl auf den Fun-
damenten seines Vorgängerbaues errich-
tet. Das zweigeschossige, ehemals symme-
trische, siebenachsige Bauwerk mit vorge-
legter Sandsteintreppe wurde später um
zwei Achsen, vermutlich bei der Errichtung
des nördlich angebauten Kavaliershauses
im Jahre 1850, erweitert. Besonders zu
erwähnen ist der im südlichen Teil des Rit-
tergutes gelegene Park mit seinen exoti-
schen Bäumen, der durch eine hohe Bruch-
steinmauer umgeben ist.
Fachwerkbauten in Vierständerbauweise
bestimmten bis um die Jahrhunderwende
die Bebauung des kleinen Wohnplatzes.
Eines der letzten recht gut erhaltenen Hal-
lenhäuser ist der Vierständerbau mit rechts
angebauter Kübbung aus dem Jahre 1725
in der SÜDFELDSTRASSE 8. Um 1900 wur-
den auf den Hofstellen zweigeschossige
Wohnhäuser in Ziegelbauweise errichtet.
Als besonders aufwendiger Bau und gut
erhaltenes Beispiel der Ziegelarchitektur
des ausgehenden 19. Jh. und beginnenden
20. Jh. ist das Wohnhaus der ehemaligen
Mühle, AN DER MÜHLE 9, zu erwähnen. Es
ist ein zweigeschossiger, streng symme-
trisch gegliederter Ziegelbau unter Walm-
dach mit umlaufendem Dachfries in Ziegel-
ziersetzung. Das Portal und die darüberlie-
genden Fenster sind mit spitzbogigen Ge-
Lemmie, Südfeldstraße 8,
Wohn-Wirtschaftsgebäude, 1725
Lemmie, An der Kapelle 3,
Kapelle, 1631
Lemmie, Deisterstraße 19,
Feuerwehrhaus, 1926
Lemmie, Alte Bahnhofstraße 17-25, Gut, Herrenhaus, 1830
206