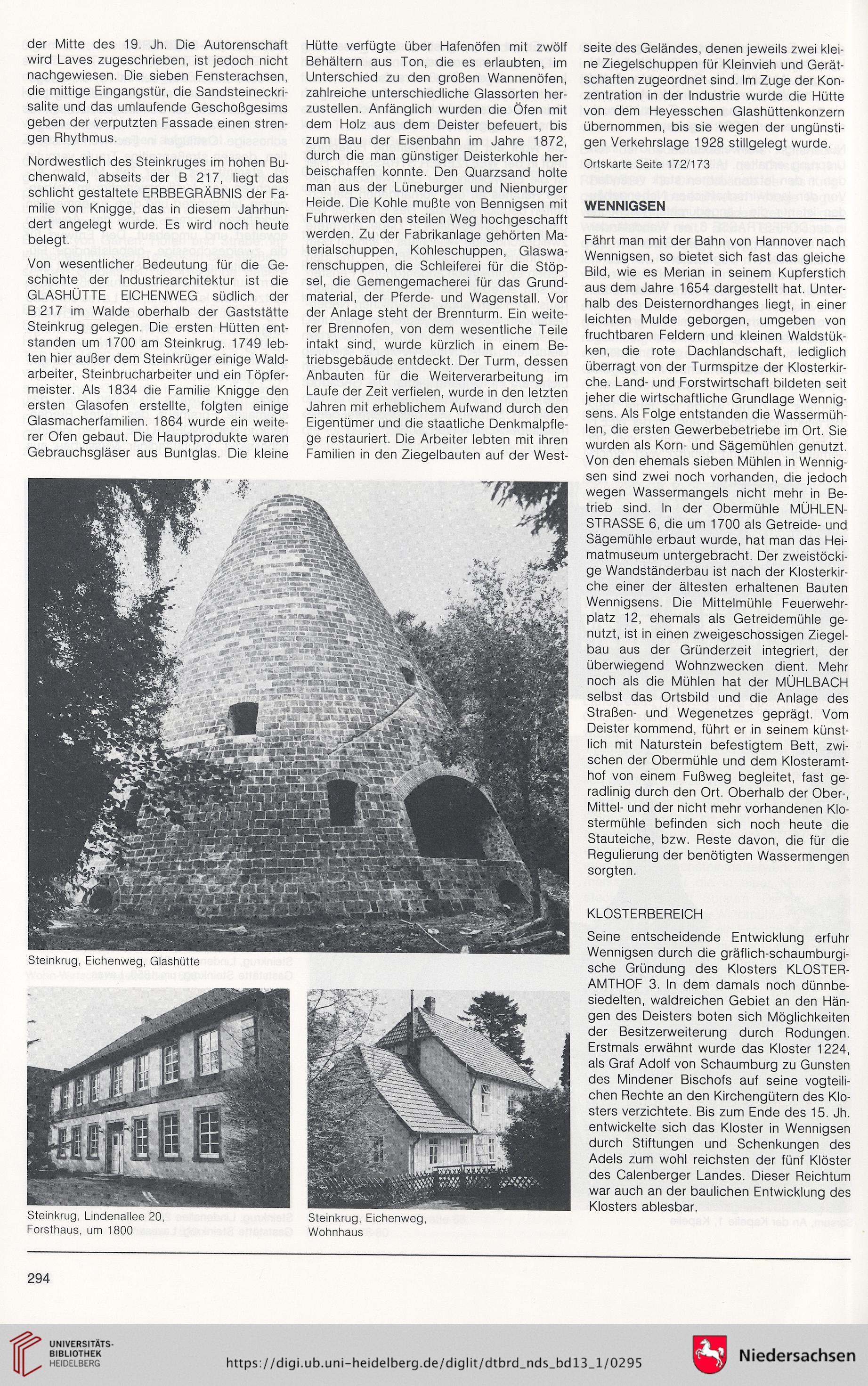der Mitte des 19. Jh. Die Autorenschaft
wird Laves zugeschrieben, ist jedoch nicht
nachgewiesen. Die sieben Fensterachsen,
die mittige Eingangstür, die Sandsteineckri-
salite und das umlaufende Geschoßgesims
geben der verputzten Fassade einen stren-
gen Rhythmus.
Nordwestlich des Steinkruges im hohen Bu-
chenwald, abseits der B 217, liegt das
schlicht gestaltete ERBBEGRÄBNIS der Fa-
milie von Knigge, das in diesem Jahrhun-
dert angelegt wurde. Es wird noch heute
belegt.
Von wesentlicher Bedeutung für die Ge-
schichte der Industriearchitektur ist die
GLASHÜTTE EICHENWEG südlich der
B217 im Walde oberhalb der Gaststätte
Steinkrug gelegen. Die ersten Hütten ent-
standen um 1700 am Steinkrug. 1749 leb-
ten hier außer dem Steinkrüger einige Wald-
arbeiter, Steinbrucharbeiter und ein Töpfer-
meister. Als 1834 die Familie Knigge den
ersten Glasofen erstellte, folgten einige
Glasmacherfamilien. 1864 wurde ein weite-
rer Ofen gebaut. Die Hauptprodukte waren
Gebrauchsgläser aus Buntglas. Die kleine
Steinkrug, Eichenweg, Glashütte
Hütte verfügte über Hafenöfen mit zwölf
Behältern aus Ton, die es erlaubten, im
Unterschied zu den großen Wannenöfen,
zahlreiche unterschiedliche Glassorten her-
zustellen. Anfänglich wurden die Öfen mit
dem Holz aus dem Deister befeuert, bis
zum Bau der Eisenbahn im Jahre 1872,
durch die man günstiger Deisterkohle her-
beischaffen konnte. Den Quarzsand holte
man aus der Lüneburger und Nienburger
Heide. Die Kohle mußte von Bennigsen mit
Fuhrwerken den steilen Weg hochgeschafft
werden. Zu der Fabrikanlage gehörten Ma-
terialschuppen, Kohleschuppen, Glaswa-
renschuppen, die Schleiferei für die Stöp-
sel, die Gemengemacherei für das Grund-
material, der Pferde- und Wagenstall. Vor
der Anlage steht der Brennturm. Ein weite-
rer Brennofen, von dem wesentliche Teile
intakt sind, wurde kürzlich in einem Be-
triebsgebäude entdeckt. Der Turm, dessen
Anbauten für die Weiterverarbeitung im
Laufe der Zeit verfielen, wurde in den letzten
Jahren mit erheblichem Aufwand durch den
Eigentümer und die staatliche Denkmalpfle-
ge restauriert. Die Arbeiter lebten mit ihren
Familien in den Ziegelbauten auf der West¬
seite des Geländes, denen jeweils zwei klei-
ne Ziegelschuppen für Kleinvieh und Gerät-
schaften zugeordnet sind. Im Zuge der Kon-
zentration in der Industrie wurde die Hütte
von dem Heyesschen Glashüttenkonzern
übernommen, bis sie wegen der ungünsti-
gen Verkehrslage 1928 stillgelegt wurde.
Ortskarte Seite 172/173
WENNIGSEN
Fährt man mit der Bahn von Hannover nach
Wennigsen, so bietet sich fast das gleiche
Bild, wie es Merian in seinem Kupferstich
aus dem Jahre 1654 dargestellt hat. Unter-
halb des Deisternordhanges liegt, in einer
leichten Mulde geborgen, umgeben von
fruchtbaren Feldern und kleinen Waldstük-
ken, die rote Dachlandschaft, lediglich
überragt von der Turmspitze der Klosterkir-
che. Land- und Forstwirtschaft bildeten seit
jeher die wirtschaftliche Grundlage Wennig-
sens. Als Folge entstanden die Wassermüh-
len, die ersten Gewerbebetriebe im Ort. Sie
wurden als Korn- und Sägemühlen genutzt.
Von den ehemals sieben Mühlen in Wennig-
sen sind zwei noch vorhanden, die jedoch
wegen Wassermangels nicht mehr in Be-
trieb sind. In der Obermühle MÜHLEN-
STRASSE 6, die um 1700 als Getreide- und
Sägemühle erbaut wurde, hat man das Hei-
matmuseum untergebracht. Der zweistöcki-
ge Wandständerbau ist nach der Klosterkir-
che einer der ältesten erhaltenen Bauten
Wennigsens. Die Mittelmühle Feuerwehr-
platz 12, ehemals als Getreidemühle ge-
nutzt, ist in einen zweigeschossigen Ziegel-
bau aus der Gründerzeit integriert, der
überwiegend Wohnzwecken dient. Mehr
noch als die Mühlen hat der MÜHLBACH
selbst das Ortsbild und die Anlage des
Straßen- und Wegenetzes geprägt. Vom
Deister kommend, führt er in seinem künst-
lich mit Naturstein befestigtem Bett, zwi-
schen der Obermühle und dem Klosteramt-
hof von einem Fußweg begleitet, fast ge-
radlinig durch den Ort. Oberhalb der Ober-,
Mittel- und der nicht mehr vorhandenen Klo-
stermühle befinden sich noch heute die
Stauteiche, bzw. Reste davon, die für die
Regulierung der benötigten Wassermengen
sorgten.
KLOSTERBEREICH
Seine entscheidende Entwicklung erfuhr
Wennigsen durch die gräflich-schaumburgi-
sche Gründung des Klosters KLOSTER-
AMTHOF 3. In dem damals noch dünnbe-
siedelten, waldreichen Gebiet an den Hän-
gen des Deisters boten sich Möglichkeiten
der Besitzerweiterung durch Rodungen.
Erstmals erwähnt wurde das Kloster 1224,
als Graf Adolf von Schaumburg zu Gunsten
des Mindener Bischofs auf seine vogteili-
chen Rechte an den Kirchengütem des Klo-
sters verzichtete. Bis zum Ende des 15. Jh.
entwickelte sich das Kloster in Wennigsen
durch Stiftungen und Schenkungen des
Adels zum wohl reichsten der fünf Klöster
des Calenberger Landes. Dieser Reichtum
war auch an der baulichen Entwicklung des
Klosters ablesbar.
294
wird Laves zugeschrieben, ist jedoch nicht
nachgewiesen. Die sieben Fensterachsen,
die mittige Eingangstür, die Sandsteineckri-
salite und das umlaufende Geschoßgesims
geben der verputzten Fassade einen stren-
gen Rhythmus.
Nordwestlich des Steinkruges im hohen Bu-
chenwald, abseits der B 217, liegt das
schlicht gestaltete ERBBEGRÄBNIS der Fa-
milie von Knigge, das in diesem Jahrhun-
dert angelegt wurde. Es wird noch heute
belegt.
Von wesentlicher Bedeutung für die Ge-
schichte der Industriearchitektur ist die
GLASHÜTTE EICHENWEG südlich der
B217 im Walde oberhalb der Gaststätte
Steinkrug gelegen. Die ersten Hütten ent-
standen um 1700 am Steinkrug. 1749 leb-
ten hier außer dem Steinkrüger einige Wald-
arbeiter, Steinbrucharbeiter und ein Töpfer-
meister. Als 1834 die Familie Knigge den
ersten Glasofen erstellte, folgten einige
Glasmacherfamilien. 1864 wurde ein weite-
rer Ofen gebaut. Die Hauptprodukte waren
Gebrauchsgläser aus Buntglas. Die kleine
Steinkrug, Eichenweg, Glashütte
Hütte verfügte über Hafenöfen mit zwölf
Behältern aus Ton, die es erlaubten, im
Unterschied zu den großen Wannenöfen,
zahlreiche unterschiedliche Glassorten her-
zustellen. Anfänglich wurden die Öfen mit
dem Holz aus dem Deister befeuert, bis
zum Bau der Eisenbahn im Jahre 1872,
durch die man günstiger Deisterkohle her-
beischaffen konnte. Den Quarzsand holte
man aus der Lüneburger und Nienburger
Heide. Die Kohle mußte von Bennigsen mit
Fuhrwerken den steilen Weg hochgeschafft
werden. Zu der Fabrikanlage gehörten Ma-
terialschuppen, Kohleschuppen, Glaswa-
renschuppen, die Schleiferei für die Stöp-
sel, die Gemengemacherei für das Grund-
material, der Pferde- und Wagenstall. Vor
der Anlage steht der Brennturm. Ein weite-
rer Brennofen, von dem wesentliche Teile
intakt sind, wurde kürzlich in einem Be-
triebsgebäude entdeckt. Der Turm, dessen
Anbauten für die Weiterverarbeitung im
Laufe der Zeit verfielen, wurde in den letzten
Jahren mit erheblichem Aufwand durch den
Eigentümer und die staatliche Denkmalpfle-
ge restauriert. Die Arbeiter lebten mit ihren
Familien in den Ziegelbauten auf der West¬
seite des Geländes, denen jeweils zwei klei-
ne Ziegelschuppen für Kleinvieh und Gerät-
schaften zugeordnet sind. Im Zuge der Kon-
zentration in der Industrie wurde die Hütte
von dem Heyesschen Glashüttenkonzern
übernommen, bis sie wegen der ungünsti-
gen Verkehrslage 1928 stillgelegt wurde.
Ortskarte Seite 172/173
WENNIGSEN
Fährt man mit der Bahn von Hannover nach
Wennigsen, so bietet sich fast das gleiche
Bild, wie es Merian in seinem Kupferstich
aus dem Jahre 1654 dargestellt hat. Unter-
halb des Deisternordhanges liegt, in einer
leichten Mulde geborgen, umgeben von
fruchtbaren Feldern und kleinen Waldstük-
ken, die rote Dachlandschaft, lediglich
überragt von der Turmspitze der Klosterkir-
che. Land- und Forstwirtschaft bildeten seit
jeher die wirtschaftliche Grundlage Wennig-
sens. Als Folge entstanden die Wassermüh-
len, die ersten Gewerbebetriebe im Ort. Sie
wurden als Korn- und Sägemühlen genutzt.
Von den ehemals sieben Mühlen in Wennig-
sen sind zwei noch vorhanden, die jedoch
wegen Wassermangels nicht mehr in Be-
trieb sind. In der Obermühle MÜHLEN-
STRASSE 6, die um 1700 als Getreide- und
Sägemühle erbaut wurde, hat man das Hei-
matmuseum untergebracht. Der zweistöcki-
ge Wandständerbau ist nach der Klosterkir-
che einer der ältesten erhaltenen Bauten
Wennigsens. Die Mittelmühle Feuerwehr-
platz 12, ehemals als Getreidemühle ge-
nutzt, ist in einen zweigeschossigen Ziegel-
bau aus der Gründerzeit integriert, der
überwiegend Wohnzwecken dient. Mehr
noch als die Mühlen hat der MÜHLBACH
selbst das Ortsbild und die Anlage des
Straßen- und Wegenetzes geprägt. Vom
Deister kommend, führt er in seinem künst-
lich mit Naturstein befestigtem Bett, zwi-
schen der Obermühle und dem Klosteramt-
hof von einem Fußweg begleitet, fast ge-
radlinig durch den Ort. Oberhalb der Ober-,
Mittel- und der nicht mehr vorhandenen Klo-
stermühle befinden sich noch heute die
Stauteiche, bzw. Reste davon, die für die
Regulierung der benötigten Wassermengen
sorgten.
KLOSTERBEREICH
Seine entscheidende Entwicklung erfuhr
Wennigsen durch die gräflich-schaumburgi-
sche Gründung des Klosters KLOSTER-
AMTHOF 3. In dem damals noch dünnbe-
siedelten, waldreichen Gebiet an den Hän-
gen des Deisters boten sich Möglichkeiten
der Besitzerweiterung durch Rodungen.
Erstmals erwähnt wurde das Kloster 1224,
als Graf Adolf von Schaumburg zu Gunsten
des Mindener Bischofs auf seine vogteili-
chen Rechte an den Kirchengütem des Klo-
sters verzichtete. Bis zum Ende des 15. Jh.
entwickelte sich das Kloster in Wennigsen
durch Stiftungen und Schenkungen des
Adels zum wohl reichsten der fünf Klöster
des Calenberger Landes. Dieser Reichtum
war auch an der baulichen Entwicklung des
Klosters ablesbar.
294