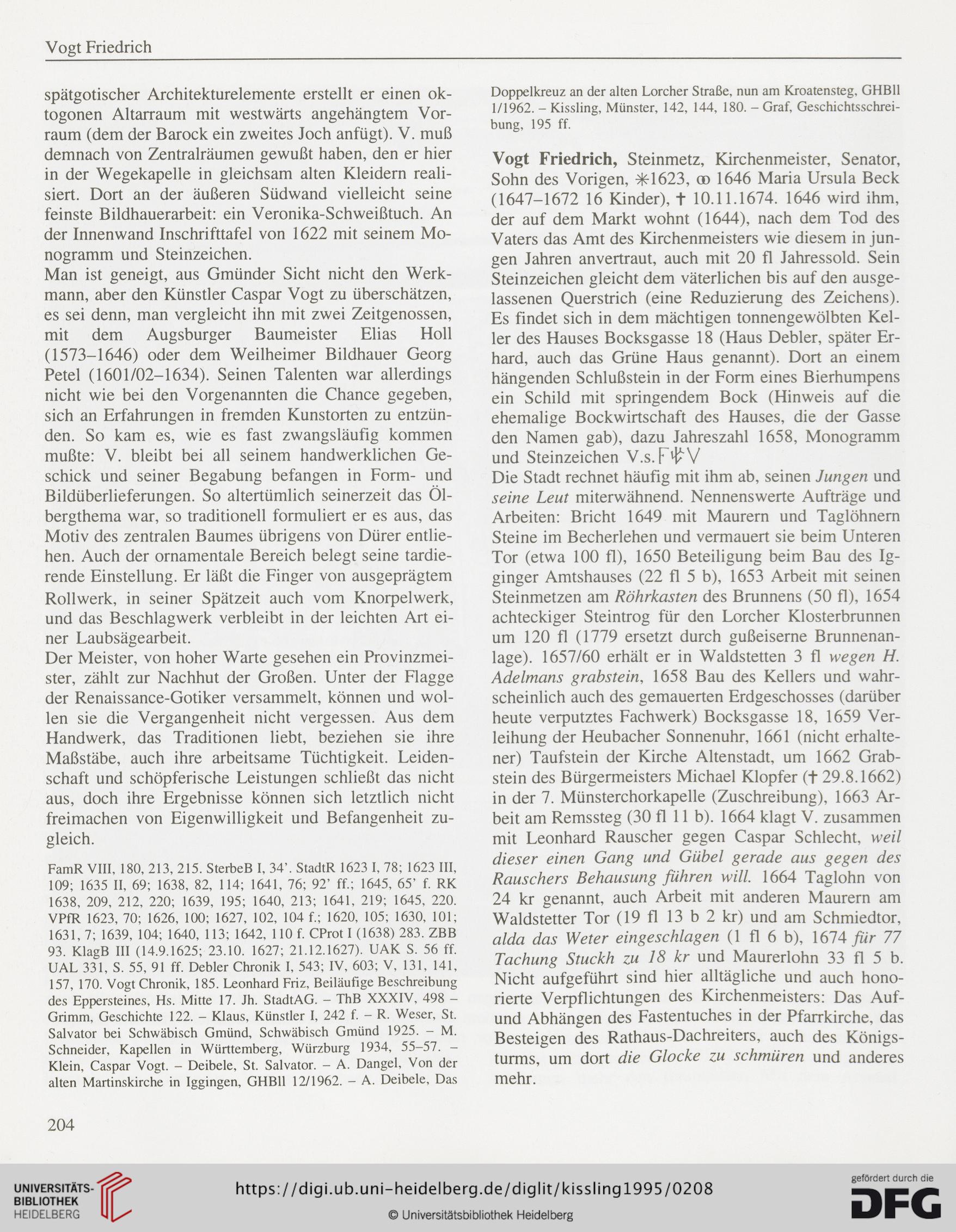Vogt Friedrich
spätgotischer Architekturelemente erstellt er einen ok-
togonen Altarraum mit westwärts angehängtem Vor-
raum (dem der Barock ein zweites Joch anfügt). V. muß
demnach von Zentralräumen gewußt haben, den er hier
in der Wegekapelle in gleichsam alten Kleidern reali-
siert. Dort an der äußeren Südwand vielleicht seine
feinste Bildhauerarbeit: ein Veronika-Schweißtuch. An
der Innenwand Inschrifttafel von 1622 mit seinem Mo-
nogramm und Steinzeichen.
Man ist geneigt, aus Gmünder Sicht nicht den Werk-
mann, aber den Künstler Caspar Vogt zu überschätzen,
es sei denn, man vergleicht ihn mit zwei Zeitgenossen,
mit dem Augsburger Baumeister Elias Holl
(1573-1646) oder dem Weilheimer Bildhauer Georg
Petel (1601/02-1634). Seinen Talenten war allerdings
nicht wie bei den Vorgenannten die Chance gegeben,
sich an Erfahrungen in fremden Kunstorten zu entzün-
den. So kam es, wie es fast zwangsläufig kommen
mußte: V. bleibt bei all seinem handwerklichen Ge-
schick und seiner Begabung befangen in Form- und
Bildüberlieferungen. So altertümlich seinerzeit das Öl-
bergthema war, so traditionell formuliert er es aus, das
Motiv des zentralen Baumes übrigens von Dürer entlie-
hen. Auch der ornamentale Bereich belegt seine tarie-
rende Einstellung. Er läßt die Finger von ausgeprägtem
Rollwerk, in seiner Spätzeit auch vom Knorpelwerk,
und das Beschlagwerk verbleibt in der leichten Art ei-
ner Laubsägearbeit.
Der Meister, von hoher Warte gesehen ein Provinzmei-
ster, zählt zur Nachhut der Großen. Unter der Flagge
der Renaissance-Gotiker versammelt, können und wol-
len sie die Vergangenheit nicht vergessen. Aus dem
Handwerk, das Traditionen liebt, beziehen sie ihre
Maßstäbe, auch ihre arbeitsame Tüchtigkeit. Leiden-
schaft und schöpferische Leistungen schließt das nicht
aus, doch ihre Ergebnisse können sich letztlich nicht
freimachen von Eigenwilligkeit und Befangenheit zu-
gleich.
FamR VIII, 180, 213, 215. SterbeB I, 34’. StadtR 1623 I, 78; 1623 III,
109; 1635 II, 69; 1638, 82, 114; 1641, 76; 92’ ff.; 1645, 65’ f. RK
1638, 209, 212, 220; 1639, 195; 1640, 213; 1641, 219; 1645, 220.
VPfR 1623, 70; 1626, 100; 1627, 102, 104 f.; 1620, 105; 1630, 101;
1631,7; 1639, 104; 1640, 113; 1642, 110 f. CProt I (1638) 283. ZBB
93. KlagB III (14.9.1625; 23.10. 1627; 21.12.1627). UAK S. 56 ff.
UAL 331, S. 55, 91 ff. Debler Chronik I, 543; IV, 603; V, 131, 141,
157, 170. Vogt Chronik, 185. Leonhard Friz, Beiläufige Beschreibung
des Eppersteines, Hs. Mitte 17. Jh. StadtAG. - ThB XXXIV, 498 —
Grimm, Geschichte 122. — Klaus, Künstler I, 242 f. - R. Weser, St.
Salvator bei Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Gmünd 1925. - M.
Schneider, Kapellen in Württemberg, Würzburg 1934, 55-57. -
Klein, Caspar Vogt. - Deibele, St. Salvator. - A. Dangel, Von der
alten Martinskirche in Iggingen, GHB11 12/1962. - A. Deibele, Das
Doppelkreuz an der alten Lorcher Straße, nun am Kroatensteg, GHB11
1/1962. - Kissling, Münster, 142, 144, 180. - Graf, Geschichtsschrei-
bung, 195 ff.
Vogt Friedrich, Steinmetz, Kirchenmeister, Senator,
Sohn des Vorigen, *1623, ® 1646 Maria Ursula Beck
(1647-1672 16 Kinder), + 10.11.1674. 1646 wird ihm,
der auf dem Markt wohnt (1644), nach dem Tod des
Vaters das Amt des Kirchenmeisters wie diesem in jun-
gen Jahren anvertraut, auch mit 20 fl Jahressold. Sein
Steinzeichen gleicht dem väterlichen bis auf den ausge-
lassenen Querstrich (eine Reduzierung des Zeichens).
Es findet sich in dem mächtigen tonnengewölbten Kel-
ler des Hauses Bocksgasse 18 (Haus Debler, später Er-
hard, auch das Grüne Haus genannt). Dort an einem
hängenden Schlußstein in der Form eines Bierhumpens
ein Schild mit springendem Bock (Hinweis auf die
ehemalige Bockwirtschaft des Hauses, die der Gasse
den Namen gab), dazu Jahreszahl 1658, Monogramm
und Steinzeichen V.s.
Die Stadt rechnet häufig mit ihm ab, seinen Jungen und
seine Leut miterwähnend. Nennenswerte Aufträge und
Arbeiten: Bricht 1649 mit Maurern und Taglöhnern
Steine im Becherlehen und vermauert sie beim Unteren
Tor (etwa 100 fl), 1650 Beteiligung beim Bau des Ig-
ginger Amtshauses (22 fl 5 b), 1653 Arbeit mit seinen
Steinmetzen am Röhrkasten des Brunnens (50 fl), 1654
achteckiger Steintrog für den Lorcher Klosterbrunnen
um 120 fl (1779 ersetzt durch gußeiserne Brunnenan-
lage). 1657/60 erhält er in Waldstetten 3 fl wegen H.
Adelmans grabstein, 1658 Bau des Kellers und wahr-
scheinlich auch des gemauerten Erdgeschosses (darüber
heute verputztes Fachwerk) Bocksgasse 18, 1659 Ver-
leihung der Heubacher Sonnenuhr, 1661 (nicht erhalte-
ner) Taufstein der Kirche Altenstadt, um 1662 Grab-
stein des Bürgermeisters Michael Klopfer (t 29.8.1662)
in der 7. Münsterchorkapelle (Zuschreibung), 1663 Ar-
beit am Remssteg (30 fl 11 b). 1664 klagt V. zusammen
mit Leonhard Rauscher gegen Caspar Schlecht, weil
dieser einen Gang und Gäbel gerade aus gegen des
Rauschers Behausung führen will. 1664 Taglohn von
24 kr genannt, auch Arbeit mit anderen Maurern am
Waldstetter Tor (19 fl 13 b 2 kr) und am Schmiedtor,
alda das Weter eingeschlagen (1 fl 6 b), 1674 für 77
Tachung Stuckh zu 18 kr und Maurerlohn 33 fl 5 b.
Nicht aufgeführt sind hier alltägliche und auch hono-
rierte Verpflichtungen des Kirchenmeisters: Das Auf-
und Abhängen des Fastentuches in der Pfarrkirche, das
Besteigen des Rathaus-Dachreiters, auch des Königs-
turms, um dort die Glocke zu schmüren und anderes
mehr.
204
spätgotischer Architekturelemente erstellt er einen ok-
togonen Altarraum mit westwärts angehängtem Vor-
raum (dem der Barock ein zweites Joch anfügt). V. muß
demnach von Zentralräumen gewußt haben, den er hier
in der Wegekapelle in gleichsam alten Kleidern reali-
siert. Dort an der äußeren Südwand vielleicht seine
feinste Bildhauerarbeit: ein Veronika-Schweißtuch. An
der Innenwand Inschrifttafel von 1622 mit seinem Mo-
nogramm und Steinzeichen.
Man ist geneigt, aus Gmünder Sicht nicht den Werk-
mann, aber den Künstler Caspar Vogt zu überschätzen,
es sei denn, man vergleicht ihn mit zwei Zeitgenossen,
mit dem Augsburger Baumeister Elias Holl
(1573-1646) oder dem Weilheimer Bildhauer Georg
Petel (1601/02-1634). Seinen Talenten war allerdings
nicht wie bei den Vorgenannten die Chance gegeben,
sich an Erfahrungen in fremden Kunstorten zu entzün-
den. So kam es, wie es fast zwangsläufig kommen
mußte: V. bleibt bei all seinem handwerklichen Ge-
schick und seiner Begabung befangen in Form- und
Bildüberlieferungen. So altertümlich seinerzeit das Öl-
bergthema war, so traditionell formuliert er es aus, das
Motiv des zentralen Baumes übrigens von Dürer entlie-
hen. Auch der ornamentale Bereich belegt seine tarie-
rende Einstellung. Er läßt die Finger von ausgeprägtem
Rollwerk, in seiner Spätzeit auch vom Knorpelwerk,
und das Beschlagwerk verbleibt in der leichten Art ei-
ner Laubsägearbeit.
Der Meister, von hoher Warte gesehen ein Provinzmei-
ster, zählt zur Nachhut der Großen. Unter der Flagge
der Renaissance-Gotiker versammelt, können und wol-
len sie die Vergangenheit nicht vergessen. Aus dem
Handwerk, das Traditionen liebt, beziehen sie ihre
Maßstäbe, auch ihre arbeitsame Tüchtigkeit. Leiden-
schaft und schöpferische Leistungen schließt das nicht
aus, doch ihre Ergebnisse können sich letztlich nicht
freimachen von Eigenwilligkeit und Befangenheit zu-
gleich.
FamR VIII, 180, 213, 215. SterbeB I, 34’. StadtR 1623 I, 78; 1623 III,
109; 1635 II, 69; 1638, 82, 114; 1641, 76; 92’ ff.; 1645, 65’ f. RK
1638, 209, 212, 220; 1639, 195; 1640, 213; 1641, 219; 1645, 220.
VPfR 1623, 70; 1626, 100; 1627, 102, 104 f.; 1620, 105; 1630, 101;
1631,7; 1639, 104; 1640, 113; 1642, 110 f. CProt I (1638) 283. ZBB
93. KlagB III (14.9.1625; 23.10. 1627; 21.12.1627). UAK S. 56 ff.
UAL 331, S. 55, 91 ff. Debler Chronik I, 543; IV, 603; V, 131, 141,
157, 170. Vogt Chronik, 185. Leonhard Friz, Beiläufige Beschreibung
des Eppersteines, Hs. Mitte 17. Jh. StadtAG. - ThB XXXIV, 498 —
Grimm, Geschichte 122. — Klaus, Künstler I, 242 f. - R. Weser, St.
Salvator bei Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Gmünd 1925. - M.
Schneider, Kapellen in Württemberg, Würzburg 1934, 55-57. -
Klein, Caspar Vogt. - Deibele, St. Salvator. - A. Dangel, Von der
alten Martinskirche in Iggingen, GHB11 12/1962. - A. Deibele, Das
Doppelkreuz an der alten Lorcher Straße, nun am Kroatensteg, GHB11
1/1962. - Kissling, Münster, 142, 144, 180. - Graf, Geschichtsschrei-
bung, 195 ff.
Vogt Friedrich, Steinmetz, Kirchenmeister, Senator,
Sohn des Vorigen, *1623, ® 1646 Maria Ursula Beck
(1647-1672 16 Kinder), + 10.11.1674. 1646 wird ihm,
der auf dem Markt wohnt (1644), nach dem Tod des
Vaters das Amt des Kirchenmeisters wie diesem in jun-
gen Jahren anvertraut, auch mit 20 fl Jahressold. Sein
Steinzeichen gleicht dem väterlichen bis auf den ausge-
lassenen Querstrich (eine Reduzierung des Zeichens).
Es findet sich in dem mächtigen tonnengewölbten Kel-
ler des Hauses Bocksgasse 18 (Haus Debler, später Er-
hard, auch das Grüne Haus genannt). Dort an einem
hängenden Schlußstein in der Form eines Bierhumpens
ein Schild mit springendem Bock (Hinweis auf die
ehemalige Bockwirtschaft des Hauses, die der Gasse
den Namen gab), dazu Jahreszahl 1658, Monogramm
und Steinzeichen V.s.
Die Stadt rechnet häufig mit ihm ab, seinen Jungen und
seine Leut miterwähnend. Nennenswerte Aufträge und
Arbeiten: Bricht 1649 mit Maurern und Taglöhnern
Steine im Becherlehen und vermauert sie beim Unteren
Tor (etwa 100 fl), 1650 Beteiligung beim Bau des Ig-
ginger Amtshauses (22 fl 5 b), 1653 Arbeit mit seinen
Steinmetzen am Röhrkasten des Brunnens (50 fl), 1654
achteckiger Steintrog für den Lorcher Klosterbrunnen
um 120 fl (1779 ersetzt durch gußeiserne Brunnenan-
lage). 1657/60 erhält er in Waldstetten 3 fl wegen H.
Adelmans grabstein, 1658 Bau des Kellers und wahr-
scheinlich auch des gemauerten Erdgeschosses (darüber
heute verputztes Fachwerk) Bocksgasse 18, 1659 Ver-
leihung der Heubacher Sonnenuhr, 1661 (nicht erhalte-
ner) Taufstein der Kirche Altenstadt, um 1662 Grab-
stein des Bürgermeisters Michael Klopfer (t 29.8.1662)
in der 7. Münsterchorkapelle (Zuschreibung), 1663 Ar-
beit am Remssteg (30 fl 11 b). 1664 klagt V. zusammen
mit Leonhard Rauscher gegen Caspar Schlecht, weil
dieser einen Gang und Gäbel gerade aus gegen des
Rauschers Behausung führen will. 1664 Taglohn von
24 kr genannt, auch Arbeit mit anderen Maurern am
Waldstetter Tor (19 fl 13 b 2 kr) und am Schmiedtor,
alda das Weter eingeschlagen (1 fl 6 b), 1674 für 77
Tachung Stuckh zu 18 kr und Maurerlohn 33 fl 5 b.
Nicht aufgeführt sind hier alltägliche und auch hono-
rierte Verpflichtungen des Kirchenmeisters: Das Auf-
und Abhängen des Fastentuches in der Pfarrkirche, das
Besteigen des Rathaus-Dachreiters, auch des Königs-
turms, um dort die Glocke zu schmüren und anderes
mehr.
204