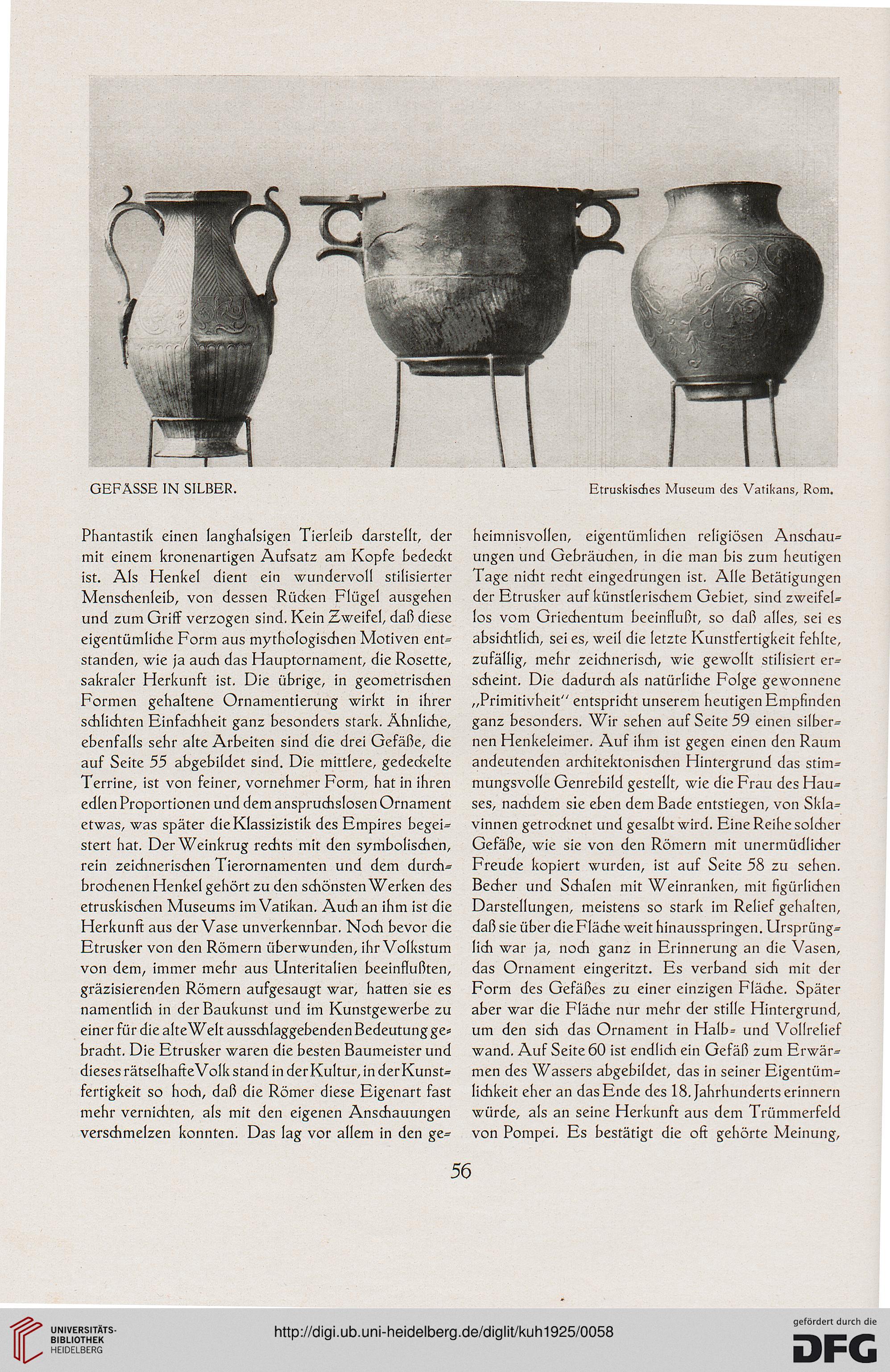GEFÄSSE IN SILBER.
Etruskisdies Museum des Vatikans, Rom.
Phantastik einen langhalsigen Tierleib darstellt, der
mit einem kronenartigen Aufsatz am Kopfe bedeckt
ist. Als Henkel dient ein wundervoll stilisierter
Menschenleib, von dessen Rücken Flügel ausgehen
und zum Griff verzogen sind. Kein Zweifel, daß diese
eigentümliche Form aus mythologischen Motiven ent-
standen, wie ja auch das Hauptornament, die Rosette,
sakraler Herkunft ist. Die übrige, in geometrischen
Formen gehaltene Ornamentierung wirkt in ihrer
schlichten Einfachheit ganz besonders stark. Ähnliche,
ebenfalls sehr alte Arbeiten sind die drei Gefäße, die
auf Seite 55 abgebildet sind. Die mittlere, gedeckelte
Terrine, ist von feiner, vornehmer Form, hat in ihren
edlen Proportionen und dem anspruchslosen Ornament
etwas, was später dieKlassizistik des Empires begei-
stert hat. Der Weinkrug rechts mit den symbolischen,
rein zeichnerischen Tierornamenten und dem durchs
brochenen Henkel gehört zu den schönsten Werken des
etruskischen Museums im Vatikan. Auch an ihm ist die
Herkunft aus der Vase unverkennbar. Noch bevor die
Etrusker von den Römern überwunden, ihr Volkstum
von dem, immer mehr aus Unteritalien beeinflußten,
gräzisierenden Römern aufgesaugt war, hatten sie es
namentlich in der Baukunst und im Kunstgewerbe zu
einer für die alte Welt ausschlaggebenden Bedeutung ge«
bracht. Die Etrusker waren die besten Baumeister und
dieses rätselhafte Volk stand in der Kultur, in derKunst-
fertigkeit so hoch, daß die Römer diese Eigenart fast
mehr vernichten, als mit den eigenen Anschauungen
verschmelzen konnten. Das lag vor allem in den ge-
heimnisvollen, eigentümlichen religiösen Anschau-
ungen und Gebräuchen, in die man bis zum heutigen
Tage nicht recht eingedrungen ist. Alle Betätigungen
der Etrusker auf künstlerischem Gebiet, sind zweifeU
los vom Griechentum beeinflußt, so daß alles, sei es
absichtlich, sei es, weil die letzte Kunstfertigkeit fehlte,
zufällig, mehr zeichnerisch, wie gewollt stilisiert er-
scheint. Die dadurch als natürliche Folge gewonnene
„Primitivheit" entspricht unserem heutigen Empfinden
ganz besonders. Wir sehen auf Seite 59 einen silber-
nen Henkeleimer. Auf ihm ist gegen einen den Raum
andeutenden architektonischen Hintergrund das stim-
mungsvolle Genrebild gestellt, wie die Frau des Hau-
ses, nachdem sie eben dem Bade entstiegen, von Skla-
Vinnen getrocknet und gesalbt wird. Eine Reihe solcher
Gefäße, wie sie von den Römern mit unermüdlicher
Freude kopiert wurden, ist auf Seite 58 zu sehen.
Becher und Schalen mit Weinranken, mit figürlichen
Darstellungen, meistens so stark im Relief gehalten,
daß sie über die Fläche weit hinausspringen. Ursprünge
lieh war ja, noch ganz in Erinnerung an die Vasen,
das Ornament eingeritzt. Es verband sich mit der
Form des Gefäßes zu einer einzigen Fläche. Später
aber war die Fläche nur mehr der stille Hintergrund,
um den sich das Ornament in Halb= und Vollrelief
wand. Auf Seite 60 ist endlich ein Gefäß zum Erwär-
men des Wassers abgebildet, das in seiner Eigentüm-
lichkeit eher an das Ende des 18. Jahrhunderts erinnern
würde, als an seine Herkunft aus dem Trümmerfeld
von Pompei. Es bestätigt die oft gehörte Meinung,
56
Etruskisdies Museum des Vatikans, Rom.
Phantastik einen langhalsigen Tierleib darstellt, der
mit einem kronenartigen Aufsatz am Kopfe bedeckt
ist. Als Henkel dient ein wundervoll stilisierter
Menschenleib, von dessen Rücken Flügel ausgehen
und zum Griff verzogen sind. Kein Zweifel, daß diese
eigentümliche Form aus mythologischen Motiven ent-
standen, wie ja auch das Hauptornament, die Rosette,
sakraler Herkunft ist. Die übrige, in geometrischen
Formen gehaltene Ornamentierung wirkt in ihrer
schlichten Einfachheit ganz besonders stark. Ähnliche,
ebenfalls sehr alte Arbeiten sind die drei Gefäße, die
auf Seite 55 abgebildet sind. Die mittlere, gedeckelte
Terrine, ist von feiner, vornehmer Form, hat in ihren
edlen Proportionen und dem anspruchslosen Ornament
etwas, was später dieKlassizistik des Empires begei-
stert hat. Der Weinkrug rechts mit den symbolischen,
rein zeichnerischen Tierornamenten und dem durchs
brochenen Henkel gehört zu den schönsten Werken des
etruskischen Museums im Vatikan. Auch an ihm ist die
Herkunft aus der Vase unverkennbar. Noch bevor die
Etrusker von den Römern überwunden, ihr Volkstum
von dem, immer mehr aus Unteritalien beeinflußten,
gräzisierenden Römern aufgesaugt war, hatten sie es
namentlich in der Baukunst und im Kunstgewerbe zu
einer für die alte Welt ausschlaggebenden Bedeutung ge«
bracht. Die Etrusker waren die besten Baumeister und
dieses rätselhafte Volk stand in der Kultur, in derKunst-
fertigkeit so hoch, daß die Römer diese Eigenart fast
mehr vernichten, als mit den eigenen Anschauungen
verschmelzen konnten. Das lag vor allem in den ge-
heimnisvollen, eigentümlichen religiösen Anschau-
ungen und Gebräuchen, in die man bis zum heutigen
Tage nicht recht eingedrungen ist. Alle Betätigungen
der Etrusker auf künstlerischem Gebiet, sind zweifeU
los vom Griechentum beeinflußt, so daß alles, sei es
absichtlich, sei es, weil die letzte Kunstfertigkeit fehlte,
zufällig, mehr zeichnerisch, wie gewollt stilisiert er-
scheint. Die dadurch als natürliche Folge gewonnene
„Primitivheit" entspricht unserem heutigen Empfinden
ganz besonders. Wir sehen auf Seite 59 einen silber-
nen Henkeleimer. Auf ihm ist gegen einen den Raum
andeutenden architektonischen Hintergrund das stim-
mungsvolle Genrebild gestellt, wie die Frau des Hau-
ses, nachdem sie eben dem Bade entstiegen, von Skla-
Vinnen getrocknet und gesalbt wird. Eine Reihe solcher
Gefäße, wie sie von den Römern mit unermüdlicher
Freude kopiert wurden, ist auf Seite 58 zu sehen.
Becher und Schalen mit Weinranken, mit figürlichen
Darstellungen, meistens so stark im Relief gehalten,
daß sie über die Fläche weit hinausspringen. Ursprünge
lieh war ja, noch ganz in Erinnerung an die Vasen,
das Ornament eingeritzt. Es verband sich mit der
Form des Gefäßes zu einer einzigen Fläche. Später
aber war die Fläche nur mehr der stille Hintergrund,
um den sich das Ornament in Halb= und Vollrelief
wand. Auf Seite 60 ist endlich ein Gefäß zum Erwär-
men des Wassers abgebildet, das in seiner Eigentüm-
lichkeit eher an das Ende des 18. Jahrhunderts erinnern
würde, als an seine Herkunft aus dem Trümmerfeld
von Pompei. Es bestätigt die oft gehörte Meinung,
56