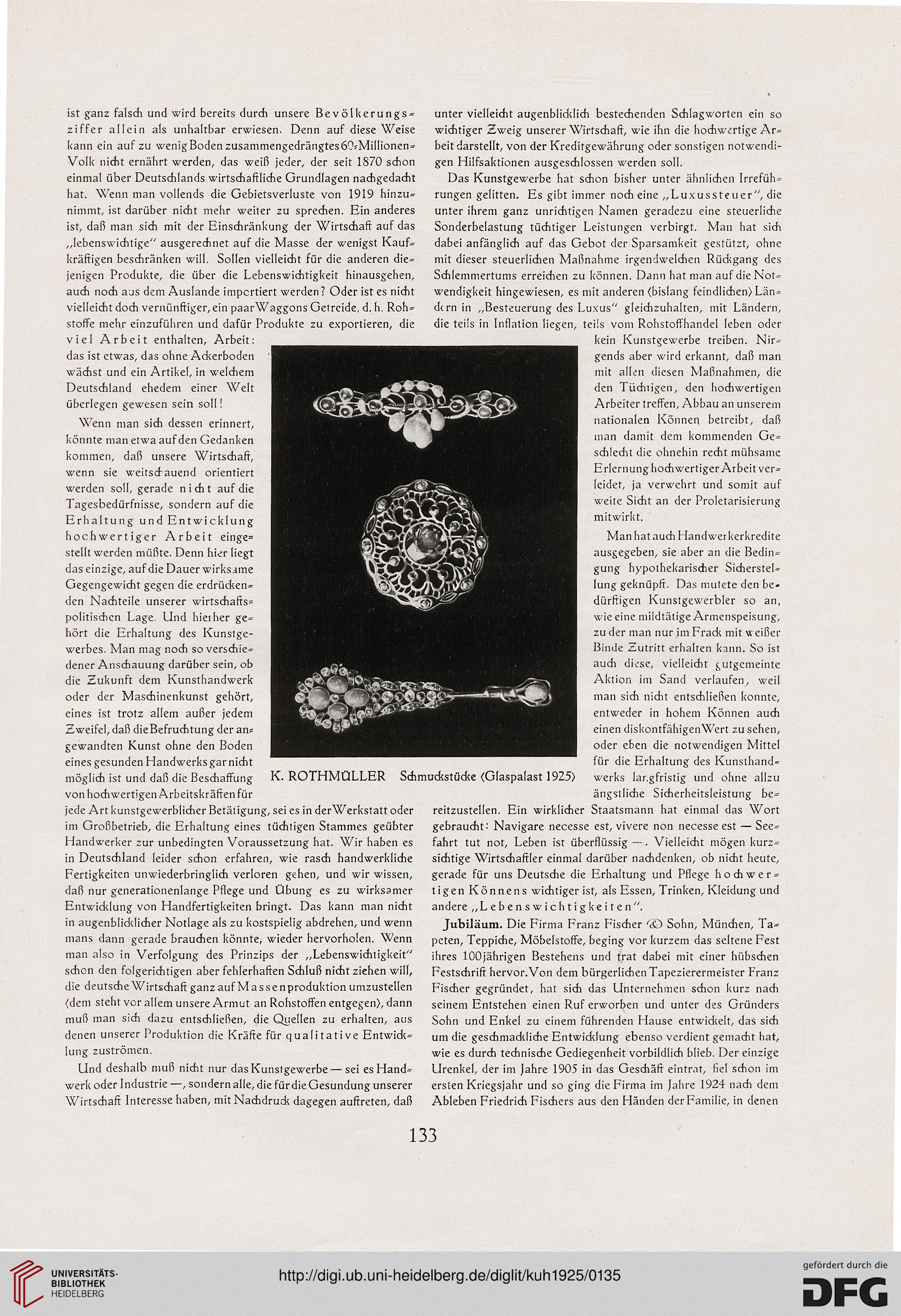ist ganz falsch und wird bereits durch unsere Bevölkerungs»
ziffer allein als unhaltbar erwiesen. Denn auf diese Weise
kann ein auf zu wenig Boden zusammengedrängtes 60;MiIlionen»
Volk nicht ernährt werden, das weiß jeder, der seit 1870 schon
einmal über Deutschlands wirtschaftliche Grundlagen nachgedacht
hat. Wenn man vollends die Gebietsverluste von 1919 hinzu»
nimmt, ist darüber nicht mehr weiter zu sprechen. Ein anderes
ist, daß man sich mit der Einschränkung der Wirtschaft auf das
„lebenswichtige" ausgerechnet auf die Masse der wenigst Kauf»
kräftigen beschränken will. Sollen vielleicht für die anderen die«
jenigen Produkte, die über die Lebenswichtigkeit hinausgehen,
auch noch aus dem Auslande importiert werden? Oder ist es nicht
vielleicht doch vernünftiger, ein paarWaggons Getreide, d. h. Roh»
Stoffe mehr einzuführen und dafür Produkte zu exportieren, die
viel Arbeit enthalten, Arbeit: _
das ist etwas, das ohne Ackerboden
wächst und ein Artikel, in welchem
Deutschland ehedem einer Welt
überlegen gewesen sein soll!
Wenn man sich dessen erinnert,
könnte man etwa auf den Gedanken
kommen, daß unsere Wirtschaft,
wenn sie weitschauend orientiert
werden soll, gerade nicht auf die
Tagesbedürfnisse, sondern auf die
Erhaltung und Entwicklung
hochwertiger Arbeit einge-
stellt werden müßte. Denn hier liegt
das einzige, auf die Dauer wirksame
Gegengewicht gegen die erdrücken»
den Nachteile unserer wirtschafts»
politischen Lage. Und hieiher ge»
hört die Erhaltung des Kunstge-
werbes. Man mag noch so verschie»
dener Anschauung darüber sein, ob
die Zukunft dem Kunsthandwerk
oder der Maschinenkunst gehört,
eines ist trotz allem außer jedem
Zweifel, daß dieBefruchtung der ans
gewandten Kunst ohne den Boden
eines gesunden Handwerks gar nicht
möglich ist und daß die Beschaffung
von hochwertigen Arbeitskräften für
jede Art kunstgewerblicher Betätigung, sei es in derWerkstatt oder
im Großbetrieb, die Erhaltung eines tüchtigen Stammes geübter
Handwerker zur unbedingten Voraussetzung hat. Wir haben es
in Deutschland leider schon erfahren, wie rasch handwerkliche
Fertigkeiten unwiederbringlich verloren gehen, und wir wissen,
daß nur generationenlange Pflege und Übung es zu wirksamer
Entwicklung von Handfertigkeiten bringt. Das kann man nicht
in augenblicklicher Notlage als zu kostspielig abdrehen, und wenn
mans dann gerade brauchen könnte, wieder hervorholen. Wenn
man also in Verfolgung des Prinzips der „Lebenswichtigkeit"
schon den folgerichtigen aber fehlerhaften Schluß nicht ziehen will,
die deutsche Wirtschaft ganz auf Massenproduktion umzustellen
(dem steht vor allem unsere Armut an Rohstoffen entgegen), dann
muß man sich dazu entschließen, die Quellen zu erhalten, aus
denen unserer Produktion die Kräfte für qualitative Entwidc»
lung zuströmen.
Und deshalb muß nicht nur das Kunstgewerbe — sei es Hand»
werk oder Industrie —, sondern alle, die fürdie Gesundung unserer
Wirtschaft Interesse haben, mit Nachdruck dagegen auftreten, daß
K. ROTHMÜLLER Schmuckstücke (Glaspalast 1925)
unter vielleicht augenbliddich bestechenden Schlagworten ein so
wichtiger Zweig unserer Wirtschaft, wie ihn die hochwertige Ar»
beit darstellt, von der Kreditgewährung oder sonstigen notwendi-
gen Hilfsaktionen ausgeschlossen werden soll.
Das Kunstgewerbe hat schon bisher unter ähnlichen Irrefüh»
rungen gelitten. Es gibt immer noch eine „Luxussteuer", die
unter ihrem ganz unrichtigen Namen geradezu eine steuerliche
Sonderbelastung tüchtiger Leistungen verbirgt. Man hat sich
dabei anfänglich auf das Gebot der Sparsamkeit gestützt, ohne
mit dieser steuerlichen Maßnahme irgendwelchen Rüdegang des
Schlemmertums erreichen zu können. Dann hat man auf die Not»
wendigkeit hingewiesen, es mit anderen (bislang feindlichen) Län«
dernin „Besteuerung des Luxus" gleichzuhalten, mit Ländern,
die teils in Inflation liegen, teils vom Rohstoffhandel leben oder
kein Kunstgewerbe treiben. Nir»
gends aber wird erkannt, daß man
mit allen diesen Maßnahmen, die
den Tüchtigen, den hochwertigen
Arbeiter treffen, Abbau an unserem
nationalen Können betreibt, daß
man damit dem kommenden Ge»
schledu die ohnehin recht mühsame
Erlernung hoch wertiger Arbeit ver»
leidet, ja verwehrt und somit auf
weite Sicht an der Proletarisierung
mitwirkt.
Man hat auch Handwerkerkredite
ausgegeben, sie aber an die Bedin»
gung hypothekarischer Sicherstel»
lung geknüpft. Das mutete den be-
dürftigen Kunstgewerbler so an,
wie eine mildtätige Armenspeisung,
zu der man nur im Fradc mit weißer
Binde Zutritt erhalten kann. So ist
auch diese, vielleicht gutgemeinte
Aktion im Sand verlaufen, weil
man sich nicht entschließen konnte,
entweder in hohem Können auch
einen diskontfähigenWert zu sehen,
oder eben die notwendigen Mittel
für die Erhaltung des Kunsthand»
werks langfristig und ohne allzu
ängstliche Sicherheitsleistung be»
reitzustellen. Ein wirklicher Staatsmann hat einmal das Wort
gebraucht: Navigare necesse est, vivere non necesse est — See»
fahrt tut not, Leben ist überflüssig —. Vielleicht mögen kurz»
sichtige Wirtschaftler einmal darüber nachdenken, ob nicht heute,
gerade für uns Deutsche die Erhaltung und Pflege hoch wer»
tigen Könnens wichtiger ist, als Essen, Trinken, Kleidung und
andere „Lebenswichtigkeiten".
Jubiläum. Die Firma Franz Fischer '£> Sohn, München, Ta-
peten, Teppiche, Möbelstoffe, beging vor kurzem das seltene Fest
ihres 100jährigen Bestehens und trat dabei mit einer hübschen
Festschrift hervor. Von dem bürgerlichen Tapezierermeister Franz
Fischer gegründet, hat sich das Unternehmen schon kurz nach
seinem Entstehen einen Ruf erworben und unter des Gründers
Sohn und Enkel zu einem führenden Hause entwickelt, das sich
um die geschmaddiche Entwiddung ebenso verdient gemacht hat,
wie es durch technische Gediegenheit vorbildlich blieb. Der einzige
Urenkel, der im Jahre 1905 in das Geschäft eintrat, fiel schon im
ersten Kriegsjahr und so ging die Firma im Jahre 1924 nach dem
Ableben Friedrich Fischers aus den Händen der Familie, in denen
133
ziffer allein als unhaltbar erwiesen. Denn auf diese Weise
kann ein auf zu wenig Boden zusammengedrängtes 60;MiIlionen»
Volk nicht ernährt werden, das weiß jeder, der seit 1870 schon
einmal über Deutschlands wirtschaftliche Grundlagen nachgedacht
hat. Wenn man vollends die Gebietsverluste von 1919 hinzu»
nimmt, ist darüber nicht mehr weiter zu sprechen. Ein anderes
ist, daß man sich mit der Einschränkung der Wirtschaft auf das
„lebenswichtige" ausgerechnet auf die Masse der wenigst Kauf»
kräftigen beschränken will. Sollen vielleicht für die anderen die«
jenigen Produkte, die über die Lebenswichtigkeit hinausgehen,
auch noch aus dem Auslande importiert werden? Oder ist es nicht
vielleicht doch vernünftiger, ein paarWaggons Getreide, d. h. Roh»
Stoffe mehr einzuführen und dafür Produkte zu exportieren, die
viel Arbeit enthalten, Arbeit: _
das ist etwas, das ohne Ackerboden
wächst und ein Artikel, in welchem
Deutschland ehedem einer Welt
überlegen gewesen sein soll!
Wenn man sich dessen erinnert,
könnte man etwa auf den Gedanken
kommen, daß unsere Wirtschaft,
wenn sie weitschauend orientiert
werden soll, gerade nicht auf die
Tagesbedürfnisse, sondern auf die
Erhaltung und Entwicklung
hochwertiger Arbeit einge-
stellt werden müßte. Denn hier liegt
das einzige, auf die Dauer wirksame
Gegengewicht gegen die erdrücken»
den Nachteile unserer wirtschafts»
politischen Lage. Und hieiher ge»
hört die Erhaltung des Kunstge-
werbes. Man mag noch so verschie»
dener Anschauung darüber sein, ob
die Zukunft dem Kunsthandwerk
oder der Maschinenkunst gehört,
eines ist trotz allem außer jedem
Zweifel, daß dieBefruchtung der ans
gewandten Kunst ohne den Boden
eines gesunden Handwerks gar nicht
möglich ist und daß die Beschaffung
von hochwertigen Arbeitskräften für
jede Art kunstgewerblicher Betätigung, sei es in derWerkstatt oder
im Großbetrieb, die Erhaltung eines tüchtigen Stammes geübter
Handwerker zur unbedingten Voraussetzung hat. Wir haben es
in Deutschland leider schon erfahren, wie rasch handwerkliche
Fertigkeiten unwiederbringlich verloren gehen, und wir wissen,
daß nur generationenlange Pflege und Übung es zu wirksamer
Entwicklung von Handfertigkeiten bringt. Das kann man nicht
in augenblicklicher Notlage als zu kostspielig abdrehen, und wenn
mans dann gerade brauchen könnte, wieder hervorholen. Wenn
man also in Verfolgung des Prinzips der „Lebenswichtigkeit"
schon den folgerichtigen aber fehlerhaften Schluß nicht ziehen will,
die deutsche Wirtschaft ganz auf Massenproduktion umzustellen
(dem steht vor allem unsere Armut an Rohstoffen entgegen), dann
muß man sich dazu entschließen, die Quellen zu erhalten, aus
denen unserer Produktion die Kräfte für qualitative Entwidc»
lung zuströmen.
Und deshalb muß nicht nur das Kunstgewerbe — sei es Hand»
werk oder Industrie —, sondern alle, die fürdie Gesundung unserer
Wirtschaft Interesse haben, mit Nachdruck dagegen auftreten, daß
K. ROTHMÜLLER Schmuckstücke (Glaspalast 1925)
unter vielleicht augenbliddich bestechenden Schlagworten ein so
wichtiger Zweig unserer Wirtschaft, wie ihn die hochwertige Ar»
beit darstellt, von der Kreditgewährung oder sonstigen notwendi-
gen Hilfsaktionen ausgeschlossen werden soll.
Das Kunstgewerbe hat schon bisher unter ähnlichen Irrefüh»
rungen gelitten. Es gibt immer noch eine „Luxussteuer", die
unter ihrem ganz unrichtigen Namen geradezu eine steuerliche
Sonderbelastung tüchtiger Leistungen verbirgt. Man hat sich
dabei anfänglich auf das Gebot der Sparsamkeit gestützt, ohne
mit dieser steuerlichen Maßnahme irgendwelchen Rüdegang des
Schlemmertums erreichen zu können. Dann hat man auf die Not»
wendigkeit hingewiesen, es mit anderen (bislang feindlichen) Län«
dernin „Besteuerung des Luxus" gleichzuhalten, mit Ländern,
die teils in Inflation liegen, teils vom Rohstoffhandel leben oder
kein Kunstgewerbe treiben. Nir»
gends aber wird erkannt, daß man
mit allen diesen Maßnahmen, die
den Tüchtigen, den hochwertigen
Arbeiter treffen, Abbau an unserem
nationalen Können betreibt, daß
man damit dem kommenden Ge»
schledu die ohnehin recht mühsame
Erlernung hoch wertiger Arbeit ver»
leidet, ja verwehrt und somit auf
weite Sicht an der Proletarisierung
mitwirkt.
Man hat auch Handwerkerkredite
ausgegeben, sie aber an die Bedin»
gung hypothekarischer Sicherstel»
lung geknüpft. Das mutete den be-
dürftigen Kunstgewerbler so an,
wie eine mildtätige Armenspeisung,
zu der man nur im Fradc mit weißer
Binde Zutritt erhalten kann. So ist
auch diese, vielleicht gutgemeinte
Aktion im Sand verlaufen, weil
man sich nicht entschließen konnte,
entweder in hohem Können auch
einen diskontfähigenWert zu sehen,
oder eben die notwendigen Mittel
für die Erhaltung des Kunsthand»
werks langfristig und ohne allzu
ängstliche Sicherheitsleistung be»
reitzustellen. Ein wirklicher Staatsmann hat einmal das Wort
gebraucht: Navigare necesse est, vivere non necesse est — See»
fahrt tut not, Leben ist überflüssig —. Vielleicht mögen kurz»
sichtige Wirtschaftler einmal darüber nachdenken, ob nicht heute,
gerade für uns Deutsche die Erhaltung und Pflege hoch wer»
tigen Könnens wichtiger ist, als Essen, Trinken, Kleidung und
andere „Lebenswichtigkeiten".
Jubiläum. Die Firma Franz Fischer '£> Sohn, München, Ta-
peten, Teppiche, Möbelstoffe, beging vor kurzem das seltene Fest
ihres 100jährigen Bestehens und trat dabei mit einer hübschen
Festschrift hervor. Von dem bürgerlichen Tapezierermeister Franz
Fischer gegründet, hat sich das Unternehmen schon kurz nach
seinem Entstehen einen Ruf erworben und unter des Gründers
Sohn und Enkel zu einem führenden Hause entwickelt, das sich
um die geschmaddiche Entwiddung ebenso verdient gemacht hat,
wie es durch technische Gediegenheit vorbildlich blieb. Der einzige
Urenkel, der im Jahre 1905 in das Geschäft eintrat, fiel schon im
ersten Kriegsjahr und so ging die Firma im Jahre 1924 nach dem
Ableben Friedrich Fischers aus den Händen der Familie, in denen
133