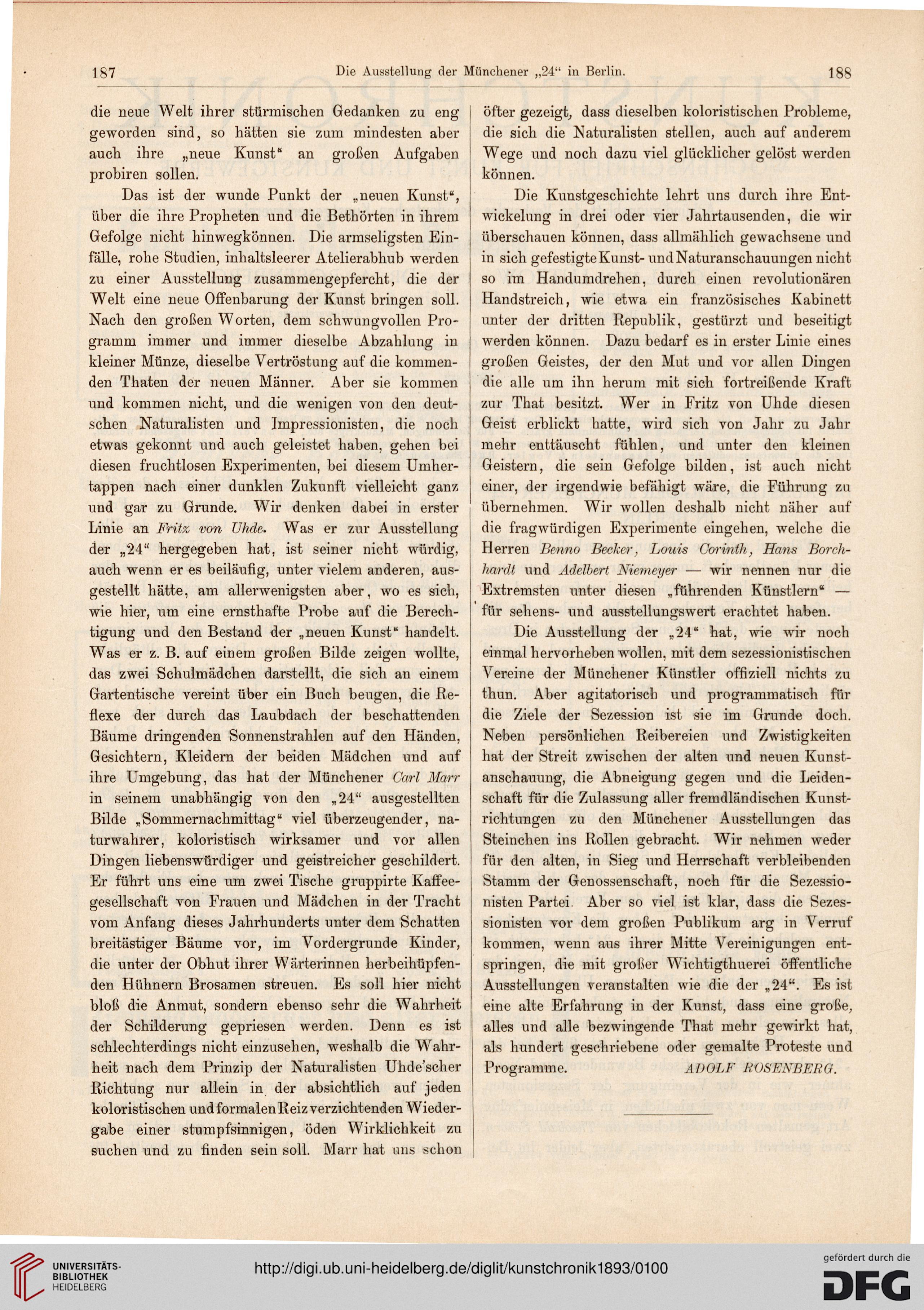die neue Welt ihrer stürmischen Gedanken zu eng
geworden sind, so hätten sie zum mindesten aber
auch ihre „neue Kunst* an großen Aufgaben
probiren sollen.
Das ist der wunde Punkt der „neuen Kunst',
über die ihre Propheten und die Bethörten in ihrem
Gefolge nicht hinwegkönnen. Die armseligsten Ein-
fälle, rohe Studien, inhaltsleerer Atelierabhub werden
zu einer Ausstellung zusammengepfercht, die der
Welt eine neue Offenbarung der Kunst bringen soll.
Nach den großen Worten, dem schwungvollen Pro-
gramm immer und immer dieselbe Abzahlung in
kleiner Münze, dieselbe Vertröstung auf die kommen-
den Thaten der neuen Männer. Aber sie kommen
und kommen nicht, und die wenigen von den deut-
schen Naturalisten und Impressionisten, die noch
etwas gekonnt und auch geleistet haben, gehen bei
diesen fruchtlosen Experimenten, bei diesem Umher-
tappen nach einer dunklen Zukunft vielleicht ganz
und gar zu Grunde. Wir denken dabei in erster
Linie an Fritz von Uhde. Was er zur Ausstellung
der „24" hergegeben hat, ist seiner nicht würdig,
auch wenn er es beiläufig, unter vielem anderen, aus-
gestellt hätte, am allerwenigsten aber, wo es sich,
wie hier, um eine ernsthafte Probe auf die Berech-
tigung und den Bestand der „neuen Kunst" handelt.
Was er z. B. auf einem großen Bilde zeigen wollte,
das zwei Schulmädchen darstellt, die sich an einem
Gartentische vereint über ein Buch beugen, die Re-
flexe der durch das Laubdach der beschattenden
Bäume dringenden Sonnenstrahlen auf den Händen,
Gesichtern, Kleidern der beiden Mädchen und auf
ihre Umgebung, das hat der Münchener Carl Marr
in seinem unabhängig von den „24" ausgestellten
Bilde „Sommernachmittag" viel überzeugender, na-
turwahrer, koloristisch wirksamer und vor allen
Dingen liebenswürdiger und geistreicher geschildert.
Er führt uns eine um zwei Tische gruppirte Kaffee-
gesellschaft von Frauen und Mädchen in der Tracht
vom Anfang dieses Jahrhunderts unter dem Schatten
breitästiger Bäume vor, im Vordergrunde Kinder,
die unter der Obhut ihrer Wärterinnen herbeihüpfen-
den Hühnern Brosamen streuen. Es soll hier nicht
bloß die Anmut, sondern ebenso sehr die Wahrheit
der Schilderung gepriesen werden. Denn es ist
schlechterdings nicht einzusehen, weshalb die Wahr-
heit nach dem Prinzip der Naturalisten Uhde'scher
Richtung nur allein in der absichtlich auf jeden
koloristischen und formalen Reiz verzichtenden Wieder-
gabe einer stumpfsinnigen, öden Wirklichkeit zu
suchen und zu finden sein soll. Marr hat uns schon
öfter gezeigt, dass dieselben koloristischen Probleme,
die sich die Naturalisten stellen, auch auf anderem
Wege und noch dazu viel glücklicher gelöst werden
können.
Die Kunstgeschichte lehrt uns durch ihre Ent-
wickelung in drei oder vier Jahrtausenden, die wir
überschauen können, dass allmählich gewachsene und
in sich gefestigteKunst- und Naturanschauungen nicht
so im Handumdrehen, durch einen revolutionären
Handstreich, wie etwa ein französisches Kabinett
unter der dritten Republik, gestürzt und beseitigt
werden können. Dazu bedarf es in erster Linie eines
großen Geistes, der den Mut und vor allen Dingen
die alle um ihn herum mit sich fortreißende Kraft
zur That besitzt. Wer in Fritz von Uhde diesen
Geist erblickt hatte, wird sich von Jahr zu Jahr
mehr enttäuscht fühlen, und unter den kleinen
Geistern, die sein Gefolge bilden, ist auch nicht
einer, der irgendwie befähigt wäre, die Führung zu
übernehmen. Wir wollen deshalb nicht näher auf
die fragwürdigen Experimente eingehen, welche die
Herren Benno Becker, Louis Gorinth, Hans Borch-
hardt und Adelbert Niemeyer — wir nennen nur die
Extremsten unter diesen „führenden Künstlern" —
für sehens- und ausstellungswert erachtet haben.
Die Ausstellung der „24" hat, wie wir noch
einmal hervorheben wollen, mit dem sezessionistischen
Vereine der Münchener Künstler offiziell nichts zu
thun. Aber agitatorisch und programmatisch für
die Ziele der Sezession ist sie im Grunde doch.
Neben persönlichen Reibereien und Zwistigkeiten
hat der Streit zwischen der alten und neuen Kunst-
anschauung, die Abneigung gegen und die Leiden-
schaft für die Zulassung aller fremdländischen Kunst-
richtungen zu den Münchener Ausstellungen das
Steinchen ins Rollen gebracht. Wir nehmen weder
für den alten, in Sieg und Herrschaft verbleibenden
Stamm der Genossenschaft, noch für die Sezessio-
nisten Partei. Aber so viel ist klar, dass die Sezes-
sionisten vor dem großen Publikum arg in Verruf
kommen, wenn aus ihrer Mitte Vereinigungen ent-
springen, die mit großer Wichtigthuerei öffentliche
Ausstellungen veranstalten wie die der „24". Es ist
eine alte Erfahrung in der Kunst, dass eine große,
alles und alle bezwingende That mehr gewirkt hat,
als hundert geschriebene oder gemalte Proteste und
Programme. ADOLF ROSENBERG.
geworden sind, so hätten sie zum mindesten aber
auch ihre „neue Kunst* an großen Aufgaben
probiren sollen.
Das ist der wunde Punkt der „neuen Kunst',
über die ihre Propheten und die Bethörten in ihrem
Gefolge nicht hinwegkönnen. Die armseligsten Ein-
fälle, rohe Studien, inhaltsleerer Atelierabhub werden
zu einer Ausstellung zusammengepfercht, die der
Welt eine neue Offenbarung der Kunst bringen soll.
Nach den großen Worten, dem schwungvollen Pro-
gramm immer und immer dieselbe Abzahlung in
kleiner Münze, dieselbe Vertröstung auf die kommen-
den Thaten der neuen Männer. Aber sie kommen
und kommen nicht, und die wenigen von den deut-
schen Naturalisten und Impressionisten, die noch
etwas gekonnt und auch geleistet haben, gehen bei
diesen fruchtlosen Experimenten, bei diesem Umher-
tappen nach einer dunklen Zukunft vielleicht ganz
und gar zu Grunde. Wir denken dabei in erster
Linie an Fritz von Uhde. Was er zur Ausstellung
der „24" hergegeben hat, ist seiner nicht würdig,
auch wenn er es beiläufig, unter vielem anderen, aus-
gestellt hätte, am allerwenigsten aber, wo es sich,
wie hier, um eine ernsthafte Probe auf die Berech-
tigung und den Bestand der „neuen Kunst" handelt.
Was er z. B. auf einem großen Bilde zeigen wollte,
das zwei Schulmädchen darstellt, die sich an einem
Gartentische vereint über ein Buch beugen, die Re-
flexe der durch das Laubdach der beschattenden
Bäume dringenden Sonnenstrahlen auf den Händen,
Gesichtern, Kleidern der beiden Mädchen und auf
ihre Umgebung, das hat der Münchener Carl Marr
in seinem unabhängig von den „24" ausgestellten
Bilde „Sommernachmittag" viel überzeugender, na-
turwahrer, koloristisch wirksamer und vor allen
Dingen liebenswürdiger und geistreicher geschildert.
Er führt uns eine um zwei Tische gruppirte Kaffee-
gesellschaft von Frauen und Mädchen in der Tracht
vom Anfang dieses Jahrhunderts unter dem Schatten
breitästiger Bäume vor, im Vordergrunde Kinder,
die unter der Obhut ihrer Wärterinnen herbeihüpfen-
den Hühnern Brosamen streuen. Es soll hier nicht
bloß die Anmut, sondern ebenso sehr die Wahrheit
der Schilderung gepriesen werden. Denn es ist
schlechterdings nicht einzusehen, weshalb die Wahr-
heit nach dem Prinzip der Naturalisten Uhde'scher
Richtung nur allein in der absichtlich auf jeden
koloristischen und formalen Reiz verzichtenden Wieder-
gabe einer stumpfsinnigen, öden Wirklichkeit zu
suchen und zu finden sein soll. Marr hat uns schon
öfter gezeigt, dass dieselben koloristischen Probleme,
die sich die Naturalisten stellen, auch auf anderem
Wege und noch dazu viel glücklicher gelöst werden
können.
Die Kunstgeschichte lehrt uns durch ihre Ent-
wickelung in drei oder vier Jahrtausenden, die wir
überschauen können, dass allmählich gewachsene und
in sich gefestigteKunst- und Naturanschauungen nicht
so im Handumdrehen, durch einen revolutionären
Handstreich, wie etwa ein französisches Kabinett
unter der dritten Republik, gestürzt und beseitigt
werden können. Dazu bedarf es in erster Linie eines
großen Geistes, der den Mut und vor allen Dingen
die alle um ihn herum mit sich fortreißende Kraft
zur That besitzt. Wer in Fritz von Uhde diesen
Geist erblickt hatte, wird sich von Jahr zu Jahr
mehr enttäuscht fühlen, und unter den kleinen
Geistern, die sein Gefolge bilden, ist auch nicht
einer, der irgendwie befähigt wäre, die Führung zu
übernehmen. Wir wollen deshalb nicht näher auf
die fragwürdigen Experimente eingehen, welche die
Herren Benno Becker, Louis Gorinth, Hans Borch-
hardt und Adelbert Niemeyer — wir nennen nur die
Extremsten unter diesen „führenden Künstlern" —
für sehens- und ausstellungswert erachtet haben.
Die Ausstellung der „24" hat, wie wir noch
einmal hervorheben wollen, mit dem sezessionistischen
Vereine der Münchener Künstler offiziell nichts zu
thun. Aber agitatorisch und programmatisch für
die Ziele der Sezession ist sie im Grunde doch.
Neben persönlichen Reibereien und Zwistigkeiten
hat der Streit zwischen der alten und neuen Kunst-
anschauung, die Abneigung gegen und die Leiden-
schaft für die Zulassung aller fremdländischen Kunst-
richtungen zu den Münchener Ausstellungen das
Steinchen ins Rollen gebracht. Wir nehmen weder
für den alten, in Sieg und Herrschaft verbleibenden
Stamm der Genossenschaft, noch für die Sezessio-
nisten Partei. Aber so viel ist klar, dass die Sezes-
sionisten vor dem großen Publikum arg in Verruf
kommen, wenn aus ihrer Mitte Vereinigungen ent-
springen, die mit großer Wichtigthuerei öffentliche
Ausstellungen veranstalten wie die der „24". Es ist
eine alte Erfahrung in der Kunst, dass eine große,
alles und alle bezwingende That mehr gewirkt hat,
als hundert geschriebene oder gemalte Proteste und
Programme. ADOLF ROSENBERG.