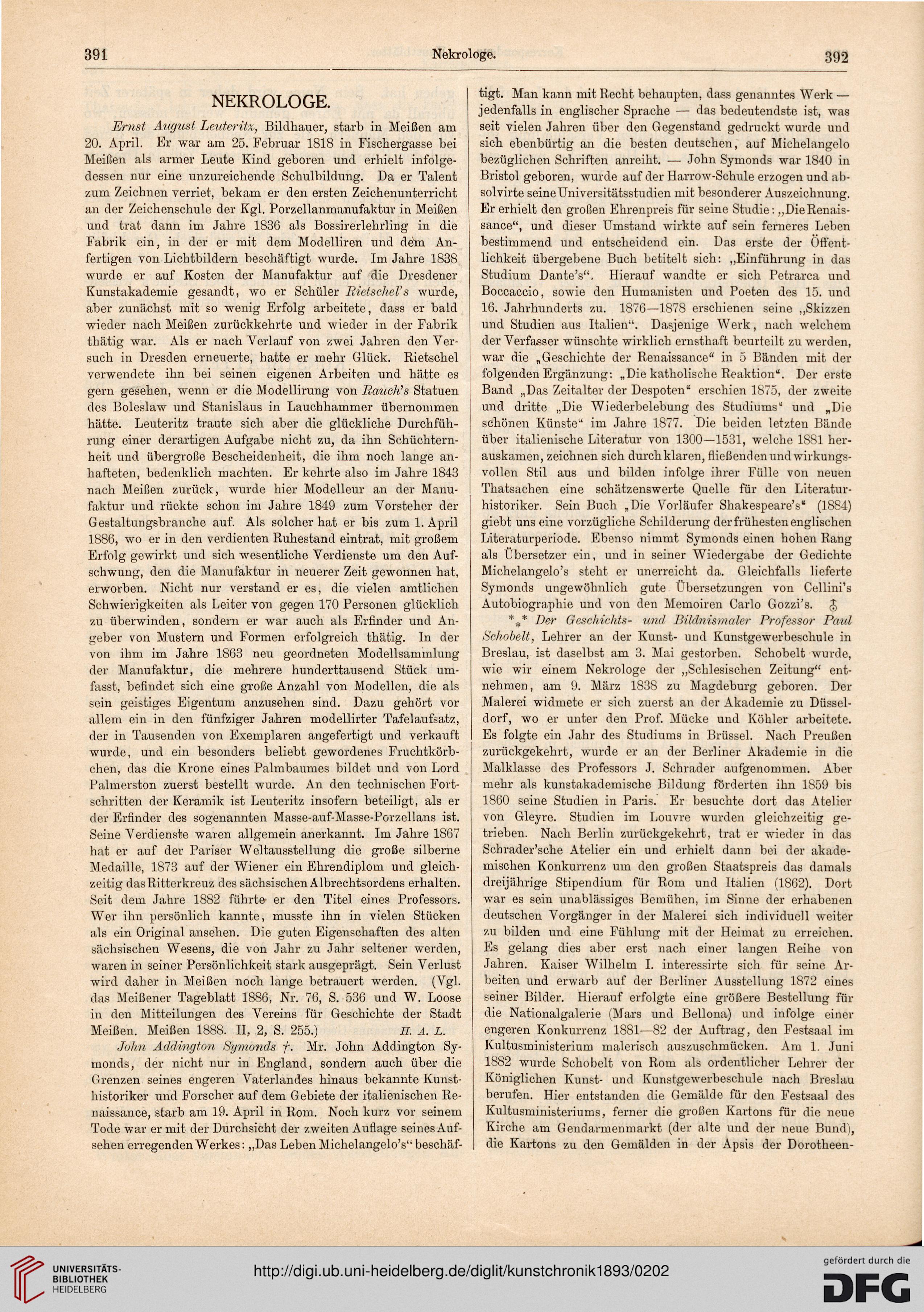391
Nekrologe.
392
NEKROLOGE.
Ernst August Leuterüx, Bildhauer, starb in Meißen am
20. April. Er war am 25. Februar 1818 in Fischergasse bei
Meiden als armer Leute Kind geboren und erhielt infolge-
dessen nur eine unzureichende Schulbildung. Da er Talent
zum Zeichnen verriet, bekam er den ersten Zeichenunterricht
an der Zeichenschule der Kgl. Porzellanmanufaktur in Meißen
und trat dann im Jahre 1836 als Bossirerlehrling in die
Fabrik ein, in der er mit dem Modelliren und de'm An-
fertigen von Lichtbildern beschäftigt wurde. Im Jahre 1838
wurde er auf Kosten der Manufaktur auf die Dresdener
Kunstakademie gesandt, wo er Schüler Rictschcl's wurde,
aber zunächst mit so wenig Erfolg arbeitete, dass er bald
wieder nach Meißen zurückkehrte und wieder in der Fabrik
thätig war. Als er nach Verlauf von zwei Jahren den Ver-
such in Dresden erneuerte, hatte er mehr Glück. Rietschel
verwendete ihn bei seinen eigenen Arbeiten und hätte es
gern gesehen, wenn er die Modellirung von Bwueh's Statuen
des Boleslaw und Stanislaus in Lauchhammer übernommen
hätte. Leuteritz traute sich aber die glückliche Durchfüh-
rung einer derartigen Aufgabe nicht zu, da ihn Schüchtern-
heit und übergroße Bescheidenheit, die ihm noch lange an-
hafteten, bedenklich machten. Er kehrte also im Jahre 1843
nach Meißen zurück, wurde hier Modelleur an der Manu-
faktur und rückte schon im Jahre 1849 zum Vorsteher der
Gestaltungsbranche auf. Als solcher hat er bis zum 1. April
1886, wo er in den verdienten Ruhestand eintrat, mit großem
Erfolg gewirkt und sich wesentliche Verdienste um den Auf-
schwung, den die Manufaktur in neuerer Zeit gewonnen hat,
erworben. Nicht nur verstand er es, die vielen amtlichen
Schwierigkeiten als Leiter von gegen 170 Personen glücklich
zu überwinden, sondern er war auch als Erfinder und An-
geber von Mustern und Formen erfolgreich thätig. In der
von ihm im Jahre 1863 neu geordneten Modellsammlung
der Manufaktur, die mehrere hunderttausend Stück um-
fasst, befindet sich eine große Anzahl von Modellen, die als
sein geistiges Eigentum anzusehen sind. Dazu gehört vor
allem ein in den fünfziger Jahren modellirter Tafelaufsatz,
der in Tausenden von Exemplaren angefertigt und verkauft
wurde, und ein besonders beliebt gewordenes Fruchtkörb-
chen, das die Krone eines Palmbaumes bildet und von Lord
Palmerston zuerst bestellt wurde. An den technischen Fort-
schritten der Keramik ist Leuteritz insofern beteiligt, als er
der Erfinder des sogenannten Masse-auf-Masse-Porzellans ist.
Seine Verdienste waren allgemein anerkannt. Im Jahre 1867
hat er auf der Pariser Weltausstellung die große silberne
Medaille, 1873 auf der Wiener ein Ehrendiplom und gleich-
zeitig das Ritterkreuz des sächsischen Albrechtsordens erhalten.
Seit dem Jahre 1882 führte er den Titel eines Professors.
Wer ihn persönlich kannte, musste ihn in vielen Stücken
als ein Original ansehen. Die guten Eigenschaften des alten
sächsischen Wesens, die von Jahr zu Jahr seltener werden,
waren in seiner Persönlichkeit stark ausgeprägt. Sein Verlust
wird daher in Meißen noch lange betrauert werden. (Vgl.
das Meißener Tageblatt 1886, Nr. 76, S. 536 und W. Loose
in den Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt
Meißen. Meißen 1888. H, 2, S. 255.) B: A. L.
John Addington Symonds f. Mr. John Addington Sy-
monds, der nicht nur in England, sondern auch über die
Grenzen seines engeren Vaterlandes hinaus bekannte Kunst-
historiker und Forscher auf dem Gebiete der italienischen Re-
naissance, starb am 19. April in Rom. Noch kurz vor seinem
Tode war er mit der Durchsicht der zweiten Auflage seines Auf-
sehen erregenden Werkes: „Das Leben Michelangelo's" beschäf-
tigt. Man kann mit Recht behaupten, dass genanntes Werk —
jedenfalls in englischer Sprache — das bedeutendste ist, was
seit vielen Jahren über den Gegenstand gedruckt wurde und
sich ebenbürtig an die besten deutschen, auf Michelangelo
bezüglichen Schriften anreiht. — John Symonds war 1840 in
Bristol geboren, wurde auf der Harrow-Schule erzogen und ab-
solvirte seine Universitätsstudien mit besonderer Auszeichnung.
Er erhielt den großen Ehrenpreis für seine Studie: „DieRenais-
sance", und dieser Umstand wirkte auf sein ferneres Leben
bestimmend und entscheidend ein. Das erste der Öffent-
lichkeit übergebene Buch betitelt sich: „Einführung in das
Studium Dante's". Hierauf wandte er sich Petrarca und
Boccaccio, sowie den Humanisten und Poeten des 15. und
16. Jahrhunderts zu. 1876—1878 erschienen seine „Skizzen
und Studien aus Italien". Dasjenige Werk, nach welchem
der Verfasser wünschte wirklich ernsthaft beurteilt zu werden,
war die „Geschichte der Renaissance" in 5 Bänden mit der
folgenden Ergänzung: „Die katholische Reaktion". Der erste
Band „Das Zeitalter der Despoten" erschien 1875, der zweite
und dritte „Die Wiederbelebung des Studiums" und „Die
schönen Künste" im Jahre 1877. Die beiden letzten Bände
über italienische Literatur von 1300—1531, welche 1881 her-
auskamen, zeichnen sich durch klaren, fließenden und wirkungs-
vollen Stil aus und bilden infolge ihrer Fülle von neuen
Thatsachen eine schätzenswerte Quelle für den Literatur-
historiker. Sein Buch „Die Voi-läufer Shakespeare's" (1884)
giebt uns eine vorzügliche Schilderung der frühesten englischen
Literaturperiode. Ebenso nimmt Symonds einen hohen Rang
als Ubersetzer ein, und in seiner Wiedergabe der Gedichte
Michelangelo's steht er unerreicht da. Gleichfalls lieferte
Symonds ungewöhnlich gute Übersetzungen von Cellini's
Autobiographie und von den Memoiren Carlo Gozzi's. <$
%* Der Oeschickts- und Bildnis Dinier Professor Paul
Sekobelt, Lehrer an der Kunst- und Kunstgewerbeschule in
Breslau, ist daselbst am 3. Mai gestorben. Schobelt wurde,
wie wir einem Nekrologe der „Schlesischen Zeitung" ent-
nehmen, am 9. März 1838 zu Magdeburg geboren. Der
Malerei widmete er sich zuerst an der Akademie zu Düssel-
dorf, wo er unter den Prof. Mücke und Köhler arbeitete.
Es folgte ein Jahr des Studiums in Brüssel. Nach Preußen
zurückgekehrt, wurde er an der Berliner Akademie in die
Malklasse des Professors J. Schräder aufgenommen. Aber
mehr als kunstakademische Bildung förderten ihn 1859 bis
1860 seine Studien in Paris. Er besuchte dort das Atelier
von Gleyre. Studien im Louvre wurden gleichzeitig ge-
trieben. Nach Berlin zurückgekehrt, trat er wieder in das
Schrader'sche Atelier ein und erhielt dann bei der akade-
mischen Konkurrenz um den großen Staatspreis das damals
dreijährige Stipendium für Rom und Italien (1862). Dort
war es sein unablässiges Bemühen, im Sinne der erhabenen
deutschen Vorgänger in der Malerei sich individuell weiter
zu bilden und eine Fühlung mit der Heimat zu erreichen.
Es gelang dies aber erst nach einer langen Reihe von
Jahren. Kaiser Wilhelm I. interessirte sich für seine Ar-
beiten und erwarb auf der Berliner Ausstellung 1872 eines
seiner Bilder. Hierauf erfolgte eine größere Bestellung für
die Nationalgalerie (Mars und Bellona) und infolge einer
engeren Konkurrenz 1881—82 der Auftrag, den Festsaal im
Kultusministerium malerisch auszuschmücken. Am 1. Juni
1882 wurde Schobelt von Rom als ordentlicher Lehrer der
Königlichen Kunst- und Kunstgewerbeschule nach Breslau
berufen. Hier entstanden die Gemälde für den Festsaal des
Kultusministeriums, ferner die großen Kartons für die neue
Kirche am Gendarmenmarkt (der alte und der neue Bund),
die Kartons zu den Gemälden in der Apsis der Dorotheen-
Nekrologe.
392
NEKROLOGE.
Ernst August Leuterüx, Bildhauer, starb in Meißen am
20. April. Er war am 25. Februar 1818 in Fischergasse bei
Meiden als armer Leute Kind geboren und erhielt infolge-
dessen nur eine unzureichende Schulbildung. Da er Talent
zum Zeichnen verriet, bekam er den ersten Zeichenunterricht
an der Zeichenschule der Kgl. Porzellanmanufaktur in Meißen
und trat dann im Jahre 1836 als Bossirerlehrling in die
Fabrik ein, in der er mit dem Modelliren und de'm An-
fertigen von Lichtbildern beschäftigt wurde. Im Jahre 1838
wurde er auf Kosten der Manufaktur auf die Dresdener
Kunstakademie gesandt, wo er Schüler Rictschcl's wurde,
aber zunächst mit so wenig Erfolg arbeitete, dass er bald
wieder nach Meißen zurückkehrte und wieder in der Fabrik
thätig war. Als er nach Verlauf von zwei Jahren den Ver-
such in Dresden erneuerte, hatte er mehr Glück. Rietschel
verwendete ihn bei seinen eigenen Arbeiten und hätte es
gern gesehen, wenn er die Modellirung von Bwueh's Statuen
des Boleslaw und Stanislaus in Lauchhammer übernommen
hätte. Leuteritz traute sich aber die glückliche Durchfüh-
rung einer derartigen Aufgabe nicht zu, da ihn Schüchtern-
heit und übergroße Bescheidenheit, die ihm noch lange an-
hafteten, bedenklich machten. Er kehrte also im Jahre 1843
nach Meißen zurück, wurde hier Modelleur an der Manu-
faktur und rückte schon im Jahre 1849 zum Vorsteher der
Gestaltungsbranche auf. Als solcher hat er bis zum 1. April
1886, wo er in den verdienten Ruhestand eintrat, mit großem
Erfolg gewirkt und sich wesentliche Verdienste um den Auf-
schwung, den die Manufaktur in neuerer Zeit gewonnen hat,
erworben. Nicht nur verstand er es, die vielen amtlichen
Schwierigkeiten als Leiter von gegen 170 Personen glücklich
zu überwinden, sondern er war auch als Erfinder und An-
geber von Mustern und Formen erfolgreich thätig. In der
von ihm im Jahre 1863 neu geordneten Modellsammlung
der Manufaktur, die mehrere hunderttausend Stück um-
fasst, befindet sich eine große Anzahl von Modellen, die als
sein geistiges Eigentum anzusehen sind. Dazu gehört vor
allem ein in den fünfziger Jahren modellirter Tafelaufsatz,
der in Tausenden von Exemplaren angefertigt und verkauft
wurde, und ein besonders beliebt gewordenes Fruchtkörb-
chen, das die Krone eines Palmbaumes bildet und von Lord
Palmerston zuerst bestellt wurde. An den technischen Fort-
schritten der Keramik ist Leuteritz insofern beteiligt, als er
der Erfinder des sogenannten Masse-auf-Masse-Porzellans ist.
Seine Verdienste waren allgemein anerkannt. Im Jahre 1867
hat er auf der Pariser Weltausstellung die große silberne
Medaille, 1873 auf der Wiener ein Ehrendiplom und gleich-
zeitig das Ritterkreuz des sächsischen Albrechtsordens erhalten.
Seit dem Jahre 1882 führte er den Titel eines Professors.
Wer ihn persönlich kannte, musste ihn in vielen Stücken
als ein Original ansehen. Die guten Eigenschaften des alten
sächsischen Wesens, die von Jahr zu Jahr seltener werden,
waren in seiner Persönlichkeit stark ausgeprägt. Sein Verlust
wird daher in Meißen noch lange betrauert werden. (Vgl.
das Meißener Tageblatt 1886, Nr. 76, S. 536 und W. Loose
in den Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt
Meißen. Meißen 1888. H, 2, S. 255.) B: A. L.
John Addington Symonds f. Mr. John Addington Sy-
monds, der nicht nur in England, sondern auch über die
Grenzen seines engeren Vaterlandes hinaus bekannte Kunst-
historiker und Forscher auf dem Gebiete der italienischen Re-
naissance, starb am 19. April in Rom. Noch kurz vor seinem
Tode war er mit der Durchsicht der zweiten Auflage seines Auf-
sehen erregenden Werkes: „Das Leben Michelangelo's" beschäf-
tigt. Man kann mit Recht behaupten, dass genanntes Werk —
jedenfalls in englischer Sprache — das bedeutendste ist, was
seit vielen Jahren über den Gegenstand gedruckt wurde und
sich ebenbürtig an die besten deutschen, auf Michelangelo
bezüglichen Schriften anreiht. — John Symonds war 1840 in
Bristol geboren, wurde auf der Harrow-Schule erzogen und ab-
solvirte seine Universitätsstudien mit besonderer Auszeichnung.
Er erhielt den großen Ehrenpreis für seine Studie: „DieRenais-
sance", und dieser Umstand wirkte auf sein ferneres Leben
bestimmend und entscheidend ein. Das erste der Öffent-
lichkeit übergebene Buch betitelt sich: „Einführung in das
Studium Dante's". Hierauf wandte er sich Petrarca und
Boccaccio, sowie den Humanisten und Poeten des 15. und
16. Jahrhunderts zu. 1876—1878 erschienen seine „Skizzen
und Studien aus Italien". Dasjenige Werk, nach welchem
der Verfasser wünschte wirklich ernsthaft beurteilt zu werden,
war die „Geschichte der Renaissance" in 5 Bänden mit der
folgenden Ergänzung: „Die katholische Reaktion". Der erste
Band „Das Zeitalter der Despoten" erschien 1875, der zweite
und dritte „Die Wiederbelebung des Studiums" und „Die
schönen Künste" im Jahre 1877. Die beiden letzten Bände
über italienische Literatur von 1300—1531, welche 1881 her-
auskamen, zeichnen sich durch klaren, fließenden und wirkungs-
vollen Stil aus und bilden infolge ihrer Fülle von neuen
Thatsachen eine schätzenswerte Quelle für den Literatur-
historiker. Sein Buch „Die Voi-läufer Shakespeare's" (1884)
giebt uns eine vorzügliche Schilderung der frühesten englischen
Literaturperiode. Ebenso nimmt Symonds einen hohen Rang
als Ubersetzer ein, und in seiner Wiedergabe der Gedichte
Michelangelo's steht er unerreicht da. Gleichfalls lieferte
Symonds ungewöhnlich gute Übersetzungen von Cellini's
Autobiographie und von den Memoiren Carlo Gozzi's. <$
%* Der Oeschickts- und Bildnis Dinier Professor Paul
Sekobelt, Lehrer an der Kunst- und Kunstgewerbeschule in
Breslau, ist daselbst am 3. Mai gestorben. Schobelt wurde,
wie wir einem Nekrologe der „Schlesischen Zeitung" ent-
nehmen, am 9. März 1838 zu Magdeburg geboren. Der
Malerei widmete er sich zuerst an der Akademie zu Düssel-
dorf, wo er unter den Prof. Mücke und Köhler arbeitete.
Es folgte ein Jahr des Studiums in Brüssel. Nach Preußen
zurückgekehrt, wurde er an der Berliner Akademie in die
Malklasse des Professors J. Schräder aufgenommen. Aber
mehr als kunstakademische Bildung förderten ihn 1859 bis
1860 seine Studien in Paris. Er besuchte dort das Atelier
von Gleyre. Studien im Louvre wurden gleichzeitig ge-
trieben. Nach Berlin zurückgekehrt, trat er wieder in das
Schrader'sche Atelier ein und erhielt dann bei der akade-
mischen Konkurrenz um den großen Staatspreis das damals
dreijährige Stipendium für Rom und Italien (1862). Dort
war es sein unablässiges Bemühen, im Sinne der erhabenen
deutschen Vorgänger in der Malerei sich individuell weiter
zu bilden und eine Fühlung mit der Heimat zu erreichen.
Es gelang dies aber erst nach einer langen Reihe von
Jahren. Kaiser Wilhelm I. interessirte sich für seine Ar-
beiten und erwarb auf der Berliner Ausstellung 1872 eines
seiner Bilder. Hierauf erfolgte eine größere Bestellung für
die Nationalgalerie (Mars und Bellona) und infolge einer
engeren Konkurrenz 1881—82 der Auftrag, den Festsaal im
Kultusministerium malerisch auszuschmücken. Am 1. Juni
1882 wurde Schobelt von Rom als ordentlicher Lehrer der
Königlichen Kunst- und Kunstgewerbeschule nach Breslau
berufen. Hier entstanden die Gemälde für den Festsaal des
Kultusministeriums, ferner die großen Kartons für die neue
Kirche am Gendarmenmarkt (der alte und der neue Bund),
die Kartons zu den Gemälden in der Apsis der Dorotheen-