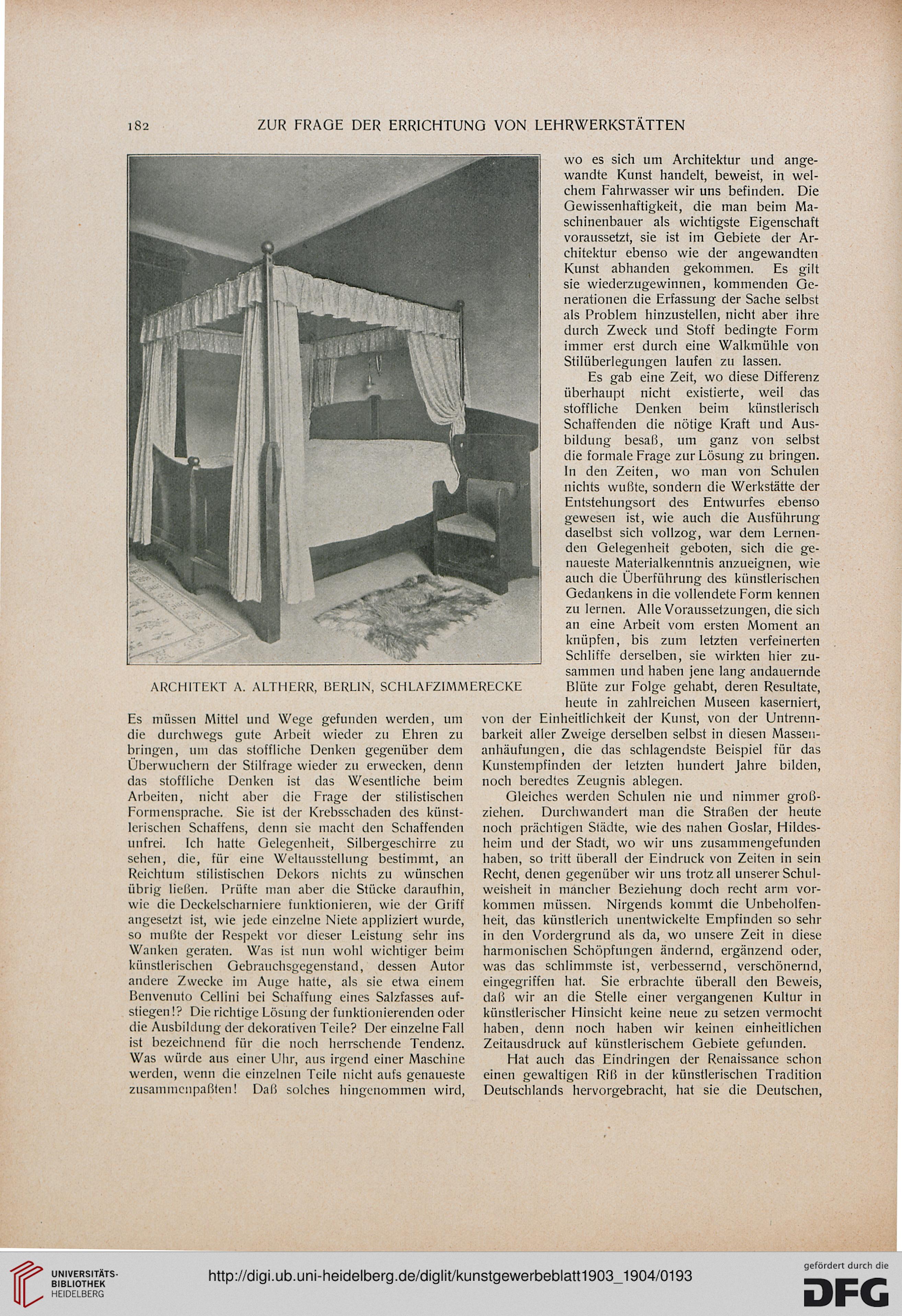182
ZUR FRAGE DER ERRICHTUNG VON LEHRWERKSTÄTTEN
ARCHITEKT A. ALTHERR, BERLIN, SCHLAEZ1MMERECKE
Es müssen Mittel und Wege gefunden werden, um
die durchwegs gute Arbeit wieder zu Ehren zu
bringen, um das stoffliche Denken gegenüber dem
Überwuchern der Stilfrage wieder zu erwecken, denn
das stoffliche Denken ist das Wesentliche beim
Arbeiten, nicht aber die Frage der stilistischen
Formensprache. Sie ist der Krebsschaden des künst-
lerischen Schaffens, denn sie macht den Schaffenden
unfrei. Ich hatte Gelegenheit, Silbergeschirre zu
sehen, die, für eine Weltausstellung bestimmt, an
Reichtum stilistischen Dekors nichts zu wünschen
übrig ließen. Prüfte man aber die Stücke daraufhin,
wie die Deckelscharniere funktionieren, wie der Griff
angesetzt ist, wie jede einzelne Niete appliziert wurde,
so mußte der Respekt vor dieser Leistung sehr ins
Wanken geraten. Was ist nun wohl wichtiger beim
künstlerischen Gebrauchsgegenstand, dessen Autor
andere Zwecke im Auge hatte, als sie etwa einem
Benvenuto Cellini bei Schaffung eines Salzfasses auf-
stiegen!? Die richtige Lösung der funktionierenden oder
die Ausbildung der dekorativen Teile? Der einzelne Fall
ist bezeichnend für die noch herrschende Tendenz.
Was würde aus einer Uhr, aus irgend einer Maschine
werden, wenn die einzelnen Teile nicht aufs genaueste
zusammenpaßten! Daß solches hingenommen wird,
wo es sich um Architektur und ange-
wandte Kunst handelt, beweist, in wel-
chem Fahrwasser wir uns befinden. Die
Gewissenhaftigkeit, die man beim Ma-
schinenbauer als wichtigste Eigenschaft
voraussetzt, sie ist im Gebiete der Ar-
chitektur ebenso wie der angewandten
Kunst abhanden gekommen. Es gilt
sie wiederzugewinnen, kommenden Ge-
nerationen die Erfassung der Sache selbst
als Problem hinzustellen, nicht aber ihre
durch Zweck und Stoff bedingte Form
immer erst durch eine Walkmühle von
Stilüberlegungen laufen zu lassen.
Es gab eine Zeit, wo diese Differenz
überhaupt nicht existierte, weil das
stoffliche Denken beim künstlerisch
Schaffenden die nötige Kraft und Aus-
bildung besaß, um ganz von selbst
die formale Frage zur Lösung zu bringen.
In den Zeiten, wo man von Schulen
nichts wußte, sondern die Werkstätte der
Entstehungsort des Entwurfes ebenso
gewesen ist, wie auch die Ausführung
daselbst sich vollzog, war dem Lernen-
den Gelegenheit geboten, sich die ge-
naueste Materialkenntnis anzueignen, wie
auch die Überführung des künstlerischen
Gedankens in die vollendete Form kennen
zu lernen. Alle Voraussetzungen, die sich
an eine Arbeit vom ersten Moment an
knüpfen, bis zum letzten verfeinerten
Schliffe derselben, sie wirkten hier zu-
sammen und haben jene lang andauernde
Blüte zur Folge gehabt, deren Resultate,
heute in zahlreichen Museen kaserniert,
von der Einheitlichkeit der Kunst, von der Untrenn-
barkeit aller Zweige derselben selbst in diesen Massen-
anhäufungen, die das schlagendste Beispiel für das
Kunstempfinden der letzten hundert Jahre bilden,
noch beredtes Zeugnis ablegen.
Gleiches werden Schulen nie und nimmer groß-
ziehen. Durchwandert man die Straßen der heute
noch prächtigen Städte, wie des nahen Goslar, Hildes-
heim und der Stadt, wo wir uns zusammengefunden
haben, so tritt überall der Eindruck von Zeiten in sein
Recht, denen gegenüber wir uns trotz all unserer Schul-
weisheit in mancher Beziehung doch recht arm vor-
kommen müssen. Nirgends kommt die Unbeholfen-
heit, das künstlerich unentwickelte Empfinden so sehr
in den Vordergrund als da, wo unsere Zeit in diese
harmonischen Schöpfungen ändernd, ergänzend oder,
was das schlimmste ist, verbessernd, verschönernd,
eingegriffen hat. Sie erbrachte überall den Beweis,
daß wir an die Stelle einer vergangenen Kultur in
künstlerischer Hinsicht keine neue zu setzen vermocht
haben, denn noch haben wir keinen einheitlichen
Zeitausdruck auf künstlerischem Gebiete gefunden.
Hat auch das Eindringen der Renaissance schon
einen gewaltigen Riß in der künstlerischen Tradition
Deutschlands hervorgebracht, hat sie die Deutschen,
ZUR FRAGE DER ERRICHTUNG VON LEHRWERKSTÄTTEN
ARCHITEKT A. ALTHERR, BERLIN, SCHLAEZ1MMERECKE
Es müssen Mittel und Wege gefunden werden, um
die durchwegs gute Arbeit wieder zu Ehren zu
bringen, um das stoffliche Denken gegenüber dem
Überwuchern der Stilfrage wieder zu erwecken, denn
das stoffliche Denken ist das Wesentliche beim
Arbeiten, nicht aber die Frage der stilistischen
Formensprache. Sie ist der Krebsschaden des künst-
lerischen Schaffens, denn sie macht den Schaffenden
unfrei. Ich hatte Gelegenheit, Silbergeschirre zu
sehen, die, für eine Weltausstellung bestimmt, an
Reichtum stilistischen Dekors nichts zu wünschen
übrig ließen. Prüfte man aber die Stücke daraufhin,
wie die Deckelscharniere funktionieren, wie der Griff
angesetzt ist, wie jede einzelne Niete appliziert wurde,
so mußte der Respekt vor dieser Leistung sehr ins
Wanken geraten. Was ist nun wohl wichtiger beim
künstlerischen Gebrauchsgegenstand, dessen Autor
andere Zwecke im Auge hatte, als sie etwa einem
Benvenuto Cellini bei Schaffung eines Salzfasses auf-
stiegen!? Die richtige Lösung der funktionierenden oder
die Ausbildung der dekorativen Teile? Der einzelne Fall
ist bezeichnend für die noch herrschende Tendenz.
Was würde aus einer Uhr, aus irgend einer Maschine
werden, wenn die einzelnen Teile nicht aufs genaueste
zusammenpaßten! Daß solches hingenommen wird,
wo es sich um Architektur und ange-
wandte Kunst handelt, beweist, in wel-
chem Fahrwasser wir uns befinden. Die
Gewissenhaftigkeit, die man beim Ma-
schinenbauer als wichtigste Eigenschaft
voraussetzt, sie ist im Gebiete der Ar-
chitektur ebenso wie der angewandten
Kunst abhanden gekommen. Es gilt
sie wiederzugewinnen, kommenden Ge-
nerationen die Erfassung der Sache selbst
als Problem hinzustellen, nicht aber ihre
durch Zweck und Stoff bedingte Form
immer erst durch eine Walkmühle von
Stilüberlegungen laufen zu lassen.
Es gab eine Zeit, wo diese Differenz
überhaupt nicht existierte, weil das
stoffliche Denken beim künstlerisch
Schaffenden die nötige Kraft und Aus-
bildung besaß, um ganz von selbst
die formale Frage zur Lösung zu bringen.
In den Zeiten, wo man von Schulen
nichts wußte, sondern die Werkstätte der
Entstehungsort des Entwurfes ebenso
gewesen ist, wie auch die Ausführung
daselbst sich vollzog, war dem Lernen-
den Gelegenheit geboten, sich die ge-
naueste Materialkenntnis anzueignen, wie
auch die Überführung des künstlerischen
Gedankens in die vollendete Form kennen
zu lernen. Alle Voraussetzungen, die sich
an eine Arbeit vom ersten Moment an
knüpfen, bis zum letzten verfeinerten
Schliffe derselben, sie wirkten hier zu-
sammen und haben jene lang andauernde
Blüte zur Folge gehabt, deren Resultate,
heute in zahlreichen Museen kaserniert,
von der Einheitlichkeit der Kunst, von der Untrenn-
barkeit aller Zweige derselben selbst in diesen Massen-
anhäufungen, die das schlagendste Beispiel für das
Kunstempfinden der letzten hundert Jahre bilden,
noch beredtes Zeugnis ablegen.
Gleiches werden Schulen nie und nimmer groß-
ziehen. Durchwandert man die Straßen der heute
noch prächtigen Städte, wie des nahen Goslar, Hildes-
heim und der Stadt, wo wir uns zusammengefunden
haben, so tritt überall der Eindruck von Zeiten in sein
Recht, denen gegenüber wir uns trotz all unserer Schul-
weisheit in mancher Beziehung doch recht arm vor-
kommen müssen. Nirgends kommt die Unbeholfen-
heit, das künstlerich unentwickelte Empfinden so sehr
in den Vordergrund als da, wo unsere Zeit in diese
harmonischen Schöpfungen ändernd, ergänzend oder,
was das schlimmste ist, verbessernd, verschönernd,
eingegriffen hat. Sie erbrachte überall den Beweis,
daß wir an die Stelle einer vergangenen Kultur in
künstlerischer Hinsicht keine neue zu setzen vermocht
haben, denn noch haben wir keinen einheitlichen
Zeitausdruck auf künstlerischem Gebiete gefunden.
Hat auch das Eindringen der Renaissance schon
einen gewaltigen Riß in der künstlerischen Tradition
Deutschlands hervorgebracht, hat sie die Deutschen,