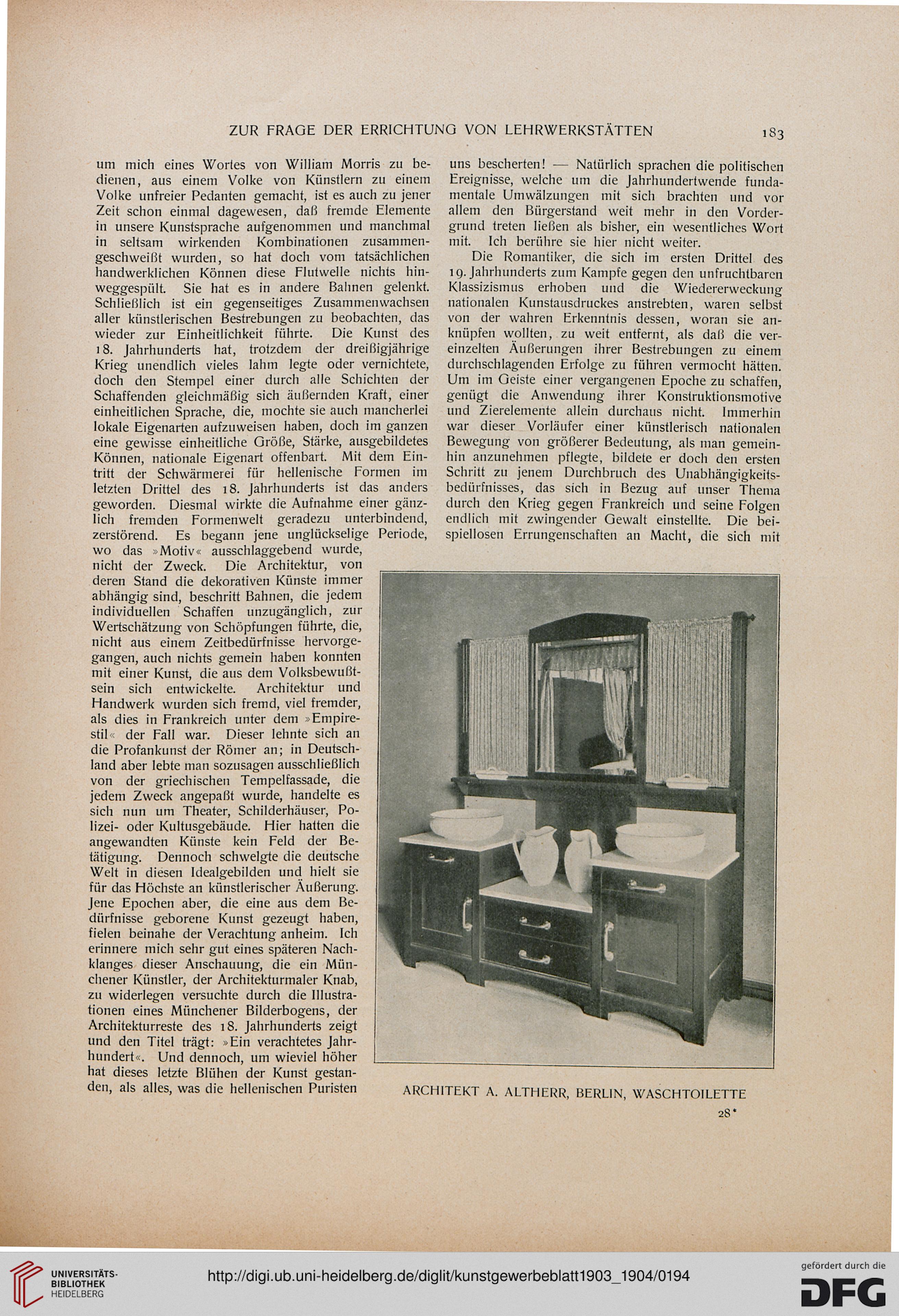ZUR FRAGE DER ERRICHTUNG VON LEHRWERKSTÄTTEN
183
um mich eines Wortes von William Morris zu be-
dienen, aus einem Volke von Künstlern zu einem
Volke unfreier Pedanten gemacht, ist es auch zu jener
Zeit schon einmal dagewesen, daß fremde Elemente
in unsere Kunstsprache aufgenommen und manchmal
in seltsam wirkenden Kombinationen zusammen-
geschweißt wurden, so hat doch vom tatsächlichen
handwerklichen Können diese Flutwelle nichts hin-
weggespült. Sie hat es in andere Bahnen gelenkt.
Schließlich ist ein gegenseitiges Zusammenwachsen
aller künstlerischen Bestrebungen zu beobachten, das
wieder zur Einheitlichkeit führte. Die Kunst des
18. Jahrhunderts hat, trotzdem der dreißigjährige
Krieg unendlich vieles lahm legte oder vernichtete,
doch den Stempel einer durch alle Schichten der
Schaffenden gleichmäßig sich äußernden Kraft, einer
einheitlichen Sprache, die, mochte sie auch mancherlei
lokale Eigenarten aufzuweisen haben, doch im ganzen
eine gewisse einheitliche Größe, Stärke, ausgebildetes
Können, nationale Eigenart offenbart. Mit dem Ein-
tritt der Schwärmerei für hellenische Formen im
letzten Drittel des 18. Jahrhunderts ist das anders
geworden. Diesmal wirkte die Aufnahme einer gänz-
lich fremden Formenwelt geradezu unterbindend,
zerstörend. Es begann jene unglückselige Periode,
wo das »Motiv« ausschlaggebend wurde,
nicht der Zweck. Die Architektur, von
deren Stand die dekorativen Künste immer
abhängig sind, beschritt Bahnen, die jedem
individuellen Schaffen unzugänglich, zur
Wertschätzung von Schöpfungen führte, die,
nicht aus einem Zeitbedürfnisse hervorge-
gangen, auch nichts gemein haben konnten
mit einer Kunst, die aus dem Volksbewußt-
sein sich entwickelte. Architektur und
Handwerk wurden sich fremd, viel fremder,
als dies in Frankreich unter dem »Empire-
stil'; der Fall war. Dieser lehnte sich an
die Profankunst der Römer an; in Deutsch-
land aber lebte man sozusagen ausschließlich
von der griechischen Tempelfassade, die
jedem Zweck angepaßt wurde, handelte es
sich nun um Theater, Schilderhäuser, Po-
lizei- oder Kultusgebäude. Hier hatten die
angewandten Künste kein Feld der Be-
tätigung. Dennoch schwelgte die deutsche
Welt in diesen Idealgebilden und hielt sie
für das Höchste an künstlerischer Äußerung.
Jene Epochen aber, die eine aus dem Be-
dürfnisse geborene Kunst gezeugt haben,
fielen beinahe der Verachtung anheim. Ich
erinnere mich sehr gut eines späteren Nach-
klanges dieser Anschauung, die ein Mün-
chener Künstler, der Architekturmaler Knab,
zu widerlegen versuchte durch die Illustra-
tionen eines Münchener Bilderbogens, der
Architekturreste des 18. Jahrhunderts zeigt
und den Titel trägt: »Ein verachtetes Jahr-
hundert«. Und dennoch, um wieviel höher
hat dieses letzte Blühen der Kunst gestan-
den, als alles, was die hellenischen Puristen
uns bescherten! — Natürlich sprachen die politischen
Ereignisse, welche um die Jahrhundertwende funda-
mentale Umwälzungen mit sich brachten und vor
allem den Bürgerstand weit mehr in den Vorder-
grund treten ließen als bisher, ein wesentliches Wort
mit. Ich berühre sie hier nicht weiter.
Die Romantiker, die sich im ersten Drittel des
ig. Jahrhunderts zum Kampfe gegen den unfruchtbaren
Klassizismus erhoben und die Wiedererweckung
nationalen Kunstausdruckes anstrebten, waren selbst
von der wahren Erkenntnis dessen, woran sie an-
knüpfen wollten, zu weit entfernt, als daß die ver-
einzelten Äußerungen ihrer Bestrebungen zu einem
durchschlagenden Erfolge zu führen vermocht hätten.
Um im Geiste einer vergangenen Epoche zu schaffen,
genügt die Anwendung ihrer Konstruktionsmotive
und Zierelemente allein durchaus nicht. Immerhin
war dieser Vorläufer einer künstlerisch nationalen
Bewegung von größerer Bedeutung, als man gemein-
hin anzunehmen pflegte, bildete er doch den ersten
Schritt zu jenem Durchbruch des Unabhängigkeits-
bedürfnisses, das sich in Bezug auf unser Thema
durch den Krieg gegen Frankreich und seine Folgen
endlich mit zwingender Gewalt einstellte. Die bei-
spiellosen Errungenschaften an Macht, die sich mit
ARCHITEKT A. ALTHERR, BERLIN, WASCHTOILETTE
28'
183
um mich eines Wortes von William Morris zu be-
dienen, aus einem Volke von Künstlern zu einem
Volke unfreier Pedanten gemacht, ist es auch zu jener
Zeit schon einmal dagewesen, daß fremde Elemente
in unsere Kunstsprache aufgenommen und manchmal
in seltsam wirkenden Kombinationen zusammen-
geschweißt wurden, so hat doch vom tatsächlichen
handwerklichen Können diese Flutwelle nichts hin-
weggespült. Sie hat es in andere Bahnen gelenkt.
Schließlich ist ein gegenseitiges Zusammenwachsen
aller künstlerischen Bestrebungen zu beobachten, das
wieder zur Einheitlichkeit führte. Die Kunst des
18. Jahrhunderts hat, trotzdem der dreißigjährige
Krieg unendlich vieles lahm legte oder vernichtete,
doch den Stempel einer durch alle Schichten der
Schaffenden gleichmäßig sich äußernden Kraft, einer
einheitlichen Sprache, die, mochte sie auch mancherlei
lokale Eigenarten aufzuweisen haben, doch im ganzen
eine gewisse einheitliche Größe, Stärke, ausgebildetes
Können, nationale Eigenart offenbart. Mit dem Ein-
tritt der Schwärmerei für hellenische Formen im
letzten Drittel des 18. Jahrhunderts ist das anders
geworden. Diesmal wirkte die Aufnahme einer gänz-
lich fremden Formenwelt geradezu unterbindend,
zerstörend. Es begann jene unglückselige Periode,
wo das »Motiv« ausschlaggebend wurde,
nicht der Zweck. Die Architektur, von
deren Stand die dekorativen Künste immer
abhängig sind, beschritt Bahnen, die jedem
individuellen Schaffen unzugänglich, zur
Wertschätzung von Schöpfungen führte, die,
nicht aus einem Zeitbedürfnisse hervorge-
gangen, auch nichts gemein haben konnten
mit einer Kunst, die aus dem Volksbewußt-
sein sich entwickelte. Architektur und
Handwerk wurden sich fremd, viel fremder,
als dies in Frankreich unter dem »Empire-
stil'; der Fall war. Dieser lehnte sich an
die Profankunst der Römer an; in Deutsch-
land aber lebte man sozusagen ausschließlich
von der griechischen Tempelfassade, die
jedem Zweck angepaßt wurde, handelte es
sich nun um Theater, Schilderhäuser, Po-
lizei- oder Kultusgebäude. Hier hatten die
angewandten Künste kein Feld der Be-
tätigung. Dennoch schwelgte die deutsche
Welt in diesen Idealgebilden und hielt sie
für das Höchste an künstlerischer Äußerung.
Jene Epochen aber, die eine aus dem Be-
dürfnisse geborene Kunst gezeugt haben,
fielen beinahe der Verachtung anheim. Ich
erinnere mich sehr gut eines späteren Nach-
klanges dieser Anschauung, die ein Mün-
chener Künstler, der Architekturmaler Knab,
zu widerlegen versuchte durch die Illustra-
tionen eines Münchener Bilderbogens, der
Architekturreste des 18. Jahrhunderts zeigt
und den Titel trägt: »Ein verachtetes Jahr-
hundert«. Und dennoch, um wieviel höher
hat dieses letzte Blühen der Kunst gestan-
den, als alles, was die hellenischen Puristen
uns bescherten! — Natürlich sprachen die politischen
Ereignisse, welche um die Jahrhundertwende funda-
mentale Umwälzungen mit sich brachten und vor
allem den Bürgerstand weit mehr in den Vorder-
grund treten ließen als bisher, ein wesentliches Wort
mit. Ich berühre sie hier nicht weiter.
Die Romantiker, die sich im ersten Drittel des
ig. Jahrhunderts zum Kampfe gegen den unfruchtbaren
Klassizismus erhoben und die Wiedererweckung
nationalen Kunstausdruckes anstrebten, waren selbst
von der wahren Erkenntnis dessen, woran sie an-
knüpfen wollten, zu weit entfernt, als daß die ver-
einzelten Äußerungen ihrer Bestrebungen zu einem
durchschlagenden Erfolge zu führen vermocht hätten.
Um im Geiste einer vergangenen Epoche zu schaffen,
genügt die Anwendung ihrer Konstruktionsmotive
und Zierelemente allein durchaus nicht. Immerhin
war dieser Vorläufer einer künstlerisch nationalen
Bewegung von größerer Bedeutung, als man gemein-
hin anzunehmen pflegte, bildete er doch den ersten
Schritt zu jenem Durchbruch des Unabhängigkeits-
bedürfnisses, das sich in Bezug auf unser Thema
durch den Krieg gegen Frankreich und seine Folgen
endlich mit zwingender Gewalt einstellte. Die bei-
spiellosen Errungenschaften an Macht, die sich mit
ARCHITEKT A. ALTHERR, BERLIN, WASCHTOILETTE
28'