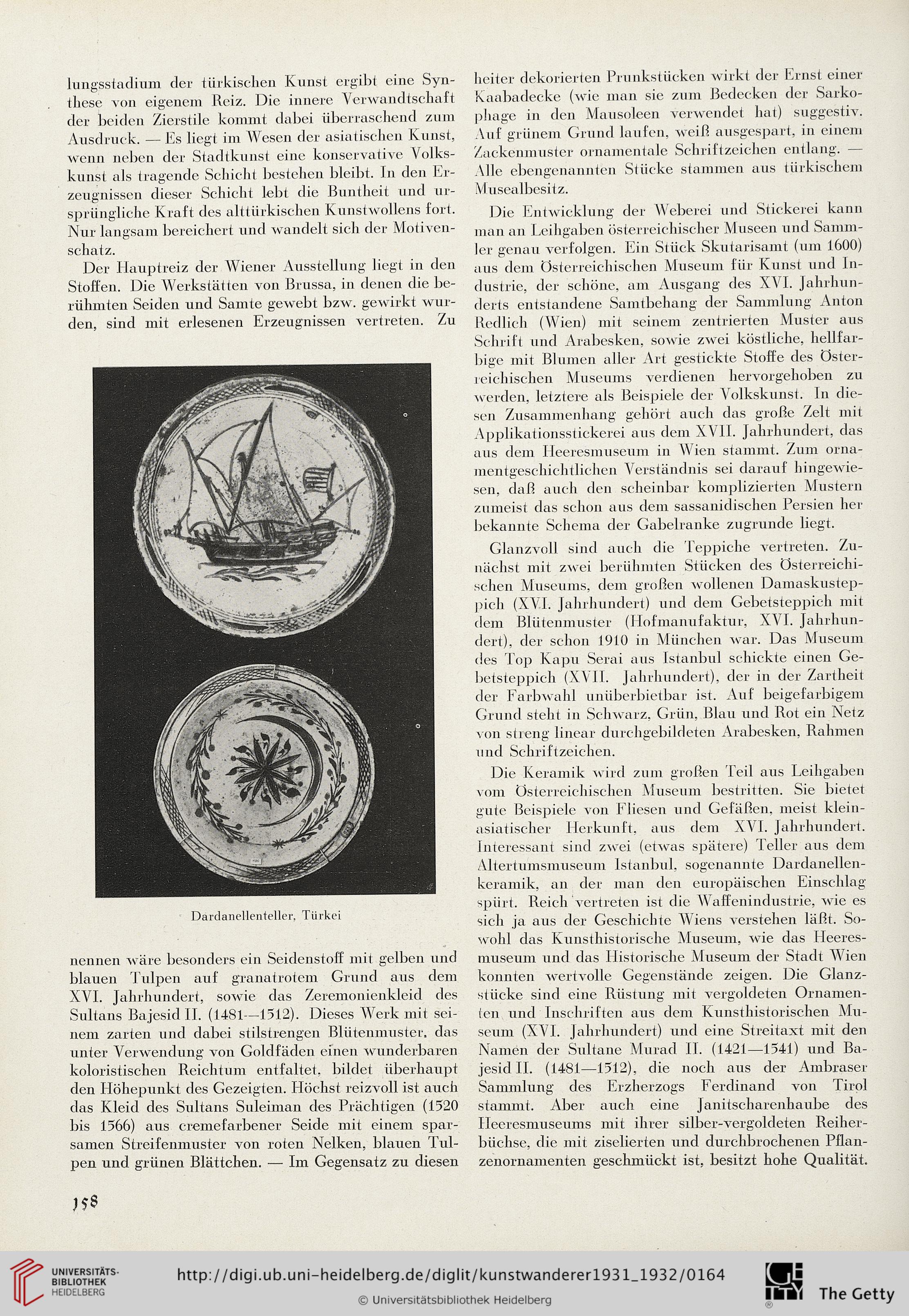lungsstadium der türkischen Kunst ergibt eine Syn-
tliese von eigenem Reiz. Die innere Yerwandtschaft
der beiden Zierstile kommt dabei iiberraschend zum
Ausdruck. — Es liegt im Wesen der asiatischen Kunst,
wenn neben der Stadtkunst eine konservative Volks-
kunst als tragende Schicht bestehen bleibt. I n den Er-
zeugnissen dieser Schicht lebt die Buntheit und ur-
sprüngliche Kraft des alttürkischen Kunstwollens fort.
Nur langsam bereichert und wandelt sich der Motiven-
schatz.
Der Hauptreiz der Wiener Ausstellung liegt in den
Stoffen. Die Werkstätten von Brussa, in denen die be-
rühmten Seiden und Samte gewebt bzw. gewirkt wur-
den, sind mit erlesenen Erzeugnissen vertreten. Zu
Dardanellenteller, Türkei
nennen wäre besonders ein Seidenstoff mit gelben und
blauen Tulpen auf granatrotem Grund aus dem
XVI. Jahrhundert, sowie das Zeremonienkleid des
Sultans Bajesid II. (1481—1512). Dieses Werk mit sei-
nem zarten und dabei stilstrengen Blütenmuster. das
unter Verwendung von Goldfäden einen wunderbaren
koloristischen Reichtum entfaltet, bildet überhaupt
den Höhepunkt des Gezeigten. Elöchst reizvoll ist auch
das Kleid des Sultans Suleiman des Prächtigen (1520
bis 1566) aus cremefarbener Seide mit einem spar-
samen Streifenmuster von roten Nelken, blauen Tul-
pen und griinen Blättchen. — Im Gegensatz zu diesen
heiter dekorierten Prunkstücken wirkt der Ernst einer
Kaabadecke (A\rie man sie zum Bedecken der Sarko-
pliage in den Mausoleen verwendet hat) suggestiv.
Auf grünem Grund laufen, weiß ausgespart, in einem
Zackenmuster ornamentale Schriftzeichen entlang. —
Alle ebengenannten Stiicke stammen aus türkischem
Musealbesitz.
D ie Entwicklung der Weberei und Stickerei kann
man an Leihgaben österreichischer Museen und Samm-
ler genau verfolgen. Ein Stück Skutarisamt (um 1600)
aus dem österreichischen Museum fiir Kunst und In-
dustrie, der schöne, am Ausgang des XVI. Jahrhun-
derts entstandene Samtbehang der Sammlung Anton
Redlicli (Wien) mit seinem zentrierten Muster aus
Schrift und Arabesken, sowie zwei köstliche, hellfar-
bige mit Bluinen aller Art gestickte Stoffe des öster-
reichischen Museums verdienen hervorgehoben zu
werden, letztere als Beisjnele der Volkskunst. In die-
sen Zusammenhang gehört auch das große Zelt mit
Applikationsstickerei aus dem XVII. Jahrhundert, das
aus dem Heeresmuseum in Wien stammt. Zum orna-
mentgeschichtlichen Verständnis sei darauf hingewie-
sen, daß auch den scheinbar komplizierten Mustern
zumeist das schon aus dem sassanidischen Persien her
bekannte Schema der Gabelranke zugrunde liegt.
Glanzvoll sind auch die Teppiche vertreten. Zu-
nächst mit zwei berühmten Stücken des österreichi-
schen Museums, dem großen wollenen Damaskustep-
j>ich (XVI. Jahrhundert) und dem Gebetsteppich mit
dem Blütenmuster (Hofmanufaktur, XVI. Jahrhun-
dert), der schon 1910 in München war. Das Museum
des Top Kapu Serai aus Istanbul schickte einen Ge-
betsteppich (XVII. jahrhundert), der in der Zartheit
der Farbwahl unüberbietbar ist. Auf beigefarbigem
G'rund steht in Schwarz, Grün, Blau und Rot ein Neiz
von streng linear durchgebildeten Arabesken, Rahinen
11nd Schriftzeichen.
Die Keramik wird zum großen Teil aus Leihgaben
vom Österreichischen Museum bestritten. Sie bietet
gute Beispiele von Eliesen und Gefäßen, meist klein-
asiatischer Herkunft, aus dem XVI. Jahrhundert.
Interessant sind zwei (etwas spätere) Teller aus dem
Altertumsmuseum Istanbul, sogenannte Dardanellen-
keramik, an der man den europäischen Einschlag
spürt. Reicli vertreten ist die Waffenindustrie, wie es
sicli ja aus der Geschichte Wiens verstehen läßt. So-
wohl das Kunsthistorische Museum, wie das Heeres-
museum und das ITistorische Museum der Stadt Wien
konnten wertvolle Gegenstände zeigen. Die Glanz-
stticke sind eine Rüstung mit vergoldeten Ornamen-
ten und Inschriften aus dem Kunsthistorischen Mu-
seum (XVL jahrhundert) und eine Streitaxt mit den
Narnen der Sultane Murad II. (1421—1541) und Ba-
jesid II. (1481—1512), die nocli aus der Ambraser
Sammlung des Erzlierzogs Ferdinand von Tirol
stammt. Aber aucli eine J anitscharenhaube des
Heeresmuseums mit ihrer silber-vergoldeten Reiher-
büchse, die mit ziselierten und durchbrochenen Pflan-
zenornamenten geschmückt ist, besitzt liohe Qualität.
tliese von eigenem Reiz. Die innere Yerwandtschaft
der beiden Zierstile kommt dabei iiberraschend zum
Ausdruck. — Es liegt im Wesen der asiatischen Kunst,
wenn neben der Stadtkunst eine konservative Volks-
kunst als tragende Schicht bestehen bleibt. I n den Er-
zeugnissen dieser Schicht lebt die Buntheit und ur-
sprüngliche Kraft des alttürkischen Kunstwollens fort.
Nur langsam bereichert und wandelt sich der Motiven-
schatz.
Der Hauptreiz der Wiener Ausstellung liegt in den
Stoffen. Die Werkstätten von Brussa, in denen die be-
rühmten Seiden und Samte gewebt bzw. gewirkt wur-
den, sind mit erlesenen Erzeugnissen vertreten. Zu
Dardanellenteller, Türkei
nennen wäre besonders ein Seidenstoff mit gelben und
blauen Tulpen auf granatrotem Grund aus dem
XVI. Jahrhundert, sowie das Zeremonienkleid des
Sultans Bajesid II. (1481—1512). Dieses Werk mit sei-
nem zarten und dabei stilstrengen Blütenmuster. das
unter Verwendung von Goldfäden einen wunderbaren
koloristischen Reichtum entfaltet, bildet überhaupt
den Höhepunkt des Gezeigten. Elöchst reizvoll ist auch
das Kleid des Sultans Suleiman des Prächtigen (1520
bis 1566) aus cremefarbener Seide mit einem spar-
samen Streifenmuster von roten Nelken, blauen Tul-
pen und griinen Blättchen. — Im Gegensatz zu diesen
heiter dekorierten Prunkstücken wirkt der Ernst einer
Kaabadecke (A\rie man sie zum Bedecken der Sarko-
pliage in den Mausoleen verwendet hat) suggestiv.
Auf grünem Grund laufen, weiß ausgespart, in einem
Zackenmuster ornamentale Schriftzeichen entlang. —
Alle ebengenannten Stiicke stammen aus türkischem
Musealbesitz.
D ie Entwicklung der Weberei und Stickerei kann
man an Leihgaben österreichischer Museen und Samm-
ler genau verfolgen. Ein Stück Skutarisamt (um 1600)
aus dem österreichischen Museum fiir Kunst und In-
dustrie, der schöne, am Ausgang des XVI. Jahrhun-
derts entstandene Samtbehang der Sammlung Anton
Redlicli (Wien) mit seinem zentrierten Muster aus
Schrift und Arabesken, sowie zwei köstliche, hellfar-
bige mit Bluinen aller Art gestickte Stoffe des öster-
reichischen Museums verdienen hervorgehoben zu
werden, letztere als Beisjnele der Volkskunst. In die-
sen Zusammenhang gehört auch das große Zelt mit
Applikationsstickerei aus dem XVII. Jahrhundert, das
aus dem Heeresmuseum in Wien stammt. Zum orna-
mentgeschichtlichen Verständnis sei darauf hingewie-
sen, daß auch den scheinbar komplizierten Mustern
zumeist das schon aus dem sassanidischen Persien her
bekannte Schema der Gabelranke zugrunde liegt.
Glanzvoll sind auch die Teppiche vertreten. Zu-
nächst mit zwei berühmten Stücken des österreichi-
schen Museums, dem großen wollenen Damaskustep-
j>ich (XVI. Jahrhundert) und dem Gebetsteppich mit
dem Blütenmuster (Hofmanufaktur, XVI. Jahrhun-
dert), der schon 1910 in München war. Das Museum
des Top Kapu Serai aus Istanbul schickte einen Ge-
betsteppich (XVII. jahrhundert), der in der Zartheit
der Farbwahl unüberbietbar ist. Auf beigefarbigem
G'rund steht in Schwarz, Grün, Blau und Rot ein Neiz
von streng linear durchgebildeten Arabesken, Rahinen
11nd Schriftzeichen.
Die Keramik wird zum großen Teil aus Leihgaben
vom Österreichischen Museum bestritten. Sie bietet
gute Beispiele von Eliesen und Gefäßen, meist klein-
asiatischer Herkunft, aus dem XVI. Jahrhundert.
Interessant sind zwei (etwas spätere) Teller aus dem
Altertumsmuseum Istanbul, sogenannte Dardanellen-
keramik, an der man den europäischen Einschlag
spürt. Reicli vertreten ist die Waffenindustrie, wie es
sicli ja aus der Geschichte Wiens verstehen läßt. So-
wohl das Kunsthistorische Museum, wie das Heeres-
museum und das ITistorische Museum der Stadt Wien
konnten wertvolle Gegenstände zeigen. Die Glanz-
stticke sind eine Rüstung mit vergoldeten Ornamen-
ten und Inschriften aus dem Kunsthistorischen Mu-
seum (XVL jahrhundert) und eine Streitaxt mit den
Narnen der Sultane Murad II. (1421—1541) und Ba-
jesid II. (1481—1512), die nocli aus der Ambraser
Sammlung des Erzlierzogs Ferdinand von Tirol
stammt. Aber aucli eine J anitscharenhaube des
Heeresmuseums mit ihrer silber-vergoldeten Reiher-
büchse, die mit ziselierten und durchbrochenen Pflan-
zenornamenten geschmückt ist, besitzt liohe Qualität.