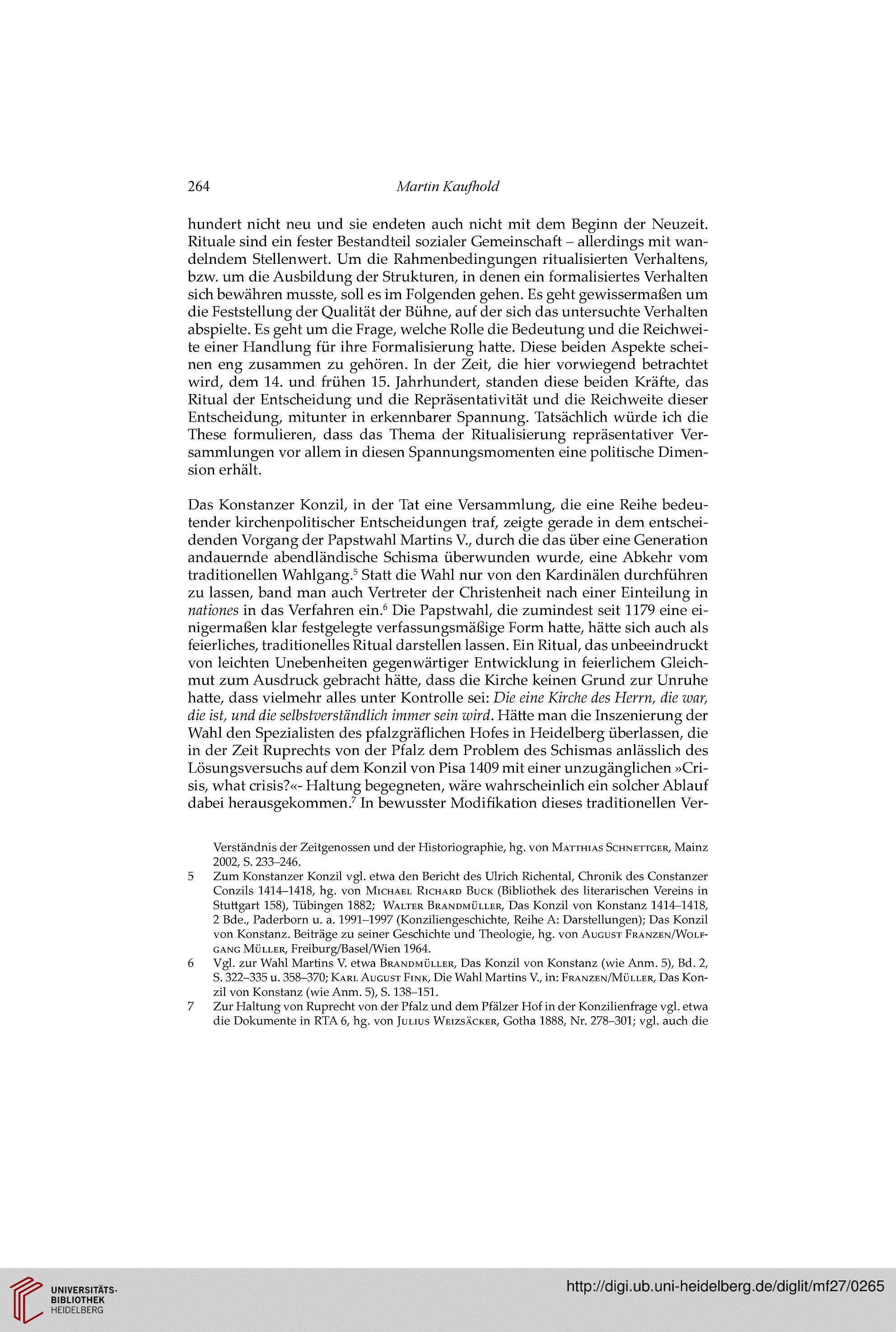264
Martin Kaufhold
hundert nicht neu und sie endeten auch nicht mit dem Beginn der Neuzeit.
Rituale sind ein fester Bestandteil sozialer Gemeinschaft - allerdings mit wan-
delndem Stellenwert. Um die Rahmenbedingungen ritualisierten Verhaltens,
bzw. um die Ausbildung der Strukturen, in denen ein formalisiertes Verhalten
sich bewähren musste, soll es im Folgenden gehen. Es geht gewissermaßen um
die Feststellung der Qualität der Bühne, auf der sich das untersuchte Verhalten
abspielte. Es geht um die Frage, welche Rolle die Bedeutung und die Reichwei-
te einer Handlung für ihre Formalisierung hatte. Diese beiden Aspekte schei-
nen eng zusammen zu gehören. In der Zeit, die hier vorwiegend betrachtet
wird, dem 14. und frühen 15. Jahrhundert, standen diese beiden Kräfte, das
Ritual der Entscheidung und die Repräsentativität und die Reichweite dieser
Entscheidung, mitunter in erkennbarer Spannung. Tatsächlich würde ich die
These formulieren, dass das Thema der Ritualisierung repräsentativer Ver-
sammlungen vor allem in diesen Spannungsmomenten eine politische Dimen-
sion erhält.
Das Konstanzer Konzil, in der Tat eine Versammlung, die eine Reihe bedeu-
tender kirchenpolitischer Entscheidungen traf, zeigte gerade in dem entschei-
denden Vorgang der Papstwahl Martins V., durch die das über eine Generation
andauernde abendländische Schisma überwunden wurde, eine Abkehr vom
traditionellen Wahlgang.5 Statt die Wahl nur von den Kardinälen durchführen
zu lassen, band man auch Vertreter der Christenheit nach einer Einteilung in
nationes in das Verfahren ein.6 Die Papstwahl, die zumindest seit 1179 eine ei-
nigermaßen klar fest gelegte verfassungsmäßige Form hatte, hätte sich auch als
feierliches, traditionelles Ritual dar st eilen lassen. Ein Ritual, das unbeeindruckt
von leichten Unebenheiten gegenwärtiger Entwicklung in feierlichem Gleich-
mut zum Ausdruck gebracht hätte, dass die Kirche keinen Grund zur Unruhe
hatte, dass vielmehr alles unter Kontrolle sei: Die eine Kirche des Herrn, die war;
die ist, und die selbstverständlich immer sein wird. Hätte man die Inszenierung der
Wahl den Spezialisten des pfalzgräflichen Hofes in Heidelberg überlassen, die
in der Zeit Ruprechts von der Pfalz dem Problem des Schismas anlässlich des
Lösungsversuchs auf dem Konzil von Pisa 1409 mit einer unzugänglichen »Cri-
sis, what crisis?«- Haltung begegneten, wäre wahrscheinlich ein solcher Ablauf
dabei her aus gekommen 7 In bewusster Modifikation dieses traditionellen Ver-
Verständnis der Zeitgenossen und der Historiographie, hg. von Matthias Schnettger, Mainz
2002, S. 233-246.
5 Zum Konstanzer Konzil vgl. etwa den Bericht des Ulrich Richental, Chronik des Constanzer
Conzils 1414—1418, hg. von Michael Richard Buck (Bibliothek des literarischen Vereins in
Stuttgart 158), Tübingen 1882; Walter Brandmüller, Das Konzil von Konstanz 1414—1418,
2 Bde., Paderborn u. a. 1991-1997 (Konziliengeschichte, Reihe A: Darstellungen); Das Konzil
von Konstanz. Beiträge zu seiner Geschichte und Theologie, hg. von August Franzen/Wolf-
gang Müller, Freiburg/Basel/Wien 1964.
6 Vgl. zur Wahl Martins V. etwa Brandmüller, Das Konzil von Konstanz (wie Anm. 5), Bd. 2,
S. 322-335 u. 358-370; Karl August Fink, Die Wahl Martins V., in: Franzen/Müller, Das Kon-
zil von Konstanz (wie Anm. 5), S. 138-151.
7 Zur Haltung von Ruprecht von der Pfalz und dem Pfälzer Hof in der Konzilienfrage vgl. etwa
die Dokumente in RTA 6, hg. von Julius Weizsäcker, Gotha 1888, Nr. 278-301; vgl. auch die
Martin Kaufhold
hundert nicht neu und sie endeten auch nicht mit dem Beginn der Neuzeit.
Rituale sind ein fester Bestandteil sozialer Gemeinschaft - allerdings mit wan-
delndem Stellenwert. Um die Rahmenbedingungen ritualisierten Verhaltens,
bzw. um die Ausbildung der Strukturen, in denen ein formalisiertes Verhalten
sich bewähren musste, soll es im Folgenden gehen. Es geht gewissermaßen um
die Feststellung der Qualität der Bühne, auf der sich das untersuchte Verhalten
abspielte. Es geht um die Frage, welche Rolle die Bedeutung und die Reichwei-
te einer Handlung für ihre Formalisierung hatte. Diese beiden Aspekte schei-
nen eng zusammen zu gehören. In der Zeit, die hier vorwiegend betrachtet
wird, dem 14. und frühen 15. Jahrhundert, standen diese beiden Kräfte, das
Ritual der Entscheidung und die Repräsentativität und die Reichweite dieser
Entscheidung, mitunter in erkennbarer Spannung. Tatsächlich würde ich die
These formulieren, dass das Thema der Ritualisierung repräsentativer Ver-
sammlungen vor allem in diesen Spannungsmomenten eine politische Dimen-
sion erhält.
Das Konstanzer Konzil, in der Tat eine Versammlung, die eine Reihe bedeu-
tender kirchenpolitischer Entscheidungen traf, zeigte gerade in dem entschei-
denden Vorgang der Papstwahl Martins V., durch die das über eine Generation
andauernde abendländische Schisma überwunden wurde, eine Abkehr vom
traditionellen Wahlgang.5 Statt die Wahl nur von den Kardinälen durchführen
zu lassen, band man auch Vertreter der Christenheit nach einer Einteilung in
nationes in das Verfahren ein.6 Die Papstwahl, die zumindest seit 1179 eine ei-
nigermaßen klar fest gelegte verfassungsmäßige Form hatte, hätte sich auch als
feierliches, traditionelles Ritual dar st eilen lassen. Ein Ritual, das unbeeindruckt
von leichten Unebenheiten gegenwärtiger Entwicklung in feierlichem Gleich-
mut zum Ausdruck gebracht hätte, dass die Kirche keinen Grund zur Unruhe
hatte, dass vielmehr alles unter Kontrolle sei: Die eine Kirche des Herrn, die war;
die ist, und die selbstverständlich immer sein wird. Hätte man die Inszenierung der
Wahl den Spezialisten des pfalzgräflichen Hofes in Heidelberg überlassen, die
in der Zeit Ruprechts von der Pfalz dem Problem des Schismas anlässlich des
Lösungsversuchs auf dem Konzil von Pisa 1409 mit einer unzugänglichen »Cri-
sis, what crisis?«- Haltung begegneten, wäre wahrscheinlich ein solcher Ablauf
dabei her aus gekommen 7 In bewusster Modifikation dieses traditionellen Ver-
Verständnis der Zeitgenossen und der Historiographie, hg. von Matthias Schnettger, Mainz
2002, S. 233-246.
5 Zum Konstanzer Konzil vgl. etwa den Bericht des Ulrich Richental, Chronik des Constanzer
Conzils 1414—1418, hg. von Michael Richard Buck (Bibliothek des literarischen Vereins in
Stuttgart 158), Tübingen 1882; Walter Brandmüller, Das Konzil von Konstanz 1414—1418,
2 Bde., Paderborn u. a. 1991-1997 (Konziliengeschichte, Reihe A: Darstellungen); Das Konzil
von Konstanz. Beiträge zu seiner Geschichte und Theologie, hg. von August Franzen/Wolf-
gang Müller, Freiburg/Basel/Wien 1964.
6 Vgl. zur Wahl Martins V. etwa Brandmüller, Das Konzil von Konstanz (wie Anm. 5), Bd. 2,
S. 322-335 u. 358-370; Karl August Fink, Die Wahl Martins V., in: Franzen/Müller, Das Kon-
zil von Konstanz (wie Anm. 5), S. 138-151.
7 Zur Haltung von Ruprecht von der Pfalz und dem Pfälzer Hof in der Konzilienfrage vgl. etwa
die Dokumente in RTA 6, hg. von Julius Weizsäcker, Gotha 1888, Nr. 278-301; vgl. auch die