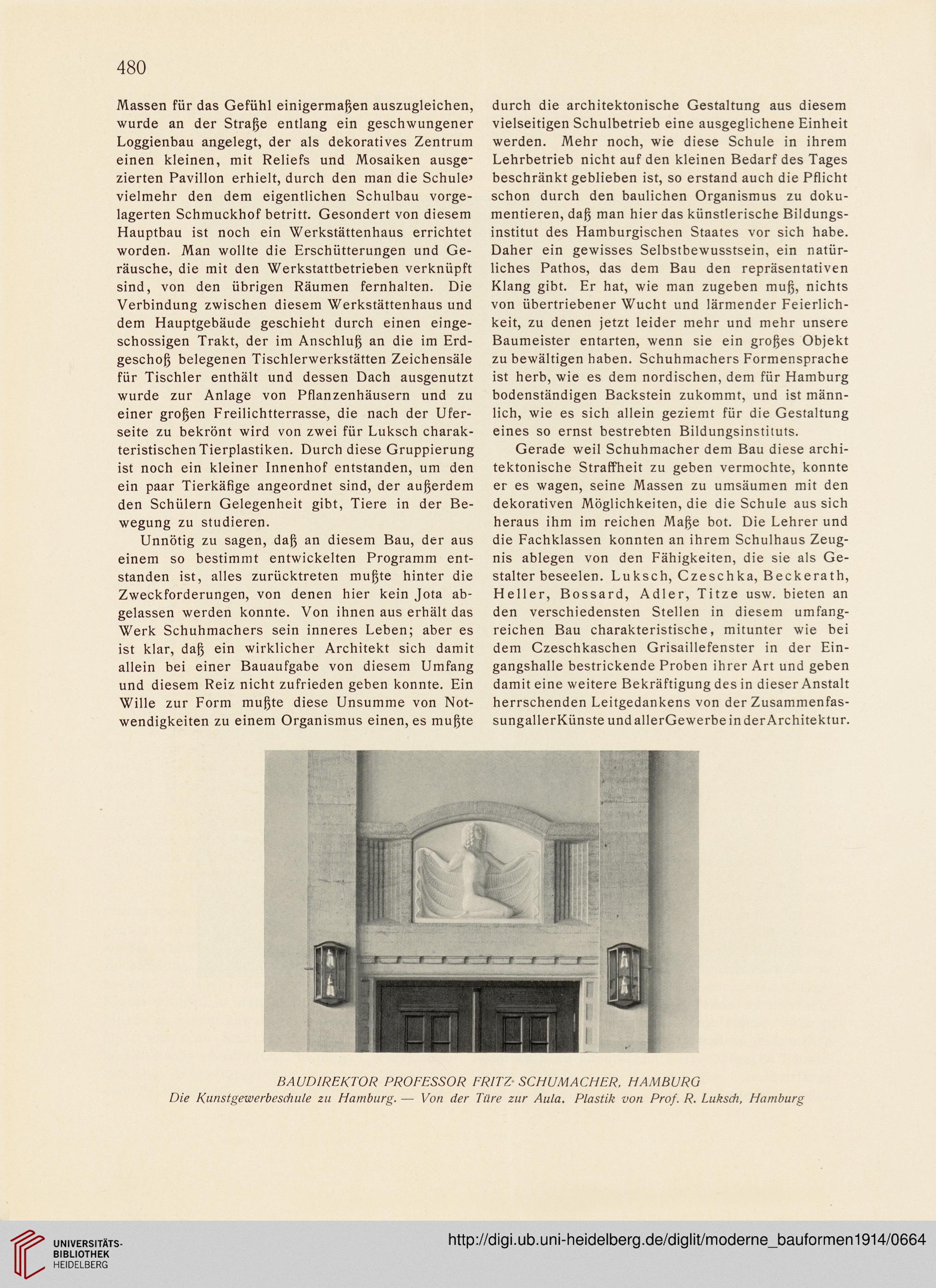480
Massen für das Gefühl einigermaßen auszugleichen,
wurde an der Straße entlang ein geschwungener
Loggienbau angelegt, der als dekoratives Zentrum
einen kleinen, mit Reliefs und Mosaiken ausge-
zierten Pavillon erhielt, durch den man die Schule’
vielmehr den dem eigentlichen Schulbau vorge-
lagerten Schmuckhof betritt. Gesondert von diesem
Hauptbau ist noch ein Werkstättenhaus errichtet
worden. Man wollte die Erschütterungen und Ge-
räusche, die mit den Werkstattbetrieben verknüpft
sind, von den übrigen Räumen fernhalten. Die
Verbindung zwischen diesem Werkstättenhaus und
dem Hauptgebäude geschieht durch einen einge-
schossigen Trakt, der im Anschluß an die im Erd-
geschoß belegenen Tischlerwerkstätten Zeichensäle
für Tischler enthält und dessen Dach ausgenutzt
wurde zur Anlage von Pflanzenhäusern und zu
einer großen Freilichtterrasse, die nach der Ufer-
seite zu bekrönt wird von zwei für Luksch charak-
teristischen Tierplastiken. Durch diese Gruppierung
ist noch ein kleiner Innenhof entstanden, um den
ein paar Tierkäfige angeordnet sind, der außerdem
den Schülern Gelegenheit gibt, Tiere in der Be-
wegung zu studieren.
Unnötig zu sagen, daß an diesem Bau, der aus
einem so bestimmt entwickelten Programm ent-
standen ist, alles zurücktreten mußte hinter die
Zweckforderungen, von denen hier kein Jota ab-
gelassen werden konnte. Von ihnen aus erhält das
Werk Schuhmachers sein inneres Leben; aber es
ist klar, daß ein wirklicher Architekt sich damit
allein bei einer Bauaufgabe von diesem Umfang
und diesem Reiz nicht zufrieden geben konnte. Ein
Wille zur Form mußte diese Unsumme von Not-
wendigkeiten zu einem Organismus einen, es mußte
durch die architektonische Gestaltung aus diesem
vielseitigen Schulbetrieb eine ausgeglichene Einheit
werden. Mehr noch, wie diese Schule in ihrem
Lehrbetrieb nicht auf den kleinen Bedarf des Tages
beschränkt geblieben ist, so erstand auch die Pflicht
schon durch den baulichen Organismus zu doku-
mentieren, daß man hier das künstlerische Bildungs-
institut des Hamburgischen Staates vor sich habe.
Daher ein gewisses Selbstbewusstsein, ein natür-
liches Pathos, das dem Bau den repräsentativen
Klang gibt. Er hat, wie man zugeben muß, nichts
von übertriebener Wucht und lärmender Feierlich-
keit, zu denen jetzt leider mehr und mehr unsere
Baumeister entarten, wenn sie ein großes Objekt
zu bewältigen haben. Schuhmachers Formensprache
ist herb, wie es dem nordischen, dem für Hamburg
bodenständigen Backstein zukommt, und ist männ-
lich, wie es sich allein geziemt für die Gestaltung
eines so ernst bestrebten Bildungsinstituts.
Gerade weil Schuhmacher dem Bau diese archi-
tektonische Straffheit zu geben vermochte, konnte
er es wagen, seine Massen zu umsäumen mit den
dekorativen Möglichkeiten, die die Schule aus sich
heraus ihm im reichen Maße bot. Die Lehrer und
die Fachklassen konnten an ihrem Schulhaus Zeug-
nis ablegen von den Fähigkeiten, die sie als Ge-
stalter beseelen. Luksch, Czeschka, Beckerath,
Heller, Bossard, Adler, Titze usw. bieten an
den verschiedensten Stellen in diesem umfang-
reichen Bau charakteristische, mitunter wie bei
dem Czeschkaschen Grisaillefenster in der Ein-
gangshalle bestrickende Proben ihrer Art und geben
damit eine weitere Bekräftigung des in dieser Anstalt
herrschenden Leitgedankens von der Zusammenfas-
sungallerKünsteundallerGewerbe in der Architektur.
BAUDIREKTOR PROFESSOR FRITZ- SCHUMACHER. HAMBURG
Die Kunstgewerbeschule zu Hamburg. — Von der Türe zur Aula. Plastik von Prof. R. Luksch, Hamburg
Massen für das Gefühl einigermaßen auszugleichen,
wurde an der Straße entlang ein geschwungener
Loggienbau angelegt, der als dekoratives Zentrum
einen kleinen, mit Reliefs und Mosaiken ausge-
zierten Pavillon erhielt, durch den man die Schule’
vielmehr den dem eigentlichen Schulbau vorge-
lagerten Schmuckhof betritt. Gesondert von diesem
Hauptbau ist noch ein Werkstättenhaus errichtet
worden. Man wollte die Erschütterungen und Ge-
räusche, die mit den Werkstattbetrieben verknüpft
sind, von den übrigen Räumen fernhalten. Die
Verbindung zwischen diesem Werkstättenhaus und
dem Hauptgebäude geschieht durch einen einge-
schossigen Trakt, der im Anschluß an die im Erd-
geschoß belegenen Tischlerwerkstätten Zeichensäle
für Tischler enthält und dessen Dach ausgenutzt
wurde zur Anlage von Pflanzenhäusern und zu
einer großen Freilichtterrasse, die nach der Ufer-
seite zu bekrönt wird von zwei für Luksch charak-
teristischen Tierplastiken. Durch diese Gruppierung
ist noch ein kleiner Innenhof entstanden, um den
ein paar Tierkäfige angeordnet sind, der außerdem
den Schülern Gelegenheit gibt, Tiere in der Be-
wegung zu studieren.
Unnötig zu sagen, daß an diesem Bau, der aus
einem so bestimmt entwickelten Programm ent-
standen ist, alles zurücktreten mußte hinter die
Zweckforderungen, von denen hier kein Jota ab-
gelassen werden konnte. Von ihnen aus erhält das
Werk Schuhmachers sein inneres Leben; aber es
ist klar, daß ein wirklicher Architekt sich damit
allein bei einer Bauaufgabe von diesem Umfang
und diesem Reiz nicht zufrieden geben konnte. Ein
Wille zur Form mußte diese Unsumme von Not-
wendigkeiten zu einem Organismus einen, es mußte
durch die architektonische Gestaltung aus diesem
vielseitigen Schulbetrieb eine ausgeglichene Einheit
werden. Mehr noch, wie diese Schule in ihrem
Lehrbetrieb nicht auf den kleinen Bedarf des Tages
beschränkt geblieben ist, so erstand auch die Pflicht
schon durch den baulichen Organismus zu doku-
mentieren, daß man hier das künstlerische Bildungs-
institut des Hamburgischen Staates vor sich habe.
Daher ein gewisses Selbstbewusstsein, ein natür-
liches Pathos, das dem Bau den repräsentativen
Klang gibt. Er hat, wie man zugeben muß, nichts
von übertriebener Wucht und lärmender Feierlich-
keit, zu denen jetzt leider mehr und mehr unsere
Baumeister entarten, wenn sie ein großes Objekt
zu bewältigen haben. Schuhmachers Formensprache
ist herb, wie es dem nordischen, dem für Hamburg
bodenständigen Backstein zukommt, und ist männ-
lich, wie es sich allein geziemt für die Gestaltung
eines so ernst bestrebten Bildungsinstituts.
Gerade weil Schuhmacher dem Bau diese archi-
tektonische Straffheit zu geben vermochte, konnte
er es wagen, seine Massen zu umsäumen mit den
dekorativen Möglichkeiten, die die Schule aus sich
heraus ihm im reichen Maße bot. Die Lehrer und
die Fachklassen konnten an ihrem Schulhaus Zeug-
nis ablegen von den Fähigkeiten, die sie als Ge-
stalter beseelen. Luksch, Czeschka, Beckerath,
Heller, Bossard, Adler, Titze usw. bieten an
den verschiedensten Stellen in diesem umfang-
reichen Bau charakteristische, mitunter wie bei
dem Czeschkaschen Grisaillefenster in der Ein-
gangshalle bestrickende Proben ihrer Art und geben
damit eine weitere Bekräftigung des in dieser Anstalt
herrschenden Leitgedankens von der Zusammenfas-
sungallerKünsteundallerGewerbe in der Architektur.
BAUDIREKTOR PROFESSOR FRITZ- SCHUMACHER. HAMBURG
Die Kunstgewerbeschule zu Hamburg. — Von der Türe zur Aula. Plastik von Prof. R. Luksch, Hamburg