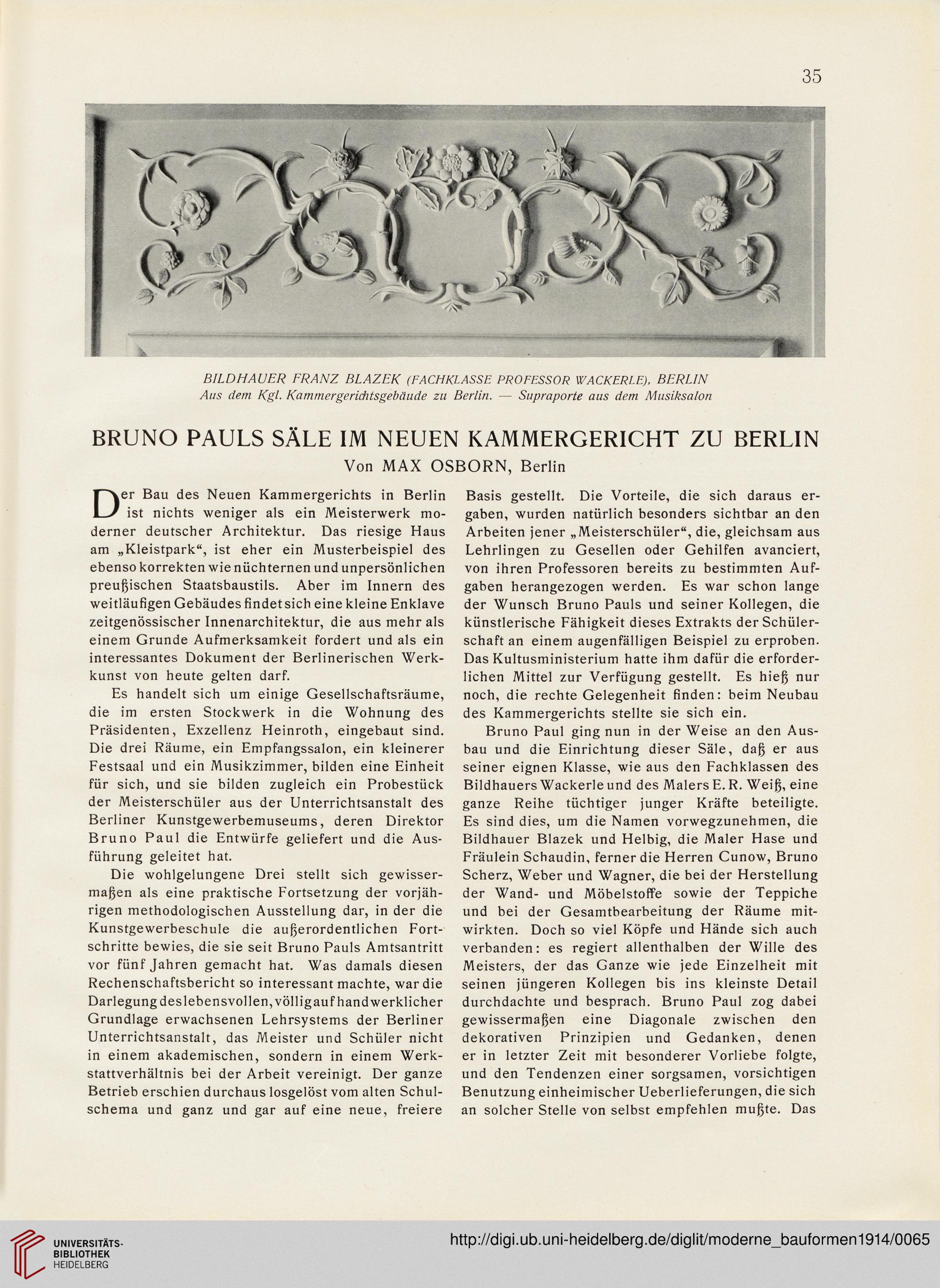35
BILDHAUER FRANZ BLAZEK (FACHKLASSE PROFESSOR WACKERLE), BERLIN
Aus dem Kgl. Kammergerichtsgebäude zu Berlin. — Supraporte aus dem Musiksalon
BRUNO PAULS SALE IM NEUEN KAMMERGERICHT ZU BERLIN
Von MAX OSBORN, Berlin
Der Bau des Neuen Kammergerichts in Berlin
ist nichts weniger als ein Meisterwerk mo-
derner deutscher Architektur. Das riesige Haus
am „Kleistpark“, ist eher ein Musterbeispiel des
ebenso korrekten wie nüchternen und unpersönlichen
preußischen Staatsbaustils. Aber im Innern des
weitläufigen Gebäudes findetsich eine kleine Enklave
zeitgenössischer Innenarchitektur, die aus mehr als
einem Grunde Aufmerksamkeit fordert und als ein
interessantes Dokument der Berlinerischen Werk-
kunst von heute gelten darf.
Es handelt sich um einige Gesellschaftsräume,
die im ersten Stockwerk in die Wohnung des
Präsidenten, Exzellenz Heinroth, eingebaut sind.
Die drei Räume, ein Empfangssalon, ein kleinerer
Festsaal und ein Musikzimmer, bilden eine Einheit
für sich, und sie bilden zugleich ein Probestück
der Meisterschüler aus der Unterrichtsanstalt des
Berliner Kunstgewerbemuseums, deren Direktor
Bruno Paul die Entwürfe geliefert und die Aus-
führung geleitet hat.
Die wohlgelungene Drei stellt sich gewisser-
maßen als eine praktische Fortsetzung der vorjäh-
rigen methodologischen Ausstellung dar, in der die
Kunstgewerbeschule die außerordentlichen Fort-
schritte bewies, die sie seit Bruno Pauls Amtsantritt
vor fünf Jahren gemacht hat. Was damals diesen
Rechenschaftsbericht so interessant machte, war die
Darlegung des lebensvollen, völlig auf handwerklicher
Grundlage erwachsenen Lehrsystems der Berliner
Unterrichtsanstalt, das Meister und Schüler nicht
in einem akademischen, sondern in einem Werk-
stattverhältnis bei der Arbeit vereinigt. Der ganze
Betrieb erschien durchaus losgelöst vom alten Schul-
schema und ganz und gar auf eine neue, freiere
Basis gestellt. Die Vorteile, die sich daraus er-
gaben, wurden natürlich besonders sichtbar an den
Arbeiten jener „Meisterschüler“, die, gleichsam aus
Lehrlingen zu Gesellen oder Gehilfen avanciert,
von ihren Professoren bereits zu bestimmten Auf-
gaben herangezogen werden. Es war schon lange
der Wunsch Bruno Pauls und seiner Kollegen, die
künstlerische Fähigkeit dieses Extrakts der Schüler-
schaft an einem augenfälligen Beispiel zu erproben.
Das Kultusministerium hatte ihm dafür die erforder-
lichen Mittel zur Verfügung gestellt. Es hieß nur
noch, die rechte Gelegenheit finden: beim Neubau
des Kammergerichts stellte sie sich ein.
Bruno Paul ging nun in der Weise an den Aus-
bau und die Einrichtung dieser Säle, daß er aus
seiner eignen Klasse, wie aus den Fachklassen des
Bildhauers Wackerle und des Malers E. R. Weiß, eine
ganze Reihe tüchtiger junger Kräfte beteiligte.
Es sind dies, um die Namen vorwegzunehmen, die
Bildhauer Blazek und Helbig, die Maler Hase und
Fräulein Schaudin, ferner die Herren Cunow, Bruno
Scherz, Weber und Wagner, die bei der Herstellung
der Wand- und Möbelstoffe sowie der Teppiche
und bei der Gesamtbearbeitung der Räume mit-
wirkten. Doch so viel Köpfe und Hände sich auch
verbanden: es regiert allenthalben der Wille des
Meisters, der das Ganze wie jede Einzelheit mit
seinen jüngeren Kollegen bis ins kleinste Detail
durchdachte und besprach. Bruno Paul zog dabei
gewissermaßen eine Diagonale zwischen den
dekorativen Prinzipien und Gedanken, denen
er in letzter Zeit mit besonderer Vorliebe folgte,
und den Tendenzen einer sorgsamen, vorsichtigen
Benutzung einheimischer Ueberlieferungen, die sich
an solcher Stelle von selbst empfehlen mußte. Das
BILDHAUER FRANZ BLAZEK (FACHKLASSE PROFESSOR WACKERLE), BERLIN
Aus dem Kgl. Kammergerichtsgebäude zu Berlin. — Supraporte aus dem Musiksalon
BRUNO PAULS SALE IM NEUEN KAMMERGERICHT ZU BERLIN
Von MAX OSBORN, Berlin
Der Bau des Neuen Kammergerichts in Berlin
ist nichts weniger als ein Meisterwerk mo-
derner deutscher Architektur. Das riesige Haus
am „Kleistpark“, ist eher ein Musterbeispiel des
ebenso korrekten wie nüchternen und unpersönlichen
preußischen Staatsbaustils. Aber im Innern des
weitläufigen Gebäudes findetsich eine kleine Enklave
zeitgenössischer Innenarchitektur, die aus mehr als
einem Grunde Aufmerksamkeit fordert und als ein
interessantes Dokument der Berlinerischen Werk-
kunst von heute gelten darf.
Es handelt sich um einige Gesellschaftsräume,
die im ersten Stockwerk in die Wohnung des
Präsidenten, Exzellenz Heinroth, eingebaut sind.
Die drei Räume, ein Empfangssalon, ein kleinerer
Festsaal und ein Musikzimmer, bilden eine Einheit
für sich, und sie bilden zugleich ein Probestück
der Meisterschüler aus der Unterrichtsanstalt des
Berliner Kunstgewerbemuseums, deren Direktor
Bruno Paul die Entwürfe geliefert und die Aus-
führung geleitet hat.
Die wohlgelungene Drei stellt sich gewisser-
maßen als eine praktische Fortsetzung der vorjäh-
rigen methodologischen Ausstellung dar, in der die
Kunstgewerbeschule die außerordentlichen Fort-
schritte bewies, die sie seit Bruno Pauls Amtsantritt
vor fünf Jahren gemacht hat. Was damals diesen
Rechenschaftsbericht so interessant machte, war die
Darlegung des lebensvollen, völlig auf handwerklicher
Grundlage erwachsenen Lehrsystems der Berliner
Unterrichtsanstalt, das Meister und Schüler nicht
in einem akademischen, sondern in einem Werk-
stattverhältnis bei der Arbeit vereinigt. Der ganze
Betrieb erschien durchaus losgelöst vom alten Schul-
schema und ganz und gar auf eine neue, freiere
Basis gestellt. Die Vorteile, die sich daraus er-
gaben, wurden natürlich besonders sichtbar an den
Arbeiten jener „Meisterschüler“, die, gleichsam aus
Lehrlingen zu Gesellen oder Gehilfen avanciert,
von ihren Professoren bereits zu bestimmten Auf-
gaben herangezogen werden. Es war schon lange
der Wunsch Bruno Pauls und seiner Kollegen, die
künstlerische Fähigkeit dieses Extrakts der Schüler-
schaft an einem augenfälligen Beispiel zu erproben.
Das Kultusministerium hatte ihm dafür die erforder-
lichen Mittel zur Verfügung gestellt. Es hieß nur
noch, die rechte Gelegenheit finden: beim Neubau
des Kammergerichts stellte sie sich ein.
Bruno Paul ging nun in der Weise an den Aus-
bau und die Einrichtung dieser Säle, daß er aus
seiner eignen Klasse, wie aus den Fachklassen des
Bildhauers Wackerle und des Malers E. R. Weiß, eine
ganze Reihe tüchtiger junger Kräfte beteiligte.
Es sind dies, um die Namen vorwegzunehmen, die
Bildhauer Blazek und Helbig, die Maler Hase und
Fräulein Schaudin, ferner die Herren Cunow, Bruno
Scherz, Weber und Wagner, die bei der Herstellung
der Wand- und Möbelstoffe sowie der Teppiche
und bei der Gesamtbearbeitung der Räume mit-
wirkten. Doch so viel Köpfe und Hände sich auch
verbanden: es regiert allenthalben der Wille des
Meisters, der das Ganze wie jede Einzelheit mit
seinen jüngeren Kollegen bis ins kleinste Detail
durchdachte und besprach. Bruno Paul zog dabei
gewissermaßen eine Diagonale zwischen den
dekorativen Prinzipien und Gedanken, denen
er in letzter Zeit mit besonderer Vorliebe folgte,
und den Tendenzen einer sorgsamen, vorsichtigen
Benutzung einheimischer Ueberlieferungen, die sich
an solcher Stelle von selbst empfehlen mußte. Das