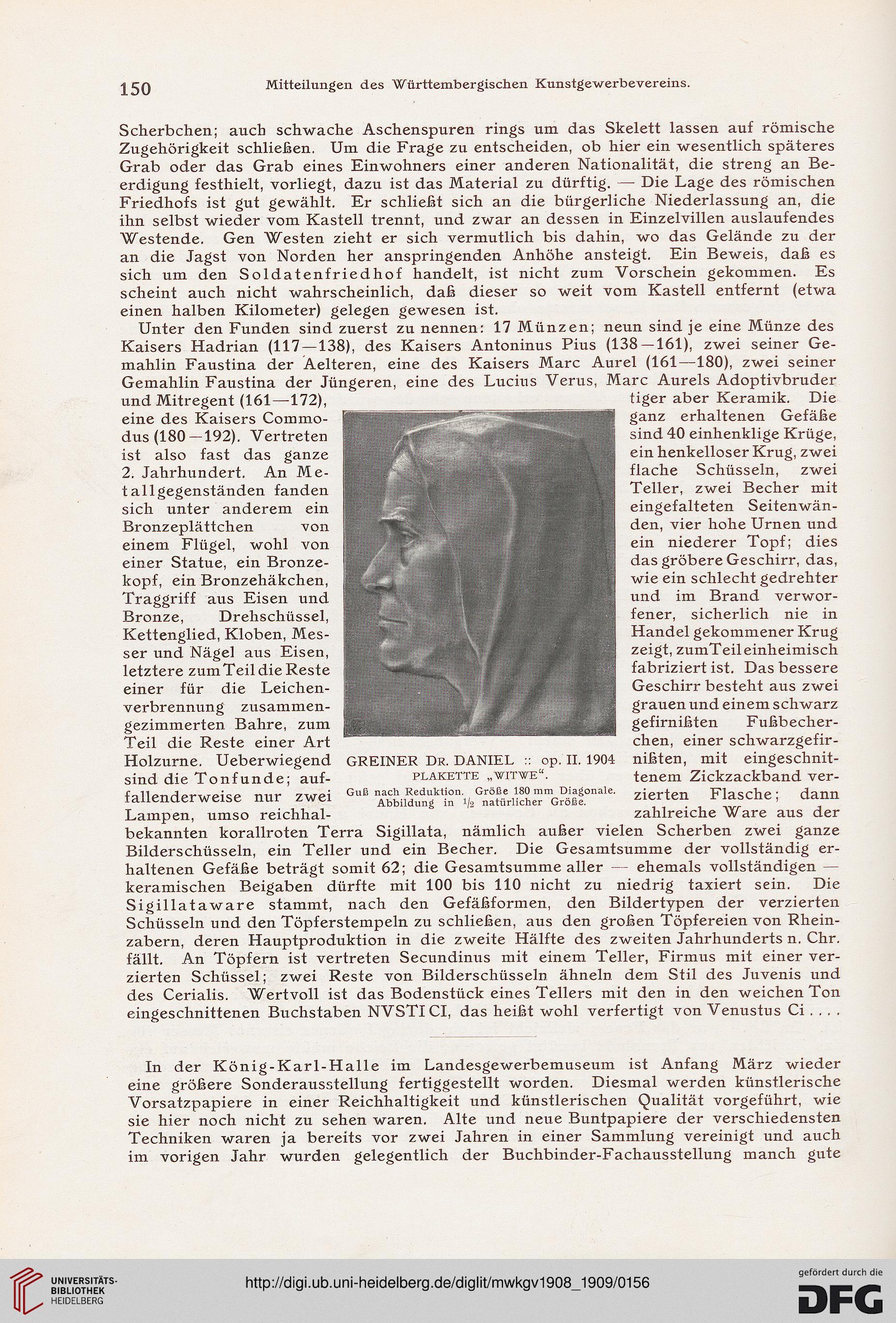150
Mitteilungen des Württembergischen Kunstgewerbevereins.
Scherbchen; auch schwache Aschenspuren rings um das Skelett lassen auf römische
Zugehörigkeit schließen. Um die Frage zu entscheiden, ob hier ein wesentlich späteres
Grab oder das Grab eines Einwohners einer anderen Nationalität, die streng an Be-
erdigung festhielt, vorliegt, dazu ist das Material zu dürftig. — Die Lage des römischen
Friedhofs ist gut gewählt. Er schließt sich an die bürgerliche Niederlassung an, die
ihn selbst wieder vom Kastell trennt, und zwar an dessen in Einzelvillen auslaufendes
Westende. Gen "Westen zieht er sich vermutlich bis dahin, wo das Gelände zu der
an die Jagst von Norden her anspringenden Anhöhe ansteigt. Ein Beweis, daß es
sich um den Soldatenfriedhof handelt, ist nicht zum Vorschein gekommen. Es
scheint auch nicht wahrscheinlich, daß dieser so weit vom Kastell entfernt (etwa
einen halben Kilometer) gelegen gewesen ist.
Unter den Funden sind zuerst zu nennen: 17 Münzen; neun sind je eine Münze des
Kaisers Hadrian (117 —138), des Kaisers Antoninus Pius (138 — 161), zwei seiner Ge-
mahlin Faustina der Aelteren, eine des Kaisers Marc Aurel (161—180), zwei seiner
Gemahlin Faustina der Jüngeren, eine des Lucius Verus, Marc Aurels Adoptivbruder
und Mitregent (161—172),
eine des Kaisers Commo-
dus (180 -192). Vertreten
ist also fast das ganze
2. Jahrhundert. An Me-
tallgegenständen fanden
sich unter anderem ein
Bronzeplättchen von
einem Flügel, wohl von
einer Statue, ein Bronze-
kopf, ein Bronzehäkchen,
Traggriff aus Eisen und
Bronze, Drehschüssel,
Kettenglied, Kloben, Mes-
ser und Nägel aus Eisen,
letztere zumTeil die Reste
einer für die Leichen-
verbrennung zusammen-
gezimmerten Bahre, zum
Teil die Reste einer Art
Holzurne. Ueberwiegend
sind die Tonf unde; auf-
fallenderweise mir zwei
Lampen, umso reichhal-
GREINER Dr. DANIEL :: op. II. 1904
PLAKETTE „WITWE".
Guß nach Reduktion. Größe 180 mm Diagonale.
Abbildung in 1/2 natürlicher Größe.
tiger aber Keramik. Die
ganz erhaltenen Gefäße
sind 40 einhenklige Krüge,
ein henkelloser Krug, zwei
flache Schüsseln, zwei
Teller, zwei Becher mit
eingefalteten Seitenwän-
den, vier hohe Urnen und
ein niederer Topf; dies
das gröbere Geschirr, das,
wie ein schlecht gedrehter
und im Brand verwor-
fener, sicherlich nie in
Handel gekommener Krug
zeigt, zumTeil einheimisch
fabriziert ist. Das bessere
Geschirr besteht aus zwei
grauen und einem schwarz
gefirnißten Fußbecher-
chen, einer schwarzgefir-
nißten, mit eingeschnit-
tenem Zickzackband ver-
zierten Flasche; dann
zahlreiche "Ware aus der
vielen Scherben zwei ganze
bekannten korallroten Terra Sigillata, nämlich außer
Bilderschüsseln, ein Teller und ein Becher. Die Gesamtsumme der vollständig er-
haltenen Gefäße beträgt somit 62; die Gesamtsumme aller — ehemals vollständigen
keramischen Beigaben dürfte mit 100 bis 110 nicht zu niedrig taxiert sein. Die
Sigillataware stammt, nach den Gefäßformen, den Bildertypen der verzierten
Schüsseln und den Töpferstempeln zu schließen, aus den großen Töpfereien von Rhein-
zabern, deren Hauptproduktion in die zweite Hälfte des zweiten Jahrhunderts n. Chr.
fällt. An Töpfern ist vertreten Secundimis mit einem Teller, Firmus mit einer ver-
zierten Schüssel; zwei Reste von Bilderschüsseln ähneln dem Stil des Juvenis und
des Cerialis. Wertvoll ist das Bodenstück eines Tellers mit den in den weichen Ton
eingeschnittenen Buchstaben NVSTI CI, das heißt wohl verfertigt von Venustus Ci . . . .
In der König-Karl-Halle im Landesgewerbemuseum ist Anfang März wieder
eine größere Sonderausstellung fertiggestellt worden. Diesmal werden künstlerische
Vorsatzpapiere in einer Reichhaltigkeit und künstlerischen Qualität vorgeführt, wie
sie hier noch nicht zu sehen waren. Alte und neue Buntpapiere der verschiedensten
Techniken waren ja bereits vor zwei Jahren in einer Sammlung vereinigt und auch
im vorigen Jahr wurden gelegentlich der Buchbinder-Fachausstellung manch gute
Mitteilungen des Württembergischen Kunstgewerbevereins.
Scherbchen; auch schwache Aschenspuren rings um das Skelett lassen auf römische
Zugehörigkeit schließen. Um die Frage zu entscheiden, ob hier ein wesentlich späteres
Grab oder das Grab eines Einwohners einer anderen Nationalität, die streng an Be-
erdigung festhielt, vorliegt, dazu ist das Material zu dürftig. — Die Lage des römischen
Friedhofs ist gut gewählt. Er schließt sich an die bürgerliche Niederlassung an, die
ihn selbst wieder vom Kastell trennt, und zwar an dessen in Einzelvillen auslaufendes
Westende. Gen "Westen zieht er sich vermutlich bis dahin, wo das Gelände zu der
an die Jagst von Norden her anspringenden Anhöhe ansteigt. Ein Beweis, daß es
sich um den Soldatenfriedhof handelt, ist nicht zum Vorschein gekommen. Es
scheint auch nicht wahrscheinlich, daß dieser so weit vom Kastell entfernt (etwa
einen halben Kilometer) gelegen gewesen ist.
Unter den Funden sind zuerst zu nennen: 17 Münzen; neun sind je eine Münze des
Kaisers Hadrian (117 —138), des Kaisers Antoninus Pius (138 — 161), zwei seiner Ge-
mahlin Faustina der Aelteren, eine des Kaisers Marc Aurel (161—180), zwei seiner
Gemahlin Faustina der Jüngeren, eine des Lucius Verus, Marc Aurels Adoptivbruder
und Mitregent (161—172),
eine des Kaisers Commo-
dus (180 -192). Vertreten
ist also fast das ganze
2. Jahrhundert. An Me-
tallgegenständen fanden
sich unter anderem ein
Bronzeplättchen von
einem Flügel, wohl von
einer Statue, ein Bronze-
kopf, ein Bronzehäkchen,
Traggriff aus Eisen und
Bronze, Drehschüssel,
Kettenglied, Kloben, Mes-
ser und Nägel aus Eisen,
letztere zumTeil die Reste
einer für die Leichen-
verbrennung zusammen-
gezimmerten Bahre, zum
Teil die Reste einer Art
Holzurne. Ueberwiegend
sind die Tonf unde; auf-
fallenderweise mir zwei
Lampen, umso reichhal-
GREINER Dr. DANIEL :: op. II. 1904
PLAKETTE „WITWE".
Guß nach Reduktion. Größe 180 mm Diagonale.
Abbildung in 1/2 natürlicher Größe.
tiger aber Keramik. Die
ganz erhaltenen Gefäße
sind 40 einhenklige Krüge,
ein henkelloser Krug, zwei
flache Schüsseln, zwei
Teller, zwei Becher mit
eingefalteten Seitenwän-
den, vier hohe Urnen und
ein niederer Topf; dies
das gröbere Geschirr, das,
wie ein schlecht gedrehter
und im Brand verwor-
fener, sicherlich nie in
Handel gekommener Krug
zeigt, zumTeil einheimisch
fabriziert ist. Das bessere
Geschirr besteht aus zwei
grauen und einem schwarz
gefirnißten Fußbecher-
chen, einer schwarzgefir-
nißten, mit eingeschnit-
tenem Zickzackband ver-
zierten Flasche; dann
zahlreiche "Ware aus der
vielen Scherben zwei ganze
bekannten korallroten Terra Sigillata, nämlich außer
Bilderschüsseln, ein Teller und ein Becher. Die Gesamtsumme der vollständig er-
haltenen Gefäße beträgt somit 62; die Gesamtsumme aller — ehemals vollständigen
keramischen Beigaben dürfte mit 100 bis 110 nicht zu niedrig taxiert sein. Die
Sigillataware stammt, nach den Gefäßformen, den Bildertypen der verzierten
Schüsseln und den Töpferstempeln zu schließen, aus den großen Töpfereien von Rhein-
zabern, deren Hauptproduktion in die zweite Hälfte des zweiten Jahrhunderts n. Chr.
fällt. An Töpfern ist vertreten Secundimis mit einem Teller, Firmus mit einer ver-
zierten Schüssel; zwei Reste von Bilderschüsseln ähneln dem Stil des Juvenis und
des Cerialis. Wertvoll ist das Bodenstück eines Tellers mit den in den weichen Ton
eingeschnittenen Buchstaben NVSTI CI, das heißt wohl verfertigt von Venustus Ci . . . .
In der König-Karl-Halle im Landesgewerbemuseum ist Anfang März wieder
eine größere Sonderausstellung fertiggestellt worden. Diesmal werden künstlerische
Vorsatzpapiere in einer Reichhaltigkeit und künstlerischen Qualität vorgeführt, wie
sie hier noch nicht zu sehen waren. Alte und neue Buntpapiere der verschiedensten
Techniken waren ja bereits vor zwei Jahren in einer Sammlung vereinigt und auch
im vorigen Jahr wurden gelegentlich der Buchbinder-Fachausstellung manch gute