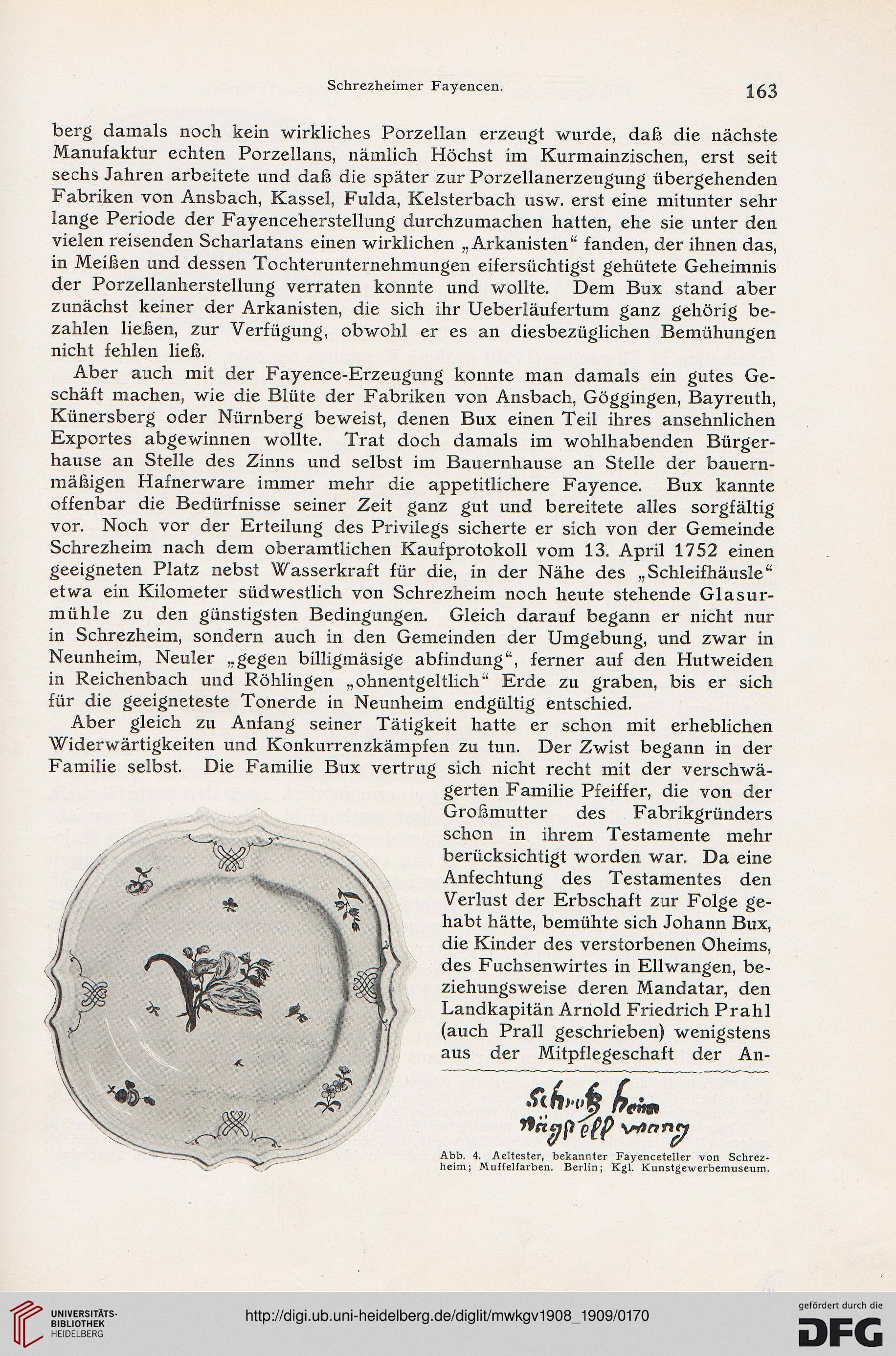Schrezheimer Fayencen.
163
berg damals noch kein wirkliches Porzellan erzeugt wurde, daß die nächste
Manufaktur echten Porzellans, nämlich Höchst im Kurmainzischen, erst seit
sechs Jahren arbeitete und daß die später zur Porzellanerzeugung übergehenden
Fabriken von Ansbach, Kassel, Fulda, Kelsterbach usw. erst eine mitunter sehr
lange Periode der Fayenceherstellung durchzumachen hatten, ehe sie unter den
vielen reisenden Scharlatans einen wirklichen „Arkanisten" fanden, der ihnen das,
in Meißen und dessen Tochterunternehmungen eifersüchtigst gehütete Geheimnis
der Porzellanherstellung verraten konnte und wollte. Dem Bux stand aber
zunächst keiner der Arkanisten, die sich ihr Ueberläufertum ganz gehörig be-
zahlen ließen, zur Verfügung, obwohl er es an diesbezüglichen Bemühungen
nicht fehlen ließ.
Aber auch mit der Fayence-Erzeugung konnte man damals ein gutes Ge-
schäft machen, wie die Blüte der Fabriken von Ansbach, Göggingen, Bayreuth,
Künersberg oder Nürnberg beweist, denen Bux einen Teil ihres ansehnlichen
Exportes abgewinnen wollte. Trat doch damals im wohlhabenden Bürger-
hause an Stelle des Zinns und selbst im Bauernhause an Stelle der bauern-
mäßigen Hafnerware immer mehr die appetitlichere Fayence. Bux kannte
offenbar die Bedürfnisse seiner Zeit ganz gut und bereitete alles sorgfältig
vor. Noch vor der Erteilung des Privilegs sicherte er sich von der Gemeinde
Schrezheim nach dem oberamtlichen Kaufprotokoll vom 13. April 1752 einen
geeigneten Platz nebst Wasserkraft für die, in der Nähe des „ Schleifhäusle"
etwa ein Kilometer südwestlich von Schrezheim noch heute stehende Glasur-
mühle zu den günstigsten Bedingungen. Gleich darauf begann er nicht nur
in Schrezheim, sondern auch in den Gemeinden der Umgebung, und zwar in
Neunheim, Neuler „gegen billigmäsige abfindung", ferner auf den Hutweiden
in Reichenbach und Röhlingen „ohnentgeltlich" Erde zu graben, bis er sich
für die geeigneteste Tonerde in Neunheim endgültig entschied.
Aber gleich zu Anfang seiner Tätigkeit hatte er schon mit erheblichen
Widerwärtigkeiten und Konkurrenzkämpfen zu tun. Der Zwist begann in der
Familie selbst. Die Familie Bux vertrug sich nicht recht mit der verschwä-
gerten Familie Pfeiffer, die von der
Großmutter des Fabrikgründers
schon in ihrem Testamente mehr
berücksichtigt worden war. Da eine
Anfechtung des Testamentes den
Verlust der Erbschaft zur Folge ge-
habt hätte, bemühte sich Johann Bux,
die Kinder des verstorbenen Oheims,
des Fuchsenwirtes in Ellwangen, be-
ziehungsweise deren Mandatar, den
Landkapitän Arnold Friedrich Prahl
(auch Prall geschrieben) wenigstens
aus der Mitpflegeschaft der An-
Abb. 4. Aeltester, bekannter Fayenceteller von Schrez-
heim; Muffelfarben. Berlin; Kgl. Kunstgewerbemuseum.
163
berg damals noch kein wirkliches Porzellan erzeugt wurde, daß die nächste
Manufaktur echten Porzellans, nämlich Höchst im Kurmainzischen, erst seit
sechs Jahren arbeitete und daß die später zur Porzellanerzeugung übergehenden
Fabriken von Ansbach, Kassel, Fulda, Kelsterbach usw. erst eine mitunter sehr
lange Periode der Fayenceherstellung durchzumachen hatten, ehe sie unter den
vielen reisenden Scharlatans einen wirklichen „Arkanisten" fanden, der ihnen das,
in Meißen und dessen Tochterunternehmungen eifersüchtigst gehütete Geheimnis
der Porzellanherstellung verraten konnte und wollte. Dem Bux stand aber
zunächst keiner der Arkanisten, die sich ihr Ueberläufertum ganz gehörig be-
zahlen ließen, zur Verfügung, obwohl er es an diesbezüglichen Bemühungen
nicht fehlen ließ.
Aber auch mit der Fayence-Erzeugung konnte man damals ein gutes Ge-
schäft machen, wie die Blüte der Fabriken von Ansbach, Göggingen, Bayreuth,
Künersberg oder Nürnberg beweist, denen Bux einen Teil ihres ansehnlichen
Exportes abgewinnen wollte. Trat doch damals im wohlhabenden Bürger-
hause an Stelle des Zinns und selbst im Bauernhause an Stelle der bauern-
mäßigen Hafnerware immer mehr die appetitlichere Fayence. Bux kannte
offenbar die Bedürfnisse seiner Zeit ganz gut und bereitete alles sorgfältig
vor. Noch vor der Erteilung des Privilegs sicherte er sich von der Gemeinde
Schrezheim nach dem oberamtlichen Kaufprotokoll vom 13. April 1752 einen
geeigneten Platz nebst Wasserkraft für die, in der Nähe des „ Schleifhäusle"
etwa ein Kilometer südwestlich von Schrezheim noch heute stehende Glasur-
mühle zu den günstigsten Bedingungen. Gleich darauf begann er nicht nur
in Schrezheim, sondern auch in den Gemeinden der Umgebung, und zwar in
Neunheim, Neuler „gegen billigmäsige abfindung", ferner auf den Hutweiden
in Reichenbach und Röhlingen „ohnentgeltlich" Erde zu graben, bis er sich
für die geeigneteste Tonerde in Neunheim endgültig entschied.
Aber gleich zu Anfang seiner Tätigkeit hatte er schon mit erheblichen
Widerwärtigkeiten und Konkurrenzkämpfen zu tun. Der Zwist begann in der
Familie selbst. Die Familie Bux vertrug sich nicht recht mit der verschwä-
gerten Familie Pfeiffer, die von der
Großmutter des Fabrikgründers
schon in ihrem Testamente mehr
berücksichtigt worden war. Da eine
Anfechtung des Testamentes den
Verlust der Erbschaft zur Folge ge-
habt hätte, bemühte sich Johann Bux,
die Kinder des verstorbenen Oheims,
des Fuchsenwirtes in Ellwangen, be-
ziehungsweise deren Mandatar, den
Landkapitän Arnold Friedrich Prahl
(auch Prall geschrieben) wenigstens
aus der Mitpflegeschaft der An-
Abb. 4. Aeltester, bekannter Fayenceteller von Schrez-
heim; Muffelfarben. Berlin; Kgl. Kunstgewerbemuseum.