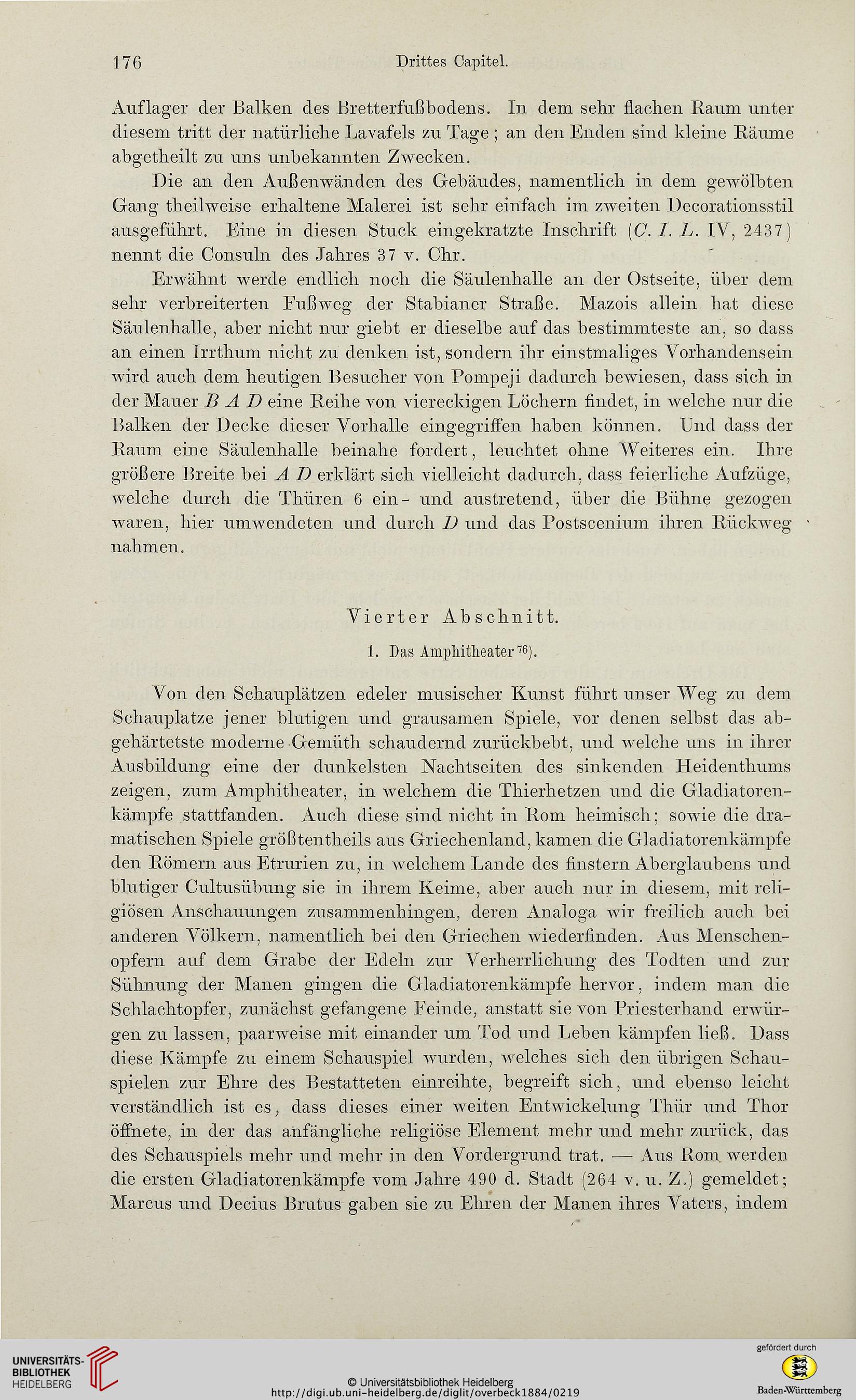176
Drittes Capitel.
Auflager der Balken des Bretterfußbodens. In dem sehr flachen Raum unter
diesem tritt der natürliche Lavafels zu Tage ; an den Enden sind kleine Räume
abgetheilt zu uns unbekannten Zwecken.
Die an den Außenwänden des Gebäudes, namentlich in dem geAvölbten
Gang theilweise erhaltene Malerei ist sehr einfach im zweiten Decorationsstil
ausgeführt. Eine in diesen Stuck eingekratzte Inschrift [C. I. L. IV, 2437)
nennt die Gonsuln des Jahres 37 v. Chr.
Erwähnt werde endlich noch die Säulenhalle an der Ostseite, über dem
sehr verbreiterten Fußweg der Stabianer Straße. Mazois allein hat diese
Säulenhalle, aber nicht nur giebt er dieselbe auf das bestimmteste an, so dass
an einen Irrthum nicht zu denken ist, sondern ihr einstmaliges Vorhandensein
wird auch dem heutigen Besucher von Pompeji dadurch bewiesen, dass sich in
der Mauer BAD eine Reihe von viereckigen Löchern findet, in welche nur die
Balken der Decke dieser Vorhalle eingegriffen haben können. Und dass der
Raum eine Säulenhalle beinahe fordert, leuchtet ohne Weiteres ein. Ihre
größere Breite bei A D erklärt sich vielleicht dadurch, dass feierliche Aufzüge,
welche durch die Thüren 6 ein- und austretend, über die Bühne gezogen
waren, hier umwendeten und durch D und das Postscenium ihren Rückweg
nahmen.
Vierter Abschnitt.
1. Das Amphitheater76).
Von den Schauplätzen edeler musischer Kunst führt unser Weg zu dem
Schauplatze jener blutigen und grausamen Spiele, vor denen selbst das ab-
gehärtetste moderne -Gemfi th schaudernd zurückbebt, und welche uns in ihrer
Ausbildung eine der dunkelsten Nachtseiten des sinkenden Heidenthums
zeigen, zum Amphitheater, in Avelchem die Thierhetzen und die Gladiatoren-
kämpfe stattfanden. Auch diese sind nicht in Rom heimisch; soAvie die dra-
matischen Spiele großtentheils aus Griechenland, kamen die Gladiatorenkämpfe
den Römern aus Etrurien zu, in welchem Lande des finstern Aberglaubens und
blutiger Cultusübung sie in ihrem Keime, aber auch nur in diesem, mit reli-
giösen Anschauungen zusammenhingen, deren Analoga wir freilich auch bei
anderen Völkern, namentlich bei den Griechen wiederfinden. Aus Menschen-
opfern auf dem Grabe der Edeln zur Verherrlichung des Todten und zur
Sühnung der Manen gingen die Gladiatorenkämpfe hervor, indem man die
Schlachtopfer, zunächst gefangene Feinde, anstatt sie von Priesterhand erwür-
gen zu lassen, paarweise mit einander um Tod und Leben kämpfen ließ. Dass
diese Kämpfe zu einem Schauspiel wurden, welches sich den übrigen Schau-
spielen zur Ehre des Bestatteten einreihte, begreift sich, und ebenso leicht
verständlich ist es, dass dieses einer weiten EntAvickelung Thür und Thor
öffnete, in der das anfängliche religiöse Element mehr und mehr zurück, das
des Schauspiels mehr und mehr in den Vordergrund trat. — Aus Rom werden
die ersten Gladiatorenkämpfe vom Jahre 490 d. Stadt (264 v. u. Z.) gemeldet;
Marcus und Decius Brutus gaben sie zu Ehren der Manen ihres Vaters, indem
Drittes Capitel.
Auflager der Balken des Bretterfußbodens. In dem sehr flachen Raum unter
diesem tritt der natürliche Lavafels zu Tage ; an den Enden sind kleine Räume
abgetheilt zu uns unbekannten Zwecken.
Die an den Außenwänden des Gebäudes, namentlich in dem geAvölbten
Gang theilweise erhaltene Malerei ist sehr einfach im zweiten Decorationsstil
ausgeführt. Eine in diesen Stuck eingekratzte Inschrift [C. I. L. IV, 2437)
nennt die Gonsuln des Jahres 37 v. Chr.
Erwähnt werde endlich noch die Säulenhalle an der Ostseite, über dem
sehr verbreiterten Fußweg der Stabianer Straße. Mazois allein hat diese
Säulenhalle, aber nicht nur giebt er dieselbe auf das bestimmteste an, so dass
an einen Irrthum nicht zu denken ist, sondern ihr einstmaliges Vorhandensein
wird auch dem heutigen Besucher von Pompeji dadurch bewiesen, dass sich in
der Mauer BAD eine Reihe von viereckigen Löchern findet, in welche nur die
Balken der Decke dieser Vorhalle eingegriffen haben können. Und dass der
Raum eine Säulenhalle beinahe fordert, leuchtet ohne Weiteres ein. Ihre
größere Breite bei A D erklärt sich vielleicht dadurch, dass feierliche Aufzüge,
welche durch die Thüren 6 ein- und austretend, über die Bühne gezogen
waren, hier umwendeten und durch D und das Postscenium ihren Rückweg
nahmen.
Vierter Abschnitt.
1. Das Amphitheater76).
Von den Schauplätzen edeler musischer Kunst führt unser Weg zu dem
Schauplatze jener blutigen und grausamen Spiele, vor denen selbst das ab-
gehärtetste moderne -Gemfi th schaudernd zurückbebt, und welche uns in ihrer
Ausbildung eine der dunkelsten Nachtseiten des sinkenden Heidenthums
zeigen, zum Amphitheater, in Avelchem die Thierhetzen und die Gladiatoren-
kämpfe stattfanden. Auch diese sind nicht in Rom heimisch; soAvie die dra-
matischen Spiele großtentheils aus Griechenland, kamen die Gladiatorenkämpfe
den Römern aus Etrurien zu, in welchem Lande des finstern Aberglaubens und
blutiger Cultusübung sie in ihrem Keime, aber auch nur in diesem, mit reli-
giösen Anschauungen zusammenhingen, deren Analoga wir freilich auch bei
anderen Völkern, namentlich bei den Griechen wiederfinden. Aus Menschen-
opfern auf dem Grabe der Edeln zur Verherrlichung des Todten und zur
Sühnung der Manen gingen die Gladiatorenkämpfe hervor, indem man die
Schlachtopfer, zunächst gefangene Feinde, anstatt sie von Priesterhand erwür-
gen zu lassen, paarweise mit einander um Tod und Leben kämpfen ließ. Dass
diese Kämpfe zu einem Schauspiel wurden, welches sich den übrigen Schau-
spielen zur Ehre des Bestatteten einreihte, begreift sich, und ebenso leicht
verständlich ist es, dass dieses einer weiten EntAvickelung Thür und Thor
öffnete, in der das anfängliche religiöse Element mehr und mehr zurück, das
des Schauspiels mehr und mehr in den Vordergrund trat. — Aus Rom werden
die ersten Gladiatorenkämpfe vom Jahre 490 d. Stadt (264 v. u. Z.) gemeldet;
Marcus und Decius Brutus gaben sie zu Ehren der Manen ihres Vaters, indem