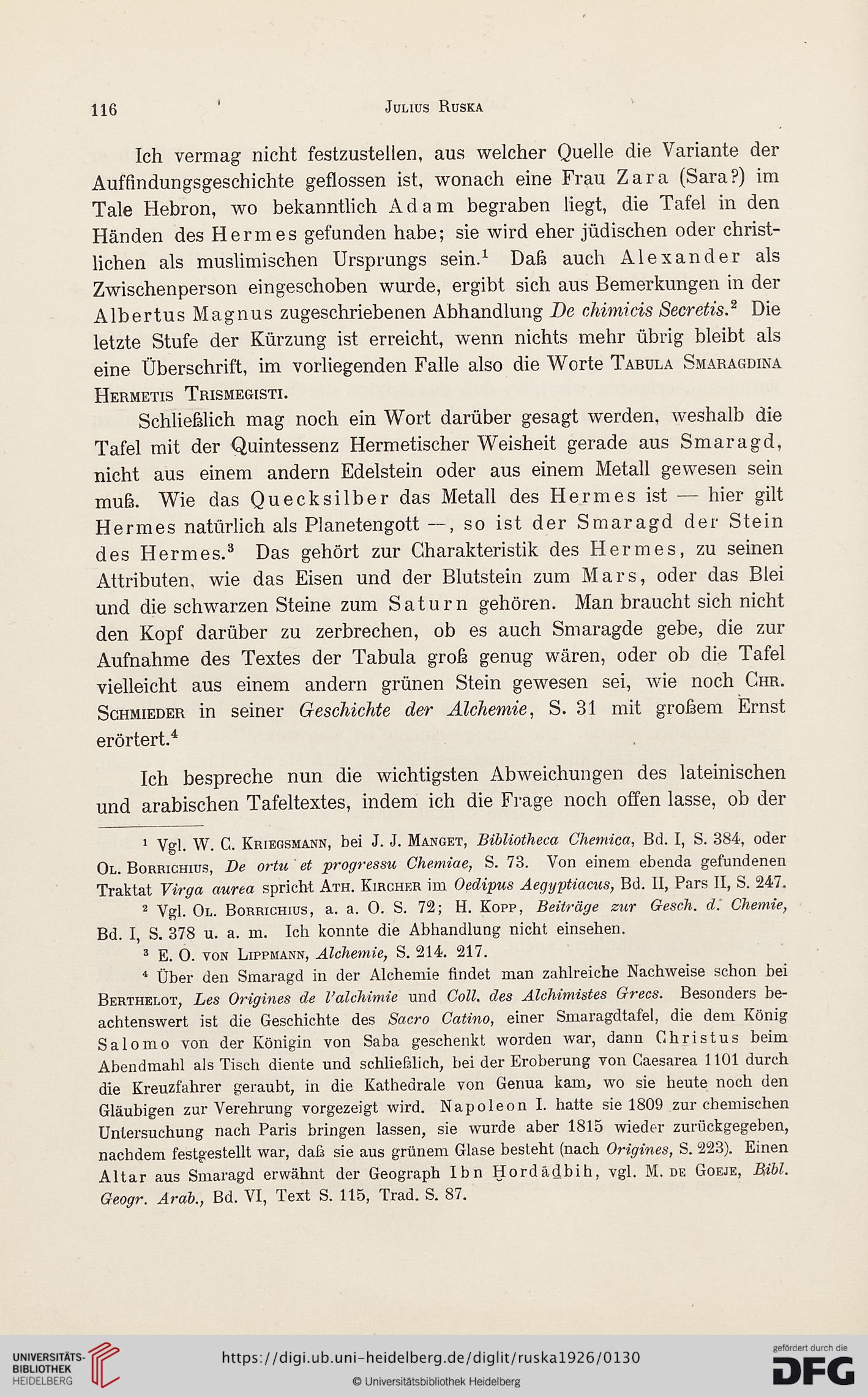116
Julius Ruska
Ich vermag nicht festzustellen, aus welcher Quelle die Variante der
Auffindungsgeschichte geflossen ist, wonach eine Frau Zara (Sara?) im
Tale Hebron, wo bekanntlich Adam begraben liegt, die Tafel in den
Händen des Hermes gefunden habe; sie wird eher jüdischen oder christ-
lichen als muslimischen Ursprungs sein.1 Daß auch Alexander als
Zwischenperson eingeschoben wurde, ergibt sich aus Bemerkungen in der
Albertus Magnus zugeschriebenen Abhandlung De chimicis Secretis.2 Die
letzte Stufe der Kürzung ist erreicht, wenn nichts mehr übrig bleibt als
eine Überschrift, im vorliegenden Falle also die Worte Tabula Smaragdina
Hermetis Trismegisti.
Schließlich mag noch ein Wort darüber gesagt werden, weshalb die
Tafel mit der Quintessenz Hermetischer Weisheit gerade aus Smaragd,
nicht aus einem andern Edelstein oder aus einem Metall gewesen sein
muß. Wie das Quecksilber das Metall des Hermes ist -— hier gilt
Hermes natürlich als Planetengott —, so ist der Smaragd der Stein
des Hermes.3 Das gehört zur Charakteristik des Hermes, zu seinen
Attributen, wie das Eisen und der Blutstein zum Mars, oder das Blei
und die schwarzen Steine zum Saturn gehören. Man braucht sich nicht
den Kopf darüber zu zerbrechen, ob es auch Smaragde gebe, die zur
Aufnahme des Textes der Tabula groß genug wären, oder ob die Tafel
vielleicht aus einem andern grünen Stein gewesen sei, wie noch Chr.
Schmieder in seiner Geschichte der Alchemie, S. 31 mit großem Ernst
erörtert.4
Ich bespreche nun die wichtigsten Abweichungen des lateinischen
und arabischen Tafeltextes, indem ich die Frage noch offen lasse, ob der
1 Vgl. W. G. Kriegsmann, bei J. J. Manget, Bibliotheca Chemica, Bd. I, S. 384, oder
Ol. Borrichius, De ortu et progressu Che.miae, S. 73. Von einem ebenda gefundenen
Traktat Virga awrea spricht Ath. Kircher im Oedipus Aegyptiacus, Bd. II, Pars II, S. 247.
2 Vgl. Ol. Borrichius, a. a. 0. S. 72; H. Kopp, Beiträge zur Gescih. d. Chemie,
Bd. I, S. 378 u. a. m. Ich konnte die Abhandlung nicht einsehen.
3 E. O. von Lippmann, Alchemie, S. 214. 217.
4 Über den Smaragd in der Alchemie findet man zahlreiche Nachweise schon bei
Berthelot, Les Origines de l’alchimie und Coll, des Alchimistes Grecs. Besonders be-
achtenswert ist die Geschichte des Sacro Catino, einer Smaragdtafel, die dem König
Salomo von der Königin von Saba geschenkt worden war, dann Ghristus beim
Abendmahl als Tisch diente und schließlich, bei der Eroberung von Caesarea 1101 durch
die Kreuzfahrer geraubt, in die Kathedrale von Genua kam, wo sie heute noch den
Gläubigen zur Verehrung vorgezeigt wird. Napoleon I. hatte sie 1809 zur chemischen
Untersuchung nach Paris bringen lassen, sie wurde aber 1815 wieder zurückgegeben,
nachdem festgestellt war, daß sie aus grünem Glase besteht (nach Origines, S. 223). Einen
Altar aus Smaragd erwähnt der Geograph Ibn Hordädbih, vgl. Μ. de Goeje, Bibi.
Geogr. Arab., Bd. VI, Text S. 115, Trad. S. 87.
Julius Ruska
Ich vermag nicht festzustellen, aus welcher Quelle die Variante der
Auffindungsgeschichte geflossen ist, wonach eine Frau Zara (Sara?) im
Tale Hebron, wo bekanntlich Adam begraben liegt, die Tafel in den
Händen des Hermes gefunden habe; sie wird eher jüdischen oder christ-
lichen als muslimischen Ursprungs sein.1 Daß auch Alexander als
Zwischenperson eingeschoben wurde, ergibt sich aus Bemerkungen in der
Albertus Magnus zugeschriebenen Abhandlung De chimicis Secretis.2 Die
letzte Stufe der Kürzung ist erreicht, wenn nichts mehr übrig bleibt als
eine Überschrift, im vorliegenden Falle also die Worte Tabula Smaragdina
Hermetis Trismegisti.
Schließlich mag noch ein Wort darüber gesagt werden, weshalb die
Tafel mit der Quintessenz Hermetischer Weisheit gerade aus Smaragd,
nicht aus einem andern Edelstein oder aus einem Metall gewesen sein
muß. Wie das Quecksilber das Metall des Hermes ist -— hier gilt
Hermes natürlich als Planetengott —, so ist der Smaragd der Stein
des Hermes.3 Das gehört zur Charakteristik des Hermes, zu seinen
Attributen, wie das Eisen und der Blutstein zum Mars, oder das Blei
und die schwarzen Steine zum Saturn gehören. Man braucht sich nicht
den Kopf darüber zu zerbrechen, ob es auch Smaragde gebe, die zur
Aufnahme des Textes der Tabula groß genug wären, oder ob die Tafel
vielleicht aus einem andern grünen Stein gewesen sei, wie noch Chr.
Schmieder in seiner Geschichte der Alchemie, S. 31 mit großem Ernst
erörtert.4
Ich bespreche nun die wichtigsten Abweichungen des lateinischen
und arabischen Tafeltextes, indem ich die Frage noch offen lasse, ob der
1 Vgl. W. G. Kriegsmann, bei J. J. Manget, Bibliotheca Chemica, Bd. I, S. 384, oder
Ol. Borrichius, De ortu et progressu Che.miae, S. 73. Von einem ebenda gefundenen
Traktat Virga awrea spricht Ath. Kircher im Oedipus Aegyptiacus, Bd. II, Pars II, S. 247.
2 Vgl. Ol. Borrichius, a. a. 0. S. 72; H. Kopp, Beiträge zur Gescih. d. Chemie,
Bd. I, S. 378 u. a. m. Ich konnte die Abhandlung nicht einsehen.
3 E. O. von Lippmann, Alchemie, S. 214. 217.
4 Über den Smaragd in der Alchemie findet man zahlreiche Nachweise schon bei
Berthelot, Les Origines de l’alchimie und Coll, des Alchimistes Grecs. Besonders be-
achtenswert ist die Geschichte des Sacro Catino, einer Smaragdtafel, die dem König
Salomo von der Königin von Saba geschenkt worden war, dann Ghristus beim
Abendmahl als Tisch diente und schließlich, bei der Eroberung von Caesarea 1101 durch
die Kreuzfahrer geraubt, in die Kathedrale von Genua kam, wo sie heute noch den
Gläubigen zur Verehrung vorgezeigt wird. Napoleon I. hatte sie 1809 zur chemischen
Untersuchung nach Paris bringen lassen, sie wurde aber 1815 wieder zurückgegeben,
nachdem festgestellt war, daß sie aus grünem Glase besteht (nach Origines, S. 223). Einen
Altar aus Smaragd erwähnt der Geograph Ibn Hordädbih, vgl. Μ. de Goeje, Bibi.
Geogr. Arab., Bd. VI, Text S. 115, Trad. S. 87.