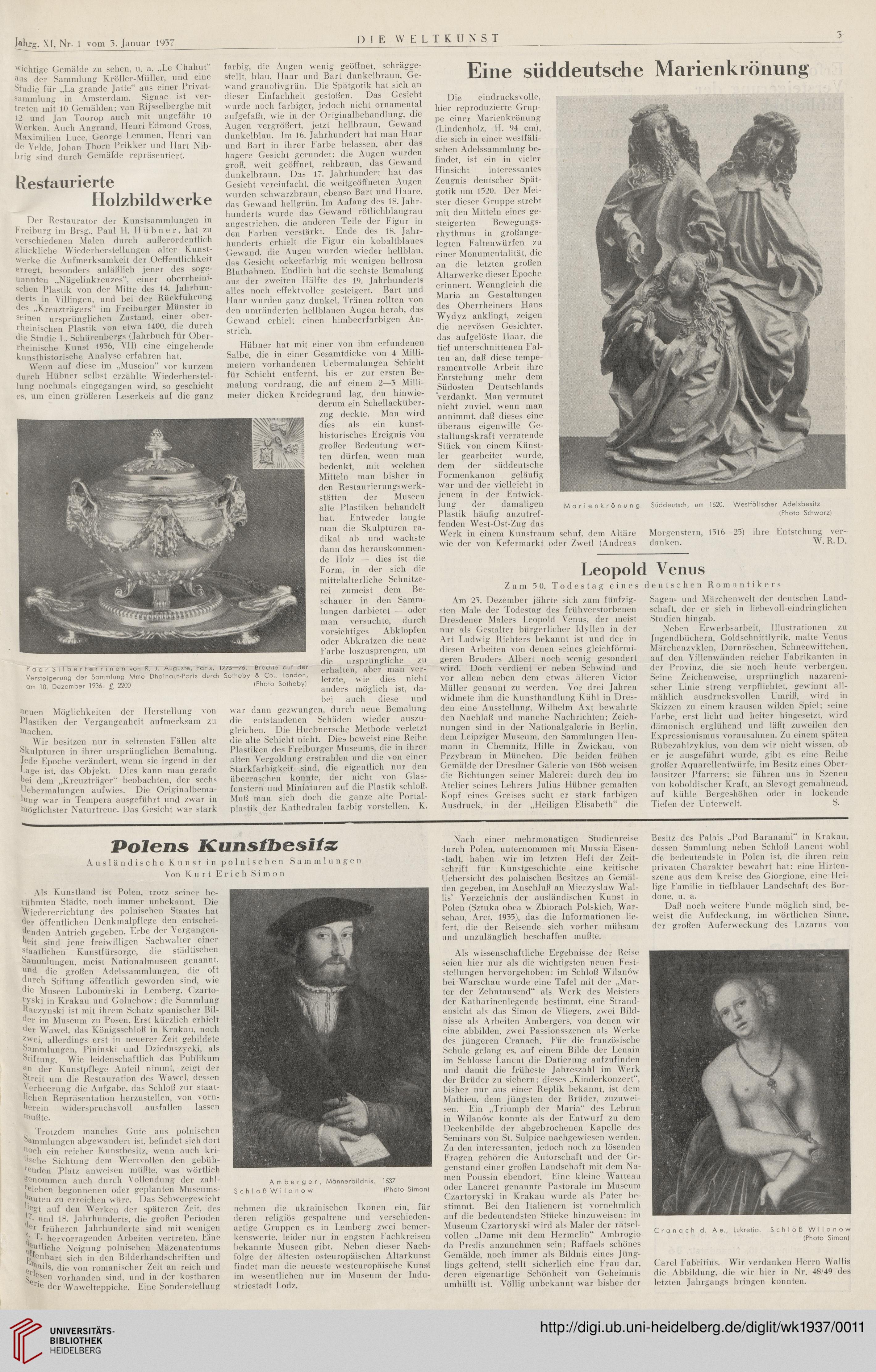DIE WELTKUNST
Jah.rg. XI, Nr. 1 vom 5. Januar 1957
wichtige Gemälde zu sehen, u. a. „Le Chahut“
aUs der Sammlung Kröller-Müller, und eine
Studie für „La grande Jatte“ aus einer Privat-
sammlung in Amsterdam. Signac ist ver-
treten mit 10 Gemälden; van Rijsselberghe mit
12 und Jan Toorop auch mit ungefähr 10
Werken. Auch Angrand, Henri Edmond Gross,
Maximilien Luce, George Leminen, Henri van
de Velde, Johan Thorn Prikker und Hart Nib-
brig sind durch Gemälde repräsentiert.
Restaurierte
Holzbildwerke
Der Restaurator der Kunstsammlungen in
Freiburg im Brsg., Paul H. Hübner, hat zu
verschiedenen Malen durch außerordentlich
glückliche Wiederherstellungen alter Kunst-
werke die Aufmerksamkeit der .Oeffentlichkeit
erregt, besonders anläßlich jener des soge-
nannten „Nägelinkreuzes“, einer oberrheini-
schen Plastik von der Mitte des 14. Jahrhun-
derts in Villingen, und bei der Rückführung
des „Kreuzträgers“ im Freiburger Münster in
seinen ursprünglichen Zustand, einer ober-
rheinischen Plastik von etwa 1400, die durch
die Studie L. Schürenbergs (Jahrbuch für Ober-
rheinische Kunst 1936. VII) eine eingehende
kunsthistorische Analyse erfahren hat.
Wenn auf diese im „Museion“ vor kurzem
durch Hübner selbst erzählte Wiederherstel-
lung nochmals eingegangen wird, so geschieht
es, um einen größeren Leserkeis auf die ganz
üeuen Möglichkeiten der Herstellung von
Elastiken der Vergangenheit aufmerksam zu
machen.
Wir besitzen nur in seltensten Fällen alte
Skulpturen in ihrer ursprünglichen Bemalung.
Jede Epoche verändert, wenn sie irgend in der
Lage ist, das Objekt. Dies kann man gerade
Lei dem „Kreuzträger“ beobachten, der sechs
Uebermalungen aufwies. Die Originalbema-
lung war in Tempera ausgeführt und zwar in
möglichster Naturtreue. Das Gesicht war stark
farbig, die Augen wenig geöffnet, schrägge-
stellt, blau, Haar und Bart dunkelbraun, Ge-
wand grauolivgrün. Die Spätgotik hat sich an
dieser Einfachheit gestoßen. Das Gesicht
wurde noch farbiger, jedoch nicht ornamental
aufgefaßt, wie in der Originalbehandlung, die
Augen vergrößert, jetzt hellbraun, Gewand
dunkelblau. Im 16. Jahrhundert hat man Haar
und Bart in ihrer Farbe belassen, aber das
hagere Gesicht gerundet; die Augen wurden
groß, weit geöffnet, rehbraun, das Gewand
dunkelbraun. Das 17. Jahrhundert hat das
Gesicht vereinfacht, die weitgeöffneten Augen
wurden schwarzbraun, ebenso Bart und Haare,
das Gewand hellgrün. Im Anfang des 18. Jahr-
hunderts wurde das Gewand rötlichblaugrau
angestrichen, die anderen Teile der Figur in
den Farben verstärkt. Ende des 18. Jahr-
hunderts erhielt die Figur ein kobaltblaues
Gewand, die Augen wurden wieder hellblau,
das Gesicht ockerfarbig mit wenigen hellrosa
Blutbahnen. Endlich hat die sechste Bemalung
aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
alles noch effektvoller gesteigert. Bart und
Haar wurden ganz dunkel, Tränen rollten von
den umränderten hellblauen Augen herab, das
Gewand erhielt einen himbeerfarbigen An-
strich.
Hübner hat mit einer von ihm erfundenen
Salbe, die in einer Gesamtdicke von 4 Milli-
metern vorhandenen Uebermalungen Schicht
für Schicht entfernt, bis er zur ersten Be-
malung vordrang, die auf einem 2—3 Milli-
meter dicken Kreidegrund lag, den hinwie-
derum ein Schellacküber-
zug deckte. Man wird
dies als ein kunst-
historisches Ereignis von
großer Bedeutung wer-
ten dürfen, wenn man
bedenkt, mit welchen
Mitteln man bisher in
den Restaurierungswerk-
stätten der Museen
alte Plastiken behandelt
hat. Entweder laugte
man die Skulpturen ra-
dikal ab und wachste
dann das herauskommen-
de Holz — dies ist die
Form, in der sich die
mittelalterliche Schnitze-
rei zumeist dem Be-
schauer in den Samm-
lungen darbietet — oder
man versuchte, durch
vorsichtiges Abklopfen
oder Abkratzen die neue
Farbe loszusprengen, um
die ursprüngliche zu
erhalten, aber man ver-
letzte, wie dies nicht
anders möglich ist, da-
bei auch diese und
war dann gezwungen, durch neue Bemalung
die entstandenen Schäden wieder auszu-
gleichen. Die Huebnersche Methode verletzt
die alte Schicht nicht. Dies beweist eine Reihe
Plastiken des Freiburger Museums, die in ihrer
alten Vergoldung erstrahlen und die von einer
Starkfarbigkeit sind, die eigentlich nur den
überraschen konnte, der nicht von Glas-
fenstern und Miniaturen auf die Plastik schloß.
Muß man sich doch die ganze alte Portal-
plastik der Kathedralen farbig vorstellen. K.
Paar Silberterrinen von R. J. Auguste, Paris, 1775—76. Brachte auf der
Versteigerung der Sammlung Mme Dhainaut-Paris durch Sotheby & Co., London,
am 10. Dezember 1936: £ 2200 (Photo Sotheby)
Eine süddeutsche Marienkrönung
schuf, dem Altäre
Süddeutsch, um 1520. Westfälischer Adelsbesitz
(Photo Schwarzl
Die eindrucksvolle,
hier reproduzierte Grup-
pe einer Marienkrönung
(Lindenholz, H. 94 cm),
die sich in einer westfäli¬
schen Adelssammlung be¬
findet, ist ein in vieler
Hinsicht interessantes
Zeugnis deutscher Spät¬
gotik um 1520. Der Mei¬
ster dieser Gruppe strebt
mit den Mitteln eines ge-
steigerten Bewegungs¬
rhythmus in großange-
legten Faltenwürfen zu
einer Monumentalität, die
an die letzten großen
Altarwerke dieser Epoche
erinnert. Wenngleich die
Maria an Gestaltungen
des Oberrheiners Hans
Wydyz anklingt, zeigen
die nervösen Gesichter,
das aufgelöste Haar, die
tief unterschnittenen Fal¬
ten an, daß diese tempe-
ramentvolle Arbeit ihre
Entstehung mehr dem
Südosten Deutschlands
verdankt. Man vermutet
nicht zuviel, wenn man
annimmt, daß dieses eine
überaus eigenwille Ge¬
staltungskraft verratende
Stück von einem Künst¬
ler gearbeitet wurde,
dem der süddeutsche
Formenkanon geläufig
war und der vielleicht in
jenem in der Entwick-
lung
Plastik häufig
fenden West-Ost-Zug das
Werk in einem Kunstraum
wie der von Kefermarkt oder Zwetl (Andreas
Morgenstern, 1516—25) ihre Entstehung ver-
danken. W. R. D.
der damaligen
ig anzutref-
Leopold Venus
Zum 5 0. Todestag eines
Am 23. Dezember jährte sich zum fünfzig-
sten Male der Todestag des frühverstorbenen
Dresdener Malers Leopold Venus, der meist
nur als Gestalter bürgerlicher Idyllen in der
Art Ludwig Richters bekannt ist und der in
diesen Arbeiten von denen seines gleichförmi-
geren Bruders Albert noch wenig gesondert
wird. Doch verdient er neben Schwind und
vor allem neben dem etwas älteren Victor
Müller genannt zu werden. Vor drei Jahren
widmete ihm die Kunsthandlung Kühl in Dres-
den eine Ausstellung, Wilhelm Axt bewahrte
den Nachlaß und manche Nachrichten; Zeich-
nungen sind in der Nationalgalerie in Berlin,
dem Leipziger Museum, den Sammlungen Heu-
mann in Chemnitz, Hille in Zwickau, von
Przybram in München. Die beiden frühen
Gemälde der Dresdner Galerie von 1866 weisen
die Richtungen seiner Malerei: durch den im
Atelier seines Lehrers Julius Hübner gemalten
Kopf eines Greises sucht er stark farbigen
Ausdruck, in der „Heiligen Elisabeth“ die
deutschen Romantikers
Sagem und Märchenwelt der deutschen Land-
schaft, der er sich in liebevoll-eindringlichen
Studien hingab.
Neben Erwerbsarbeit, Illustrationen zu
Jugendbüchern, Goldschnittlyrik, malte Venus
Märchenzyklen, Dornröschen, Schneewittchen,
auf den Villenwänden reicher Fabrikanten in
der Provinz, die sie noch heute verbergen.
Seine Zeichenweise, ursprünglich nazareni-
scher Linie streng verpflichtet, gewinnt all-
mählich ausdrucksvollen Umriß, wird in
Skizzen zu einem krausen wilden Spiel; seine
Farbe, erst licht und heiter hingesetzt, wird
dämonisch erglühend und läßt zuweilen den
Expressionismus vorausahnen. Zu einem späten
Rübezahlzyklus, von dem wir nicht wissen, ob
er je ausgeführt wurde, gibt es eine Reihe
großer Aquarellentwürfe, im Besitz eines Ober-
lausitzer Pfarrers; sie führen uns in Szenen
von koboldischer Kraft, an Slevogt gemahnend,
auf kühle Bergeshöhen oder in lockende
Tiefen der Unterwelt. S.
Po/ens Kunsfbesifz
Ausländische Kunst in polnischen Sammlungen
Von Kurt Erich Simon
Als Kunstland ist Polen, trotz seiner be-
rühmten Städte, noch immer unbekannt. Die
Wiedererrichtung des polnischen Staates hat
der öffentlichen Denkmalpflege den entschei-
denden Antrieb gegeben. Erbe der Vergangen-
heit sind jene freiwilligen Sachwalter einer
staatlichen Kunstfürsorge, die städtischen
Sammlungen, meist Nationalmuseen genannt,
und die großen Adelssammlungen, die oft
durch Stiftung öffentlich geworden sind, wie
die Museen Lubomirski in Lemberg, Czarto-
ryski in Krakau und Goluchow; die Sammlung
Raczynski ist mit ihrem Schatz spanischer Bil-
der im Museum zu Posen.. Erst kürzlich erhielt
der Wawel, das Königsschloß in Krakau, noch
z'vei, allerdings erst in neuerer Zeit gebildete
Sammlungen, Pininski und Dzieduszycki, als
Stiftung. Wie leidenschaftlich das Publikum
an der Kunstpflege Anteil nimmt, zeigt der
Streit um die Restauration des Wawel, dessen
Verheerung die Aufgabe, das Schloß zur staat-
lichen Repräsentation herzustellen, von vorn-
herein widerspruchsvoll ausfallen lassen
üiiißte.
Trotzdem manches Gute aus polnischen
Sammlungen abgewandert ist, befindet sich dort
•loch ein reicher Kunstbesitz, wenn auch kri-
'sche Sichtung dem Wertvollen den gebüh-
renden (Platz anweisen müßte, was wörtlich
Genommen auch durch Vollendung der zahl-
reichen begonnenen oder geplanten Museums-
bauten zu erreichen wäre. Das Schwergewicht
legt auf den Werken der späteren Zeit, des
7 • und 18. Jahrhunderts, die großen Perioden
früheren Jahrhunderte sind mit wenigen
q L hervorragenden Arbeiten vertreten. Eine
Gütliche Neigung polnischen Mäzenatentums
pjenbart sich in den Bilderhandschriften und
er] 1 s> die von romanischer Zeit an reich und
8e®sen vorhanden sind, und in der kostbaren
le der Wawelteppiche. Eine Sonderstellung
Amberger, Männerbildnis. 1537
Schloß Wilanow (Photo Simon)
nehmen die ukrainischen Ikonen ein. für
deren religiös gespaltene und verschieden-
artige Gruppen es in Lemberg zwei bemer-
kenswerte, leider nur in engsten Fachkreisen
bekannte Museen gibt. Neben dieser Nach-
folge der ältesten osteuropäischen Altarkunst
findet man die neueste westeuropäische Kunst
im wesentlichen nur im Museum der Indu-
striestadt Lodz.
Nach einer mehrmonatigen Studienreise
durch Polen, unternommen mit Mussia Eisen-
stadt, haben wir im letzten Heft der Zeit-
schrift für Kunstgeschichte eine kritische
Uebersicht des polnischen Besitzes an Gemäl-
den gegeben, im Anschluß an Mieczyslaw Wal-
lis’ Verzeichnis der ausländischen Kunst in
Polen (Sztuka obea w Zbiorach Polskich, War-
schau, Arct, 1955), das die Informationen lie-
fert, die der Reisende sich vorher mühsam
und unzulänglich beschaffen mußte.
Als wissenschaftliche Ergebnisse der Reise
seien hier nur als die wichtigsten neuen Fest-
stellungen hervorgehoben: im Schloß Wilanow
bei Warschau wurde eine Tafel mit der „Mar-
ter der Zehntausend“ als Werk des Meisters
der Katharinenlegende bestimmt, eine Strand-
ansicht als das Simon de Vliegers, zwei Bild-
nisse als Arbeiten Ambergers, von denen wir
eine abbilden, zwei Passionsszenen als Werke
des jüngeren Cranach. Für die französische
Schule gelang es, auf einem Bilde der Lenain
im Schlosse Lancut die Datierung aufzufinden
und damit die früheste Jahreszahl im Werk
der Brüder zu sichern; dieses „Kinderkonzert“,
bisher nur aus einer Replik bekannt, ist dem
Mathieu, dem jüngsten der Brüder, zuzuwei-
sen. Ein „Triumph der Maria“ des Lebrun
in Wilanow konnte als der Entwurf zu dem
Deckenbilde der abgebrochenen Kapelle des
Seminars von St. Sulpice nachgewiesen werden.
Zu den interessanten, jedoch noch zu lösenden
Fragen gehören die Autorschaft und der Ge-
genstand einer großen Landschaft mit dem Na-
men Poussin ebendort. Eine kleine Watteau
oder Lancret genannte Pastorale im Museum
Czartoryski in Krakau wurde als Pater be-
stimmt. Bei den Italienern ist vornehmlich
auf die bedeutendsten Stücke hinzuweisen: im
Museum Czartoryski wird als Maler der rätsel-
vollen „Dame mit dem Hermelin“ Ambrogio
da Predis anzunehmen sein; Raffaels schönes
Gemälde, noch immer als Bildnis eines Jüng-
lings geltend, stellt sicherlich eine Frau dar,
deren eigenartige Schönheit von Geheimnis
umhüllt ist. Völlig unbekannt war bisher der
Besitz des Palais „Pod Baranami“ in Krakau,
dessen Sammlung neben Schloß Lancut wohl
die bedeutendste in Polen ist, die ihren rein
privaten Charakter bewahrt hat: eine Hirten-
szene aus dem Kreise des Giorgione, eine Hei-
lige Familie in tiefblauer Landschaft des Bor-
done, u. a.
Daß noch weitere Funde möglich sind, be-
weist die Aufdeckung, im wörtlichen Sinne,
der großen Auferweckung des Lazarus von
Cranach d. A e., Lukretia. Schloß Wilanow
(Photo Simon)
Carei Fabritius. Wir verdanken Herrn Wallis
die Abbildung, die wir hier in Nr. 48/49 des
letzten Jahrgangs bringen konnten.
Jah.rg. XI, Nr. 1 vom 5. Januar 1957
wichtige Gemälde zu sehen, u. a. „Le Chahut“
aUs der Sammlung Kröller-Müller, und eine
Studie für „La grande Jatte“ aus einer Privat-
sammlung in Amsterdam. Signac ist ver-
treten mit 10 Gemälden; van Rijsselberghe mit
12 und Jan Toorop auch mit ungefähr 10
Werken. Auch Angrand, Henri Edmond Gross,
Maximilien Luce, George Leminen, Henri van
de Velde, Johan Thorn Prikker und Hart Nib-
brig sind durch Gemälde repräsentiert.
Restaurierte
Holzbildwerke
Der Restaurator der Kunstsammlungen in
Freiburg im Brsg., Paul H. Hübner, hat zu
verschiedenen Malen durch außerordentlich
glückliche Wiederherstellungen alter Kunst-
werke die Aufmerksamkeit der .Oeffentlichkeit
erregt, besonders anläßlich jener des soge-
nannten „Nägelinkreuzes“, einer oberrheini-
schen Plastik von der Mitte des 14. Jahrhun-
derts in Villingen, und bei der Rückführung
des „Kreuzträgers“ im Freiburger Münster in
seinen ursprünglichen Zustand, einer ober-
rheinischen Plastik von etwa 1400, die durch
die Studie L. Schürenbergs (Jahrbuch für Ober-
rheinische Kunst 1936. VII) eine eingehende
kunsthistorische Analyse erfahren hat.
Wenn auf diese im „Museion“ vor kurzem
durch Hübner selbst erzählte Wiederherstel-
lung nochmals eingegangen wird, so geschieht
es, um einen größeren Leserkeis auf die ganz
üeuen Möglichkeiten der Herstellung von
Elastiken der Vergangenheit aufmerksam zu
machen.
Wir besitzen nur in seltensten Fällen alte
Skulpturen in ihrer ursprünglichen Bemalung.
Jede Epoche verändert, wenn sie irgend in der
Lage ist, das Objekt. Dies kann man gerade
Lei dem „Kreuzträger“ beobachten, der sechs
Uebermalungen aufwies. Die Originalbema-
lung war in Tempera ausgeführt und zwar in
möglichster Naturtreue. Das Gesicht war stark
farbig, die Augen wenig geöffnet, schrägge-
stellt, blau, Haar und Bart dunkelbraun, Ge-
wand grauolivgrün. Die Spätgotik hat sich an
dieser Einfachheit gestoßen. Das Gesicht
wurde noch farbiger, jedoch nicht ornamental
aufgefaßt, wie in der Originalbehandlung, die
Augen vergrößert, jetzt hellbraun, Gewand
dunkelblau. Im 16. Jahrhundert hat man Haar
und Bart in ihrer Farbe belassen, aber das
hagere Gesicht gerundet; die Augen wurden
groß, weit geöffnet, rehbraun, das Gewand
dunkelbraun. Das 17. Jahrhundert hat das
Gesicht vereinfacht, die weitgeöffneten Augen
wurden schwarzbraun, ebenso Bart und Haare,
das Gewand hellgrün. Im Anfang des 18. Jahr-
hunderts wurde das Gewand rötlichblaugrau
angestrichen, die anderen Teile der Figur in
den Farben verstärkt. Ende des 18. Jahr-
hunderts erhielt die Figur ein kobaltblaues
Gewand, die Augen wurden wieder hellblau,
das Gesicht ockerfarbig mit wenigen hellrosa
Blutbahnen. Endlich hat die sechste Bemalung
aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
alles noch effektvoller gesteigert. Bart und
Haar wurden ganz dunkel, Tränen rollten von
den umränderten hellblauen Augen herab, das
Gewand erhielt einen himbeerfarbigen An-
strich.
Hübner hat mit einer von ihm erfundenen
Salbe, die in einer Gesamtdicke von 4 Milli-
metern vorhandenen Uebermalungen Schicht
für Schicht entfernt, bis er zur ersten Be-
malung vordrang, die auf einem 2—3 Milli-
meter dicken Kreidegrund lag, den hinwie-
derum ein Schellacküber-
zug deckte. Man wird
dies als ein kunst-
historisches Ereignis von
großer Bedeutung wer-
ten dürfen, wenn man
bedenkt, mit welchen
Mitteln man bisher in
den Restaurierungswerk-
stätten der Museen
alte Plastiken behandelt
hat. Entweder laugte
man die Skulpturen ra-
dikal ab und wachste
dann das herauskommen-
de Holz — dies ist die
Form, in der sich die
mittelalterliche Schnitze-
rei zumeist dem Be-
schauer in den Samm-
lungen darbietet — oder
man versuchte, durch
vorsichtiges Abklopfen
oder Abkratzen die neue
Farbe loszusprengen, um
die ursprüngliche zu
erhalten, aber man ver-
letzte, wie dies nicht
anders möglich ist, da-
bei auch diese und
war dann gezwungen, durch neue Bemalung
die entstandenen Schäden wieder auszu-
gleichen. Die Huebnersche Methode verletzt
die alte Schicht nicht. Dies beweist eine Reihe
Plastiken des Freiburger Museums, die in ihrer
alten Vergoldung erstrahlen und die von einer
Starkfarbigkeit sind, die eigentlich nur den
überraschen konnte, der nicht von Glas-
fenstern und Miniaturen auf die Plastik schloß.
Muß man sich doch die ganze alte Portal-
plastik der Kathedralen farbig vorstellen. K.
Paar Silberterrinen von R. J. Auguste, Paris, 1775—76. Brachte auf der
Versteigerung der Sammlung Mme Dhainaut-Paris durch Sotheby & Co., London,
am 10. Dezember 1936: £ 2200 (Photo Sotheby)
Eine süddeutsche Marienkrönung
schuf, dem Altäre
Süddeutsch, um 1520. Westfälischer Adelsbesitz
(Photo Schwarzl
Die eindrucksvolle,
hier reproduzierte Grup-
pe einer Marienkrönung
(Lindenholz, H. 94 cm),
die sich in einer westfäli¬
schen Adelssammlung be¬
findet, ist ein in vieler
Hinsicht interessantes
Zeugnis deutscher Spät¬
gotik um 1520. Der Mei¬
ster dieser Gruppe strebt
mit den Mitteln eines ge-
steigerten Bewegungs¬
rhythmus in großange-
legten Faltenwürfen zu
einer Monumentalität, die
an die letzten großen
Altarwerke dieser Epoche
erinnert. Wenngleich die
Maria an Gestaltungen
des Oberrheiners Hans
Wydyz anklingt, zeigen
die nervösen Gesichter,
das aufgelöste Haar, die
tief unterschnittenen Fal¬
ten an, daß diese tempe-
ramentvolle Arbeit ihre
Entstehung mehr dem
Südosten Deutschlands
verdankt. Man vermutet
nicht zuviel, wenn man
annimmt, daß dieses eine
überaus eigenwille Ge¬
staltungskraft verratende
Stück von einem Künst¬
ler gearbeitet wurde,
dem der süddeutsche
Formenkanon geläufig
war und der vielleicht in
jenem in der Entwick-
lung
Plastik häufig
fenden West-Ost-Zug das
Werk in einem Kunstraum
wie der von Kefermarkt oder Zwetl (Andreas
Morgenstern, 1516—25) ihre Entstehung ver-
danken. W. R. D.
der damaligen
ig anzutref-
Leopold Venus
Zum 5 0. Todestag eines
Am 23. Dezember jährte sich zum fünfzig-
sten Male der Todestag des frühverstorbenen
Dresdener Malers Leopold Venus, der meist
nur als Gestalter bürgerlicher Idyllen in der
Art Ludwig Richters bekannt ist und der in
diesen Arbeiten von denen seines gleichförmi-
geren Bruders Albert noch wenig gesondert
wird. Doch verdient er neben Schwind und
vor allem neben dem etwas älteren Victor
Müller genannt zu werden. Vor drei Jahren
widmete ihm die Kunsthandlung Kühl in Dres-
den eine Ausstellung, Wilhelm Axt bewahrte
den Nachlaß und manche Nachrichten; Zeich-
nungen sind in der Nationalgalerie in Berlin,
dem Leipziger Museum, den Sammlungen Heu-
mann in Chemnitz, Hille in Zwickau, von
Przybram in München. Die beiden frühen
Gemälde der Dresdner Galerie von 1866 weisen
die Richtungen seiner Malerei: durch den im
Atelier seines Lehrers Julius Hübner gemalten
Kopf eines Greises sucht er stark farbigen
Ausdruck, in der „Heiligen Elisabeth“ die
deutschen Romantikers
Sagem und Märchenwelt der deutschen Land-
schaft, der er sich in liebevoll-eindringlichen
Studien hingab.
Neben Erwerbsarbeit, Illustrationen zu
Jugendbüchern, Goldschnittlyrik, malte Venus
Märchenzyklen, Dornröschen, Schneewittchen,
auf den Villenwänden reicher Fabrikanten in
der Provinz, die sie noch heute verbergen.
Seine Zeichenweise, ursprünglich nazareni-
scher Linie streng verpflichtet, gewinnt all-
mählich ausdrucksvollen Umriß, wird in
Skizzen zu einem krausen wilden Spiel; seine
Farbe, erst licht und heiter hingesetzt, wird
dämonisch erglühend und läßt zuweilen den
Expressionismus vorausahnen. Zu einem späten
Rübezahlzyklus, von dem wir nicht wissen, ob
er je ausgeführt wurde, gibt es eine Reihe
großer Aquarellentwürfe, im Besitz eines Ober-
lausitzer Pfarrers; sie führen uns in Szenen
von koboldischer Kraft, an Slevogt gemahnend,
auf kühle Bergeshöhen oder in lockende
Tiefen der Unterwelt. S.
Po/ens Kunsfbesifz
Ausländische Kunst in polnischen Sammlungen
Von Kurt Erich Simon
Als Kunstland ist Polen, trotz seiner be-
rühmten Städte, noch immer unbekannt. Die
Wiedererrichtung des polnischen Staates hat
der öffentlichen Denkmalpflege den entschei-
denden Antrieb gegeben. Erbe der Vergangen-
heit sind jene freiwilligen Sachwalter einer
staatlichen Kunstfürsorge, die städtischen
Sammlungen, meist Nationalmuseen genannt,
und die großen Adelssammlungen, die oft
durch Stiftung öffentlich geworden sind, wie
die Museen Lubomirski in Lemberg, Czarto-
ryski in Krakau und Goluchow; die Sammlung
Raczynski ist mit ihrem Schatz spanischer Bil-
der im Museum zu Posen.. Erst kürzlich erhielt
der Wawel, das Königsschloß in Krakau, noch
z'vei, allerdings erst in neuerer Zeit gebildete
Sammlungen, Pininski und Dzieduszycki, als
Stiftung. Wie leidenschaftlich das Publikum
an der Kunstpflege Anteil nimmt, zeigt der
Streit um die Restauration des Wawel, dessen
Verheerung die Aufgabe, das Schloß zur staat-
lichen Repräsentation herzustellen, von vorn-
herein widerspruchsvoll ausfallen lassen
üiiißte.
Trotzdem manches Gute aus polnischen
Sammlungen abgewandert ist, befindet sich dort
•loch ein reicher Kunstbesitz, wenn auch kri-
'sche Sichtung dem Wertvollen den gebüh-
renden (Platz anweisen müßte, was wörtlich
Genommen auch durch Vollendung der zahl-
reichen begonnenen oder geplanten Museums-
bauten zu erreichen wäre. Das Schwergewicht
legt auf den Werken der späteren Zeit, des
7 • und 18. Jahrhunderts, die großen Perioden
früheren Jahrhunderte sind mit wenigen
q L hervorragenden Arbeiten vertreten. Eine
Gütliche Neigung polnischen Mäzenatentums
pjenbart sich in den Bilderhandschriften und
er] 1 s> die von romanischer Zeit an reich und
8e®sen vorhanden sind, und in der kostbaren
le der Wawelteppiche. Eine Sonderstellung
Amberger, Männerbildnis. 1537
Schloß Wilanow (Photo Simon)
nehmen die ukrainischen Ikonen ein. für
deren religiös gespaltene und verschieden-
artige Gruppen es in Lemberg zwei bemer-
kenswerte, leider nur in engsten Fachkreisen
bekannte Museen gibt. Neben dieser Nach-
folge der ältesten osteuropäischen Altarkunst
findet man die neueste westeuropäische Kunst
im wesentlichen nur im Museum der Indu-
striestadt Lodz.
Nach einer mehrmonatigen Studienreise
durch Polen, unternommen mit Mussia Eisen-
stadt, haben wir im letzten Heft der Zeit-
schrift für Kunstgeschichte eine kritische
Uebersicht des polnischen Besitzes an Gemäl-
den gegeben, im Anschluß an Mieczyslaw Wal-
lis’ Verzeichnis der ausländischen Kunst in
Polen (Sztuka obea w Zbiorach Polskich, War-
schau, Arct, 1955), das die Informationen lie-
fert, die der Reisende sich vorher mühsam
und unzulänglich beschaffen mußte.
Als wissenschaftliche Ergebnisse der Reise
seien hier nur als die wichtigsten neuen Fest-
stellungen hervorgehoben: im Schloß Wilanow
bei Warschau wurde eine Tafel mit der „Mar-
ter der Zehntausend“ als Werk des Meisters
der Katharinenlegende bestimmt, eine Strand-
ansicht als das Simon de Vliegers, zwei Bild-
nisse als Arbeiten Ambergers, von denen wir
eine abbilden, zwei Passionsszenen als Werke
des jüngeren Cranach. Für die französische
Schule gelang es, auf einem Bilde der Lenain
im Schlosse Lancut die Datierung aufzufinden
und damit die früheste Jahreszahl im Werk
der Brüder zu sichern; dieses „Kinderkonzert“,
bisher nur aus einer Replik bekannt, ist dem
Mathieu, dem jüngsten der Brüder, zuzuwei-
sen. Ein „Triumph der Maria“ des Lebrun
in Wilanow konnte als der Entwurf zu dem
Deckenbilde der abgebrochenen Kapelle des
Seminars von St. Sulpice nachgewiesen werden.
Zu den interessanten, jedoch noch zu lösenden
Fragen gehören die Autorschaft und der Ge-
genstand einer großen Landschaft mit dem Na-
men Poussin ebendort. Eine kleine Watteau
oder Lancret genannte Pastorale im Museum
Czartoryski in Krakau wurde als Pater be-
stimmt. Bei den Italienern ist vornehmlich
auf die bedeutendsten Stücke hinzuweisen: im
Museum Czartoryski wird als Maler der rätsel-
vollen „Dame mit dem Hermelin“ Ambrogio
da Predis anzunehmen sein; Raffaels schönes
Gemälde, noch immer als Bildnis eines Jüng-
lings geltend, stellt sicherlich eine Frau dar,
deren eigenartige Schönheit von Geheimnis
umhüllt ist. Völlig unbekannt war bisher der
Besitz des Palais „Pod Baranami“ in Krakau,
dessen Sammlung neben Schloß Lancut wohl
die bedeutendste in Polen ist, die ihren rein
privaten Charakter bewahrt hat: eine Hirten-
szene aus dem Kreise des Giorgione, eine Hei-
lige Familie in tiefblauer Landschaft des Bor-
done, u. a.
Daß noch weitere Funde möglich sind, be-
weist die Aufdeckung, im wörtlichen Sinne,
der großen Auferweckung des Lazarus von
Cranach d. A e., Lukretia. Schloß Wilanow
(Photo Simon)
Carei Fabritius. Wir verdanken Herrn Wallis
die Abbildung, die wir hier in Nr. 48/49 des
letzten Jahrgangs bringen konnten.