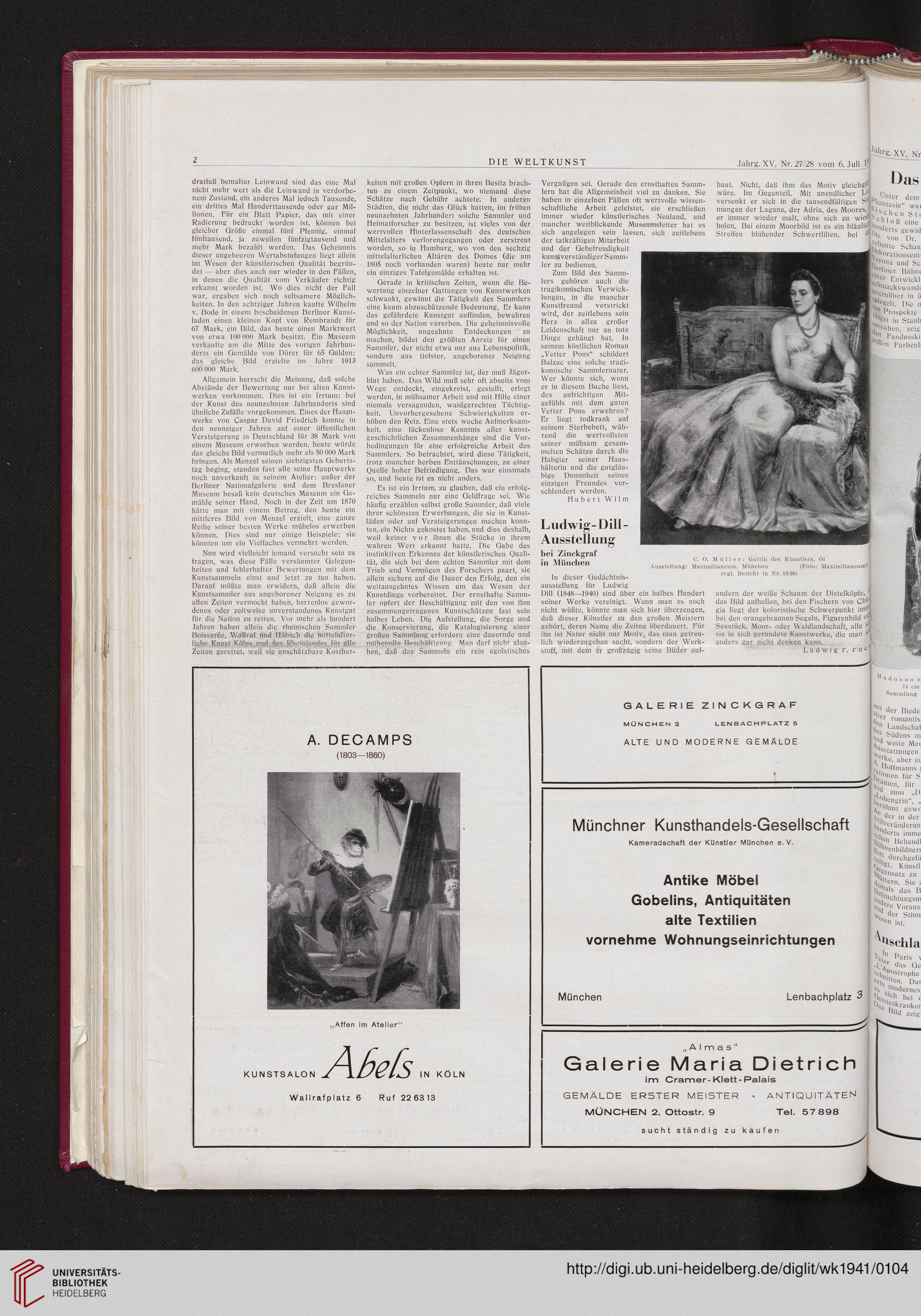2
DIE WELTKUNST
Jahrg. XV, Nr, 27/28 vom
Das
ein halbes Hundert
'">W
^<1
MÜNCHEN 2
ALTE UND MODERNE GEMÄLDE
Münchner Kunsthandels-Gesellschaft
Kameradschaft der Künstler München e. V.
Antike Möbel
vornehme Wohnungseinrichtungen
Lenbachplatz
München
im Cramer-Klett-Palais
GEMÄLDE ERSTER MEISTER
MÜNCHEN 2, Ottostr. 9
Tel. 57 898
4
74 cm
Sammlung
sucht ständig zu kaufen
dratfuß bemalter Leinwand sind das eine Mal
nicht mehr wert als die Leinwand in verdorbe-
nem Zustand, ein anderes Mal jedoch Tausende,
ein drittes Mal Hunderttausende oder gar Mil-
lionen. Für ein Blatt Papier, das mit einer
Radierung bedruckt worden ist, können bei
gleicher Größe einmal fünf Pfennig, einmal
fünftausend, ja zuweilen fünfzigtausend und
mehr Mark bezahlt werden. Das Geheimnis
dieser ungeheuren Wertabstufungen liegt allein
im Wesen der künstlerischen Qualität begrün-
det — aber dies auch nur wieder in den Fällen,
in denen die Qualität vom Verkäufer richtig
erkannt worden ist. Wo dies nicht der Fall
war, ergaben sich noch seltsamere Möglich-
keiten. In den achtziger Jahren kaufte Wilhelm
v. Bode in einem bescheidenen Berliner Kunst-
laden einen kleinen Kopf von Rembrandt für
67 Mark, ein Bild, das heute einen Marktwert
von etwa 100 000 Mark besitzt. Ein Museum
verkaufte um die Mitte des vorigen Jahrhun-
derts ein Gemälde von Dürer für 65 Gulden;
das gleiche Bild erzielte im Jahre 1913
600 000 Mark.
Allgemein herrscht die Meinung, daß solche
Abstände der Bewertung nur bei alten Kunst-
werken vorkommen. Dies ist ein Irrtum: bei
der Kunst des neunzehnten Jahrhunderts sind
ähnliche Zufälle vorgekommen. Eines der Haupt-
werke von Caspar David Friedrich konnte in
den neunziger Jahren auf einer öffentlichen
Versteigerung in Deutschland für 38 Mark von
einem Museum erworben werden, heute würde
das gleiche Bild vermutlich mehr als 50 000 Mark
bringen. Als Menzel seinen siebzigsten Geburts-
tag beging, standen fast alle seine Hauptwerke
noch unverkauft in seinem Atelier; außer der
Berliner Nationalgalerie und dem Breslauer
Museum besaß kein deutsches Museum ein Ge-
mälde seiner Hand. Noch in der Zeit um 1870
hätte man mit einem Betrag, den heute ein
mittleres Bild von Menzel erzielt, eine ganze
Reihe seiner besten Werke mühelos erwerben
können. Dies sind nur einige Beispiele; sie
könnten um ein Vielfaches vermehrt werden.
Nun wird vielleicht jemand versucht sein zu
fragen, was diese Fälle versäumter Gelegen-
heiten und fehlerhafter Bewertungen mit dem
Kunstsammeln einst und jetzt zu tun haben.
Darauf müßte man erwidern, daß allein die
Kunstsammler aus angeborener Neigung es zu
allen Zeiten vermocht haben, herrenlos gewor-
denes oder zeitweise unverstandenes Kunstgut
für die Nation zu retten. Vor mehr als hundert
Jahren haben allein die rheinischen Sammler
Boisseree, Wallraf und Hübsch die mittelalter-
liche Kunst Kölns und des.Rhftinlancjes für alle
Zeiten gerettet, weil sie unschätzbare Kostbar-
keiten mit großen Opfern in ihren Besitz brach-
ten zu einem Zeitpunkt, wo niemand diese
Schätze nach Gebühr achtete. In anderen
Städten, die nicht das Glück hatten, im frühen
neunzehnten Jahrhundert solche Sammler und
Heimatforscher zu besitzen, ist vieles von der
wertvollen Hinterlassenschaft des deutschen
Mittelalters verlorengegangen oder zerstreut
worden, so in Hamburg, wo von den sechzig
mittelalterlichen Altären des Domes (die um
1805 noch vorhanden waren) heute nur mehr
ein einziges Tafelgemälde erhalten ist.
Gerade in kritischen Zeiten, wenn die Be-
wertung einzelner Gattungen von Kunstwerken
schwankt, gewinnt die Tätigkeit des Sammlers
eine kaum abzuschätzende Bedeutung. Er kann
das gefährdete Kunstgut auffinden, bewahren
und so der Nation vererben. Die geheimnisvolle
Möglichkeit, ungeahnte Entdeckungen zu
machen, bildet den größten Anreiz für einen
Sammler, der nicht etwa nur aus Lebenspolitik,
sondern aus tiefster, angeborener Neigung
sammelt.
Was ein echter Sammler ist, der muß Jäger-
blut haben. Das Wild muß sehr oft abseits vom
Wege entdeckt, eingekreist, gestellt, erlegt
werden, in mühsamer Arbeit und mit Hilfe einer
niemals versagenden, waidgerechten Tüchtig-
keit. Unvorhergesehene Schwierigkeiten er-
höhen den Reiz. Eine stets wache Aufmerksam-
keit, eine lückenlose Kenntnis aller kunst-
geschichtlichen Zusammenhänge sind die Vor-
bedingungen für eine erfolgreiche Arbeit des
Sammlers. So betrachtet, wird diese Tätigkeit,
trotz mancher herben Enttäuschungen, zu einer
Quelle hoher Befriedigung. Das war einstmals
so, und heute ist es nicht anders.
Es ist ein Irrtum, zu glauben, daß ein erfolg-
reiches Sammeln nur eine Geldfrage sei. Wie
häufig erzählen selbst große Sammler, daß viele
ihrer schönsten Erwerbungen, die sie in Kunst-
läden oder auf Versteigerungen machen konn-
ten, ein Nichts gekostet haben, und dies deshalb,
weil keiner vor ihnen die Stücke in ihrem
wahren Wert erkannt hatte. Die Gabe des
instinktiven Erkennes der künstlerischen Quali-
tät, die sich bei dem echten Sammler mit dem
Trieb und Vermögen des Forschers paart, sie
allein sichern auf die Dauer den Erfolg, den ein
weitausgehntes Wissen um das Wesen der
Kunstdinge vorbereitet. Der ernsthafte Samm-
ler opfert der Beschäftigung mit den von ihm
zusammengetragenen Kunstschätzen fast sein
halbes Leben. Die Aufstellung, die Sorge und
die Konservierung, die Katalogisierung einer
großen Sammlung erfordern eine dauernde und
mühevolle Beschäftigung. Man darf nicht glau-
ben, daß das Sammeln ein rein egoistisches
In dieser Gedächtnis-
ausstellung für Ludwig
Dill (1848—1940) sind über
seiner Werke vereinigt. Wenn man es noch
nicht wüßte, könnte man sich hier überzeugen,
daß dieser Künstler zu den großen Meistern
gehört, deren Name die Zeiten überdauert. Für
ihn ist Natur nicht nur Motiv, das man getreu-
lich wiederzugeben sucht, sondern der Werk-
stoff, mit dem er großzügig seine Bilder auf-
andern der weiße Schaum der Distelköpfe,
das Bild aufhellen, bei den Fischern von Chi1’
gia liegt der koloristische Schwerpunkt im11!
bei den orangebraunen Segeln. Figurenbild o,
Seestück, Moor- oder Waldlandschaft, alle s!
sie in sich gerundete Kunstwerke, die man "
anders gar nicht denken kann.
Ludwig F. r u c
Ludwig-Dill-
Ausstellung
bei Zinckgraf
in München
Vergnügen sei. Gerade den ernsthaften Samm-
lern hat die Allgemeinheit viel zu danken. Sie
haben in einzelnen Fällen oft wertvolle wissen-
schaftliche Arbeit geleistet, sie erschließen
immer wieder künstlerisches Neuland, und
mancher weitblickende Museumsleiter hat es
sich angelegen sein lassen, sich zeitlebens
der tatkräftigen Mitarbeit
und der Gebefreudigkeit
kunstverständiger Samm-
ler zu bedienen.
Zum Bild des Samm-
lers gehören auch die
tragikomischen Verwick-
lungen, in die mancher
Kunstfreund verstrickt
wird, der zeitlebens sein
Herz in allzu großer
Leidenschaft nur an tote
Dinge gehängt hat. In
seinem köstlichen Roman
„Vetter Pons“ schildert
Balzac eine solche tragi-
komische Sammlernatur.
Wer könnte sich, wenn
er in diesem Buche liest,
des aufrichtigen Mit-
gefühls mit dem guten
Vetter Pons erwehren?
Er liegt todkrank auf
seinem Sterbebett, wäh-
rend die wertvollsten
seiner mühsam gesam-
melten Schätze durch die
Habgier seiner Haus-
hälterin und die gutgläu-
bige Dummheit seines
einzigen Freundes ver-
schleudert werden.
Hubert Wilm
C. O. Müller: Gattin des Künstlers, Öl
Ausstellung: Maximilianeum, München (Foto: Maximilianeuifl)
(vgl. Bericht in Nr. 19/20)
Gobelins, Antiquitäten
alte Textilien
s der Biede;
Qeer romantiS'
Landschaf
H s Südens m
*llJ Weite Met
'Mattungen
^/ke, aber au
t‘ Hoffmanns ;
lj ’°nen für S
.^men, für .
■ zum „D
C.^nsrin“, „
ÄGimt gewc
Stlder in der
^'weränderün
Ä'derts imme
l/M Behandl
f|ü' 'üenbildneri
tJ! durchgefü
(; lgt. Künstl
RÄnsatz zu
(Intern. Sie >
li Mls das B
^Uchtungsm
UiU6 re Voraus:
w, der Stimi
Sen ist.
Visehla
Äu Paris
<7 das Ge
Sthnmstrophe
lten- Das
Modernes.
peis/c1} bei c
franker
ßüd zeig:
baut. Nicht, daß ihm das Motiv gleichst
wäre. Im Gegenteil. Mit unendlicher Li/ Unter d >
versenkt er sich in die tausendfältigen St' Phantasie“
mungen der Lagune, der Adria, des Moores, iß i s c^U1
er immer wieder malt, ohne sich zu wie^^chlOß * .• /
holen. Bei einem Moorbild ist es ein bläulicTiUri(ier(., eine,
Streifen blühender Schwertlilien, bei
1buaute Schau
y/korationsent'
|,er°na und Sc
..Tiner Bühnt
Entwickl
./‘"riackswandi
.eÄnüber- in ä
t^Selt. Die n
I |/" Prospekte
. '’M in staub
>ahen, zeig
Fundusski
. ()ll<'n Farbenb
DIE WELTKUNST
Jahrg. XV, Nr, 27/28 vom
Das
ein halbes Hundert
'">W
^<1
MÜNCHEN 2
ALTE UND MODERNE GEMÄLDE
Münchner Kunsthandels-Gesellschaft
Kameradschaft der Künstler München e. V.
Antike Möbel
vornehme Wohnungseinrichtungen
Lenbachplatz
München
im Cramer-Klett-Palais
GEMÄLDE ERSTER MEISTER
MÜNCHEN 2, Ottostr. 9
Tel. 57 898
4
74 cm
Sammlung
sucht ständig zu kaufen
dratfuß bemalter Leinwand sind das eine Mal
nicht mehr wert als die Leinwand in verdorbe-
nem Zustand, ein anderes Mal jedoch Tausende,
ein drittes Mal Hunderttausende oder gar Mil-
lionen. Für ein Blatt Papier, das mit einer
Radierung bedruckt worden ist, können bei
gleicher Größe einmal fünf Pfennig, einmal
fünftausend, ja zuweilen fünfzigtausend und
mehr Mark bezahlt werden. Das Geheimnis
dieser ungeheuren Wertabstufungen liegt allein
im Wesen der künstlerischen Qualität begrün-
det — aber dies auch nur wieder in den Fällen,
in denen die Qualität vom Verkäufer richtig
erkannt worden ist. Wo dies nicht der Fall
war, ergaben sich noch seltsamere Möglich-
keiten. In den achtziger Jahren kaufte Wilhelm
v. Bode in einem bescheidenen Berliner Kunst-
laden einen kleinen Kopf von Rembrandt für
67 Mark, ein Bild, das heute einen Marktwert
von etwa 100 000 Mark besitzt. Ein Museum
verkaufte um die Mitte des vorigen Jahrhun-
derts ein Gemälde von Dürer für 65 Gulden;
das gleiche Bild erzielte im Jahre 1913
600 000 Mark.
Allgemein herrscht die Meinung, daß solche
Abstände der Bewertung nur bei alten Kunst-
werken vorkommen. Dies ist ein Irrtum: bei
der Kunst des neunzehnten Jahrhunderts sind
ähnliche Zufälle vorgekommen. Eines der Haupt-
werke von Caspar David Friedrich konnte in
den neunziger Jahren auf einer öffentlichen
Versteigerung in Deutschland für 38 Mark von
einem Museum erworben werden, heute würde
das gleiche Bild vermutlich mehr als 50 000 Mark
bringen. Als Menzel seinen siebzigsten Geburts-
tag beging, standen fast alle seine Hauptwerke
noch unverkauft in seinem Atelier; außer der
Berliner Nationalgalerie und dem Breslauer
Museum besaß kein deutsches Museum ein Ge-
mälde seiner Hand. Noch in der Zeit um 1870
hätte man mit einem Betrag, den heute ein
mittleres Bild von Menzel erzielt, eine ganze
Reihe seiner besten Werke mühelos erwerben
können. Dies sind nur einige Beispiele; sie
könnten um ein Vielfaches vermehrt werden.
Nun wird vielleicht jemand versucht sein zu
fragen, was diese Fälle versäumter Gelegen-
heiten und fehlerhafter Bewertungen mit dem
Kunstsammeln einst und jetzt zu tun haben.
Darauf müßte man erwidern, daß allein die
Kunstsammler aus angeborener Neigung es zu
allen Zeiten vermocht haben, herrenlos gewor-
denes oder zeitweise unverstandenes Kunstgut
für die Nation zu retten. Vor mehr als hundert
Jahren haben allein die rheinischen Sammler
Boisseree, Wallraf und Hübsch die mittelalter-
liche Kunst Kölns und des.Rhftinlancjes für alle
Zeiten gerettet, weil sie unschätzbare Kostbar-
keiten mit großen Opfern in ihren Besitz brach-
ten zu einem Zeitpunkt, wo niemand diese
Schätze nach Gebühr achtete. In anderen
Städten, die nicht das Glück hatten, im frühen
neunzehnten Jahrhundert solche Sammler und
Heimatforscher zu besitzen, ist vieles von der
wertvollen Hinterlassenschaft des deutschen
Mittelalters verlorengegangen oder zerstreut
worden, so in Hamburg, wo von den sechzig
mittelalterlichen Altären des Domes (die um
1805 noch vorhanden waren) heute nur mehr
ein einziges Tafelgemälde erhalten ist.
Gerade in kritischen Zeiten, wenn die Be-
wertung einzelner Gattungen von Kunstwerken
schwankt, gewinnt die Tätigkeit des Sammlers
eine kaum abzuschätzende Bedeutung. Er kann
das gefährdete Kunstgut auffinden, bewahren
und so der Nation vererben. Die geheimnisvolle
Möglichkeit, ungeahnte Entdeckungen zu
machen, bildet den größten Anreiz für einen
Sammler, der nicht etwa nur aus Lebenspolitik,
sondern aus tiefster, angeborener Neigung
sammelt.
Was ein echter Sammler ist, der muß Jäger-
blut haben. Das Wild muß sehr oft abseits vom
Wege entdeckt, eingekreist, gestellt, erlegt
werden, in mühsamer Arbeit und mit Hilfe einer
niemals versagenden, waidgerechten Tüchtig-
keit. Unvorhergesehene Schwierigkeiten er-
höhen den Reiz. Eine stets wache Aufmerksam-
keit, eine lückenlose Kenntnis aller kunst-
geschichtlichen Zusammenhänge sind die Vor-
bedingungen für eine erfolgreiche Arbeit des
Sammlers. So betrachtet, wird diese Tätigkeit,
trotz mancher herben Enttäuschungen, zu einer
Quelle hoher Befriedigung. Das war einstmals
so, und heute ist es nicht anders.
Es ist ein Irrtum, zu glauben, daß ein erfolg-
reiches Sammeln nur eine Geldfrage sei. Wie
häufig erzählen selbst große Sammler, daß viele
ihrer schönsten Erwerbungen, die sie in Kunst-
läden oder auf Versteigerungen machen konn-
ten, ein Nichts gekostet haben, und dies deshalb,
weil keiner vor ihnen die Stücke in ihrem
wahren Wert erkannt hatte. Die Gabe des
instinktiven Erkennes der künstlerischen Quali-
tät, die sich bei dem echten Sammler mit dem
Trieb und Vermögen des Forschers paart, sie
allein sichern auf die Dauer den Erfolg, den ein
weitausgehntes Wissen um das Wesen der
Kunstdinge vorbereitet. Der ernsthafte Samm-
ler opfert der Beschäftigung mit den von ihm
zusammengetragenen Kunstschätzen fast sein
halbes Leben. Die Aufstellung, die Sorge und
die Konservierung, die Katalogisierung einer
großen Sammlung erfordern eine dauernde und
mühevolle Beschäftigung. Man darf nicht glau-
ben, daß das Sammeln ein rein egoistisches
In dieser Gedächtnis-
ausstellung für Ludwig
Dill (1848—1940) sind über
seiner Werke vereinigt. Wenn man es noch
nicht wüßte, könnte man sich hier überzeugen,
daß dieser Künstler zu den großen Meistern
gehört, deren Name die Zeiten überdauert. Für
ihn ist Natur nicht nur Motiv, das man getreu-
lich wiederzugeben sucht, sondern der Werk-
stoff, mit dem er großzügig seine Bilder auf-
andern der weiße Schaum der Distelköpfe,
das Bild aufhellen, bei den Fischern von Chi1’
gia liegt der koloristische Schwerpunkt im11!
bei den orangebraunen Segeln. Figurenbild o,
Seestück, Moor- oder Waldlandschaft, alle s!
sie in sich gerundete Kunstwerke, die man "
anders gar nicht denken kann.
Ludwig F. r u c
Ludwig-Dill-
Ausstellung
bei Zinckgraf
in München
Vergnügen sei. Gerade den ernsthaften Samm-
lern hat die Allgemeinheit viel zu danken. Sie
haben in einzelnen Fällen oft wertvolle wissen-
schaftliche Arbeit geleistet, sie erschließen
immer wieder künstlerisches Neuland, und
mancher weitblickende Museumsleiter hat es
sich angelegen sein lassen, sich zeitlebens
der tatkräftigen Mitarbeit
und der Gebefreudigkeit
kunstverständiger Samm-
ler zu bedienen.
Zum Bild des Samm-
lers gehören auch die
tragikomischen Verwick-
lungen, in die mancher
Kunstfreund verstrickt
wird, der zeitlebens sein
Herz in allzu großer
Leidenschaft nur an tote
Dinge gehängt hat. In
seinem köstlichen Roman
„Vetter Pons“ schildert
Balzac eine solche tragi-
komische Sammlernatur.
Wer könnte sich, wenn
er in diesem Buche liest,
des aufrichtigen Mit-
gefühls mit dem guten
Vetter Pons erwehren?
Er liegt todkrank auf
seinem Sterbebett, wäh-
rend die wertvollsten
seiner mühsam gesam-
melten Schätze durch die
Habgier seiner Haus-
hälterin und die gutgläu-
bige Dummheit seines
einzigen Freundes ver-
schleudert werden.
Hubert Wilm
C. O. Müller: Gattin des Künstlers, Öl
Ausstellung: Maximilianeum, München (Foto: Maximilianeuifl)
(vgl. Bericht in Nr. 19/20)
Gobelins, Antiquitäten
alte Textilien
s der Biede;
Qeer romantiS'
Landschaf
H s Südens m
*llJ Weite Met
'Mattungen
^/ke, aber au
t‘ Hoffmanns ;
lj ’°nen für S
.^men, für .
■ zum „D
C.^nsrin“, „
ÄGimt gewc
Stlder in der
^'weränderün
Ä'derts imme
l/M Behandl
f|ü' 'üenbildneri
tJ! durchgefü
(; lgt. Künstl
RÄnsatz zu
(Intern. Sie >
li Mls das B
^Uchtungsm
UiU6 re Voraus:
w, der Stimi
Sen ist.
Visehla
Äu Paris
<7 das Ge
Sthnmstrophe
lten- Das
Modernes.
peis/c1} bei c
franker
ßüd zeig:
baut. Nicht, daß ihm das Motiv gleichst
wäre. Im Gegenteil. Mit unendlicher Li/ Unter d >
versenkt er sich in die tausendfältigen St' Phantasie“
mungen der Lagune, der Adria, des Moores, iß i s c^U1
er immer wieder malt, ohne sich zu wie^^chlOß * .• /
holen. Bei einem Moorbild ist es ein bläulicTiUri(ier(., eine,
Streifen blühender Schwertlilien, bei
1buaute Schau
y/korationsent'
|,er°na und Sc
..Tiner Bühnt
Entwickl
./‘"riackswandi
.eÄnüber- in ä
t^Selt. Die n
I |/" Prospekte
. '’M in staub
>ahen, zeig
Fundusski
. ()ll<'n Farbenb