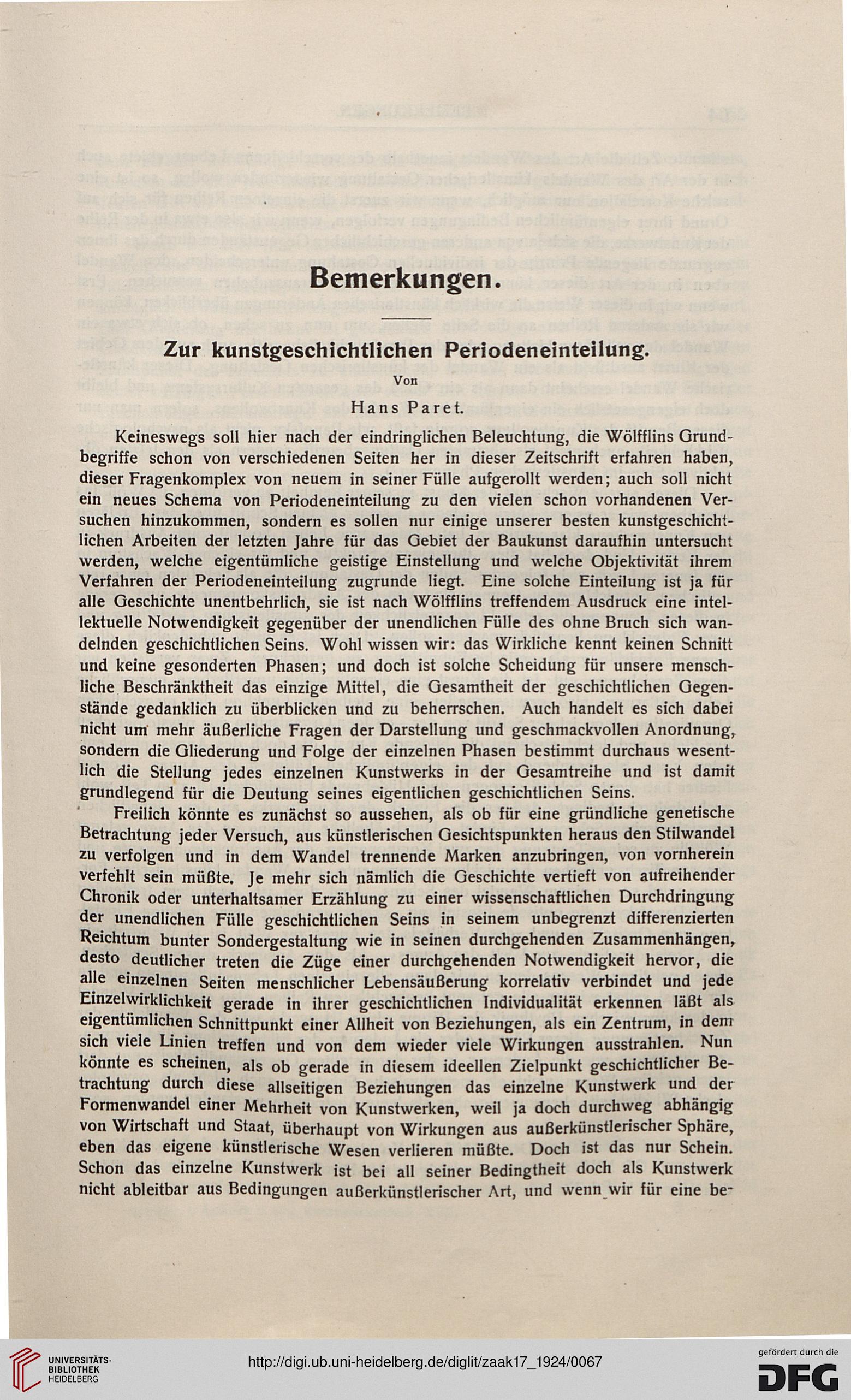Bemerkungen.
Zur kunstgeschichtlichen Periodeneinteiiung.
Von
Hans Paret.
Keineswegs soll hier nach der eindringlichen Beleuchtung, die Wölfflins Grund-
begriffe schon von verschiedenen Seiten her in dieser Zeitschrift erfahren haben,
dieser Fragenkomplex von neuem in seiner Fülle aufgerollt werden; auch soll nicht
ein neues Schema von Periodeneinteilung zu den vielen schon vorhandenen Ver-
suchen hinzukommen, sondern es sollen nur einige unserer besten kunstgeschicht-
lichen Arbeiten der letzten Jahre für das Gebiet der Baukunst daraufhin untersucht
werden, welche eigentümliche geistige Einstellung und welche Objektivität ihrem
Verfahren der Periodeneinteilung zugrunde liegt. Eine solche Einteilung ist ja für
alle Geschichte unentbehrlich, sie ist nach Wölfflins treffendem Ausdruck eine intel-
lektuelle Notwendigkeit gegenüber der unendlichen Fülle des ohne Bruch sich wan-
delnden geschichtlichen Seins. Wohl wissen wir: das Wirkliche kennt keinen Schnitt
und keine gesonderten Phasen; und doch ist solche Scheidung für unsere mensch-
liche Beschränktheit das einzige Mittel, die Gesamtheit der geschichtlichen Gegen-
stände gedanklich zu überblicken und zu beherrschen. Auch handelt es sich dabei
nicht um mehr äußerliche Fragen der Darstellung und geschmackvollen Anordnung,
sondern die Gliederung und Folge der einzelnen Phasen bestimmt durchaus wesent-
lich die Stellung jedes einzelnen Kunstwerks in der Gesamtreihe und ist damit
grundlegend für die Deutung seines eigentlichen geschichtlichen Seins.
Freilich könnte es zunächst so aussehen, als ob für eine gründliche genetische
Betrachtung jeder Versuch, aus künstlerischen Gesichtspunkten heraus den Stilwandel
zu verfolgen und in dem Wandel trennende Marken anzubringen, von vornherein
verfehlt sein müßte. Je mehr sich nämlich die Geschichte vertieft von aufreihender
Chronik oder unterhaltsamer Erzählung zu einer wissenschaftlichen Durchdringung
der unendlichen Fülle geschichtlichen Seins in seinem unbegrenzt differenzierten
Reichtum bunter Sondergestaltung wie in seinen durchgehenden Zusammenhängen,
desto deutlicher treten die Züge einer durchgehenden Notwendigkeit hervor, die
alle einzelnen Seiten menschlicher Lebensäußerung korrelativ verbindet und jede
Einzelwirklichkeit gerade in ihrer geschichtlichen Individualität erkennen läßt als
eigentümlichen Schnittpunkt einer Allheit von Beziehungen, als ein Zentrum, in dem
sich viele Linien treffen und von dem wieder viele Wirkungen ausstrahlen. Nun
könnte es scheinen, als ob gerade in diesem ideellen Zielpunkt geschichtlicher Be-
trachtung durch diese allseitigen Beziehungen das einzelne Kunstwerk und der
Formenwandel einer Mehrheit von Kunstwerken, weil ja doch durchweg abhängig
von Wirtschaft und Staat, überhaupt von Wirkungen aus außerkünstlerischer Sphäre,
eben das eigene künstlerische Wesen verlieren müßte. Doch ist das nur Schein.
Schon das einzelne Kunstwerk ist bei all seiner Bedingtheit doch als Kunstwerk
nicht ableitbar aus Bedingungen außerkünstlerischer Art, und wenn wir für eine be-
Zur kunstgeschichtlichen Periodeneinteiiung.
Von
Hans Paret.
Keineswegs soll hier nach der eindringlichen Beleuchtung, die Wölfflins Grund-
begriffe schon von verschiedenen Seiten her in dieser Zeitschrift erfahren haben,
dieser Fragenkomplex von neuem in seiner Fülle aufgerollt werden; auch soll nicht
ein neues Schema von Periodeneinteilung zu den vielen schon vorhandenen Ver-
suchen hinzukommen, sondern es sollen nur einige unserer besten kunstgeschicht-
lichen Arbeiten der letzten Jahre für das Gebiet der Baukunst daraufhin untersucht
werden, welche eigentümliche geistige Einstellung und welche Objektivität ihrem
Verfahren der Periodeneinteilung zugrunde liegt. Eine solche Einteilung ist ja für
alle Geschichte unentbehrlich, sie ist nach Wölfflins treffendem Ausdruck eine intel-
lektuelle Notwendigkeit gegenüber der unendlichen Fülle des ohne Bruch sich wan-
delnden geschichtlichen Seins. Wohl wissen wir: das Wirkliche kennt keinen Schnitt
und keine gesonderten Phasen; und doch ist solche Scheidung für unsere mensch-
liche Beschränktheit das einzige Mittel, die Gesamtheit der geschichtlichen Gegen-
stände gedanklich zu überblicken und zu beherrschen. Auch handelt es sich dabei
nicht um mehr äußerliche Fragen der Darstellung und geschmackvollen Anordnung,
sondern die Gliederung und Folge der einzelnen Phasen bestimmt durchaus wesent-
lich die Stellung jedes einzelnen Kunstwerks in der Gesamtreihe und ist damit
grundlegend für die Deutung seines eigentlichen geschichtlichen Seins.
Freilich könnte es zunächst so aussehen, als ob für eine gründliche genetische
Betrachtung jeder Versuch, aus künstlerischen Gesichtspunkten heraus den Stilwandel
zu verfolgen und in dem Wandel trennende Marken anzubringen, von vornherein
verfehlt sein müßte. Je mehr sich nämlich die Geschichte vertieft von aufreihender
Chronik oder unterhaltsamer Erzählung zu einer wissenschaftlichen Durchdringung
der unendlichen Fülle geschichtlichen Seins in seinem unbegrenzt differenzierten
Reichtum bunter Sondergestaltung wie in seinen durchgehenden Zusammenhängen,
desto deutlicher treten die Züge einer durchgehenden Notwendigkeit hervor, die
alle einzelnen Seiten menschlicher Lebensäußerung korrelativ verbindet und jede
Einzelwirklichkeit gerade in ihrer geschichtlichen Individualität erkennen läßt als
eigentümlichen Schnittpunkt einer Allheit von Beziehungen, als ein Zentrum, in dem
sich viele Linien treffen und von dem wieder viele Wirkungen ausstrahlen. Nun
könnte es scheinen, als ob gerade in diesem ideellen Zielpunkt geschichtlicher Be-
trachtung durch diese allseitigen Beziehungen das einzelne Kunstwerk und der
Formenwandel einer Mehrheit von Kunstwerken, weil ja doch durchweg abhängig
von Wirtschaft und Staat, überhaupt von Wirkungen aus außerkünstlerischer Sphäre,
eben das eigene künstlerische Wesen verlieren müßte. Doch ist das nur Schein.
Schon das einzelne Kunstwerk ist bei all seiner Bedingtheit doch als Kunstwerk
nicht ableitbar aus Bedingungen außerkünstlerischer Art, und wenn wir für eine be-