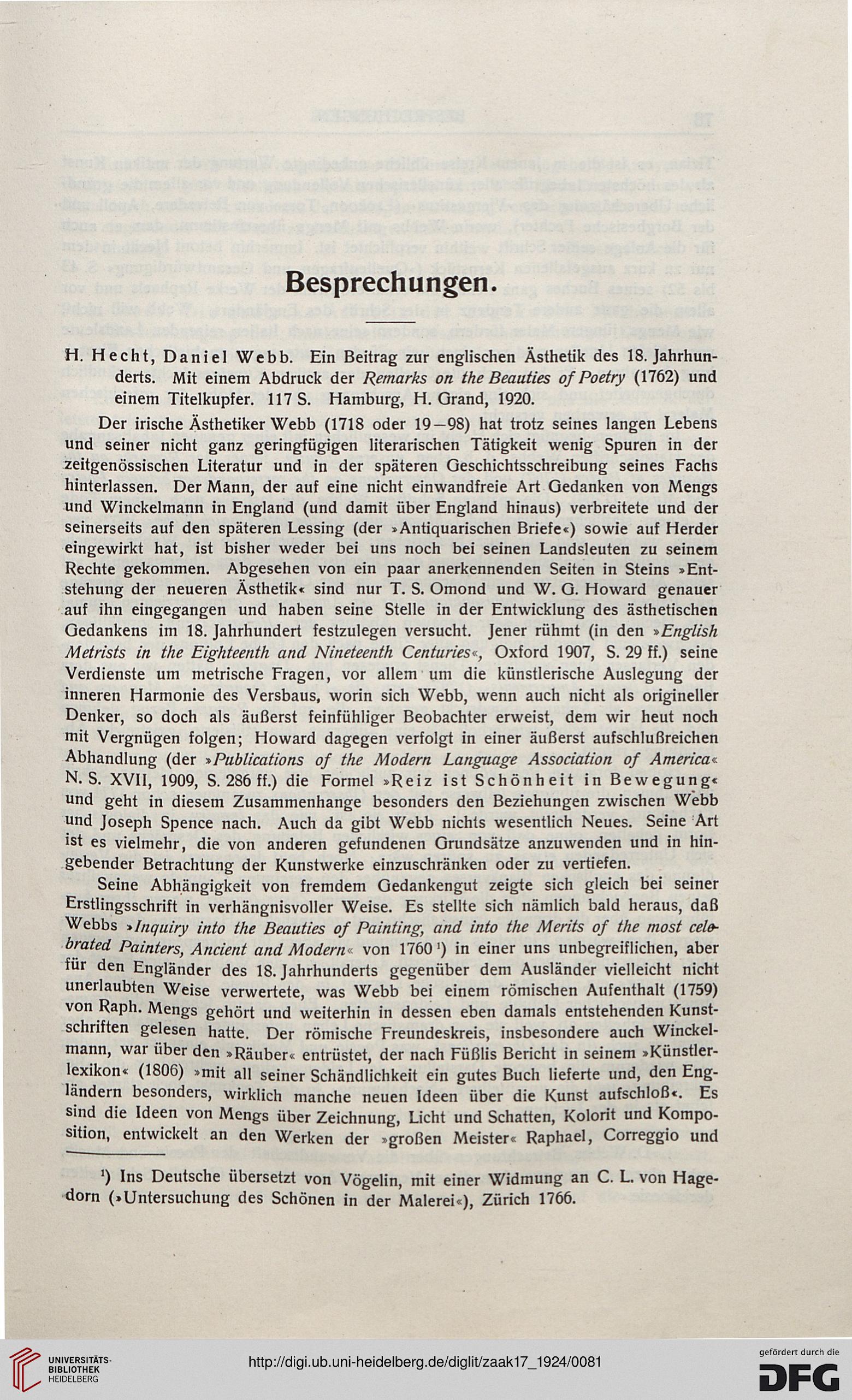Besprechungen.
H. Hecht, Daniel Webb. Ein Beitrag zur englischen Ästhetik des 18. Jahrhun-
derts. Mit einem Abdruck der Remarks ort the Beauties of Poetry (1762) und
einem Titelkupfer. 117 S. Hamburg, H. Grand, 1920.
Der irische Ästhetiker Webb (1718 oder 19—98) hat trotz seines langen Lebens
und seiner nicht ganz geringfügigen literarischen Tätigkeit wenig Spuren in der
zeitgenössischen Literatur und in der späteren Geschichtsschreibung seines Fachs
hinterlassen. Der Mann, der auf eine nicht einwandfreie Art Gedanken von Mengs
und Winckelmann in England (und damit über England hinaus) verbreitete und der
seinerseits auf den späteren Lessing (der »Antiquarischen Briefe«) sowie auf Herder
eingewirkt hat, ist bisher weder bei uns noch bei seinen Landsleuten zu seinem
Rechte gekommen. Abgesehen von ein paar anerkennenden Seiten in Steins »Ent-
stehung der neueren Ästhetik« sind nur T. S. Omond und W. G. Howard genauer
auf ihn eingegangen und haben seine Stelle in der Entwicklung des ästhetischen
Gedankens im 18. Jahrhundert festzulegen versucht. Jener rühmt (in den »English
Metrists in the Eighteenth and Nineteenth Centuries«, Oxford 1907, S. 29 ff.) seine
Verdienste um metrische Fragen, vor allem um die künstlerische Auslegung der
inneren Harmonie des Versbaus, worin sich Webb, wenn auch nicht als origineller
Denker, so doch als äußerst feinfühliger Beobachter erweist, dem wir heut noch
mit Vergnügen folgen; Howard dagegen verfolgt in einer äußerst aufschlußreichen
Abhandlung (der »Publications of the Modern Language Association of America':.
N. S. XVII, 1909, S. 286 ff.) die Formel »Reiz ist Schönheit in Bewegung«
und geht in diesem Zusammenhange besonders den Beziehungen zwischen Webb
und Joseph Spence nach. Auch da gibt Webb nichts wesentlich Neues. Seine Art
'st es vielmehr, die von anderen gefundenen Grundsätze anzuwenden und in hin-
gebender Betrachtung der Kunstwerke einzuschränken oder zu vertiefen.
Seine Abhängigkeit von fremdem Gedankengut zeigte sich gleich bei seiner
Erstlingsschrift in verhängnisvoller Weise. Es stellte sich nämlich bald heraus, daß
Webbs tlnquiry into the Beauties of Painting, and Mo the Merits of the most cele-
brated Painters, Ancient and Modern« von 1760') in einer uns unbegreiflichen, aber
für den Engländer des 18. Jahrhunderts gegenüber dem Ausländer vielleicht nicht
unerlaubten Weise verwertete, was Webb bei einem römischen Aufenthalt (1759)
von Raph. Mengs gehört und weiterhin in dessen eben damals entstehenden Kunst-
schriften gelesen hatte. Der römische Freundeskreis, insbesondere auch Winckel-
mann, war über den »Räuber« entrüstet, der nach Füßlis Bericht in seinem »Künstler-
lexikon« (1806) »mit all seiner Schändlichkeit ein gutes Buch lieferte und, den Eng-
ländern besonders, wirklich manche neuen Ideen über die Kunst aufschloß«. Es
sind die Ideen von Mengs über Zeichnung, Licht und Schatten, Kolorit und Kompo-
sition, entwickelt an den Werken der »großen Meister« Raphael, Correggio und
:) Ins Deutsche übersetzt von Vögelin, mit einer Widmung an C. L. von Hage-
dorn (»Untersuchung des Schönen in der Malerei«), Zürich 1766.
H. Hecht, Daniel Webb. Ein Beitrag zur englischen Ästhetik des 18. Jahrhun-
derts. Mit einem Abdruck der Remarks ort the Beauties of Poetry (1762) und
einem Titelkupfer. 117 S. Hamburg, H. Grand, 1920.
Der irische Ästhetiker Webb (1718 oder 19—98) hat trotz seines langen Lebens
und seiner nicht ganz geringfügigen literarischen Tätigkeit wenig Spuren in der
zeitgenössischen Literatur und in der späteren Geschichtsschreibung seines Fachs
hinterlassen. Der Mann, der auf eine nicht einwandfreie Art Gedanken von Mengs
und Winckelmann in England (und damit über England hinaus) verbreitete und der
seinerseits auf den späteren Lessing (der »Antiquarischen Briefe«) sowie auf Herder
eingewirkt hat, ist bisher weder bei uns noch bei seinen Landsleuten zu seinem
Rechte gekommen. Abgesehen von ein paar anerkennenden Seiten in Steins »Ent-
stehung der neueren Ästhetik« sind nur T. S. Omond und W. G. Howard genauer
auf ihn eingegangen und haben seine Stelle in der Entwicklung des ästhetischen
Gedankens im 18. Jahrhundert festzulegen versucht. Jener rühmt (in den »English
Metrists in the Eighteenth and Nineteenth Centuries«, Oxford 1907, S. 29 ff.) seine
Verdienste um metrische Fragen, vor allem um die künstlerische Auslegung der
inneren Harmonie des Versbaus, worin sich Webb, wenn auch nicht als origineller
Denker, so doch als äußerst feinfühliger Beobachter erweist, dem wir heut noch
mit Vergnügen folgen; Howard dagegen verfolgt in einer äußerst aufschlußreichen
Abhandlung (der »Publications of the Modern Language Association of America':.
N. S. XVII, 1909, S. 286 ff.) die Formel »Reiz ist Schönheit in Bewegung«
und geht in diesem Zusammenhange besonders den Beziehungen zwischen Webb
und Joseph Spence nach. Auch da gibt Webb nichts wesentlich Neues. Seine Art
'st es vielmehr, die von anderen gefundenen Grundsätze anzuwenden und in hin-
gebender Betrachtung der Kunstwerke einzuschränken oder zu vertiefen.
Seine Abhängigkeit von fremdem Gedankengut zeigte sich gleich bei seiner
Erstlingsschrift in verhängnisvoller Weise. Es stellte sich nämlich bald heraus, daß
Webbs tlnquiry into the Beauties of Painting, and Mo the Merits of the most cele-
brated Painters, Ancient and Modern« von 1760') in einer uns unbegreiflichen, aber
für den Engländer des 18. Jahrhunderts gegenüber dem Ausländer vielleicht nicht
unerlaubten Weise verwertete, was Webb bei einem römischen Aufenthalt (1759)
von Raph. Mengs gehört und weiterhin in dessen eben damals entstehenden Kunst-
schriften gelesen hatte. Der römische Freundeskreis, insbesondere auch Winckel-
mann, war über den »Räuber« entrüstet, der nach Füßlis Bericht in seinem »Künstler-
lexikon« (1806) »mit all seiner Schändlichkeit ein gutes Buch lieferte und, den Eng-
ländern besonders, wirklich manche neuen Ideen über die Kunst aufschloß«. Es
sind die Ideen von Mengs über Zeichnung, Licht und Schatten, Kolorit und Kompo-
sition, entwickelt an den Werken der »großen Meister« Raphael, Correggio und
:) Ins Deutsche übersetzt von Vögelin, mit einer Widmung an C. L. von Hage-
dorn (»Untersuchung des Schönen in der Malerei«), Zürich 1766.