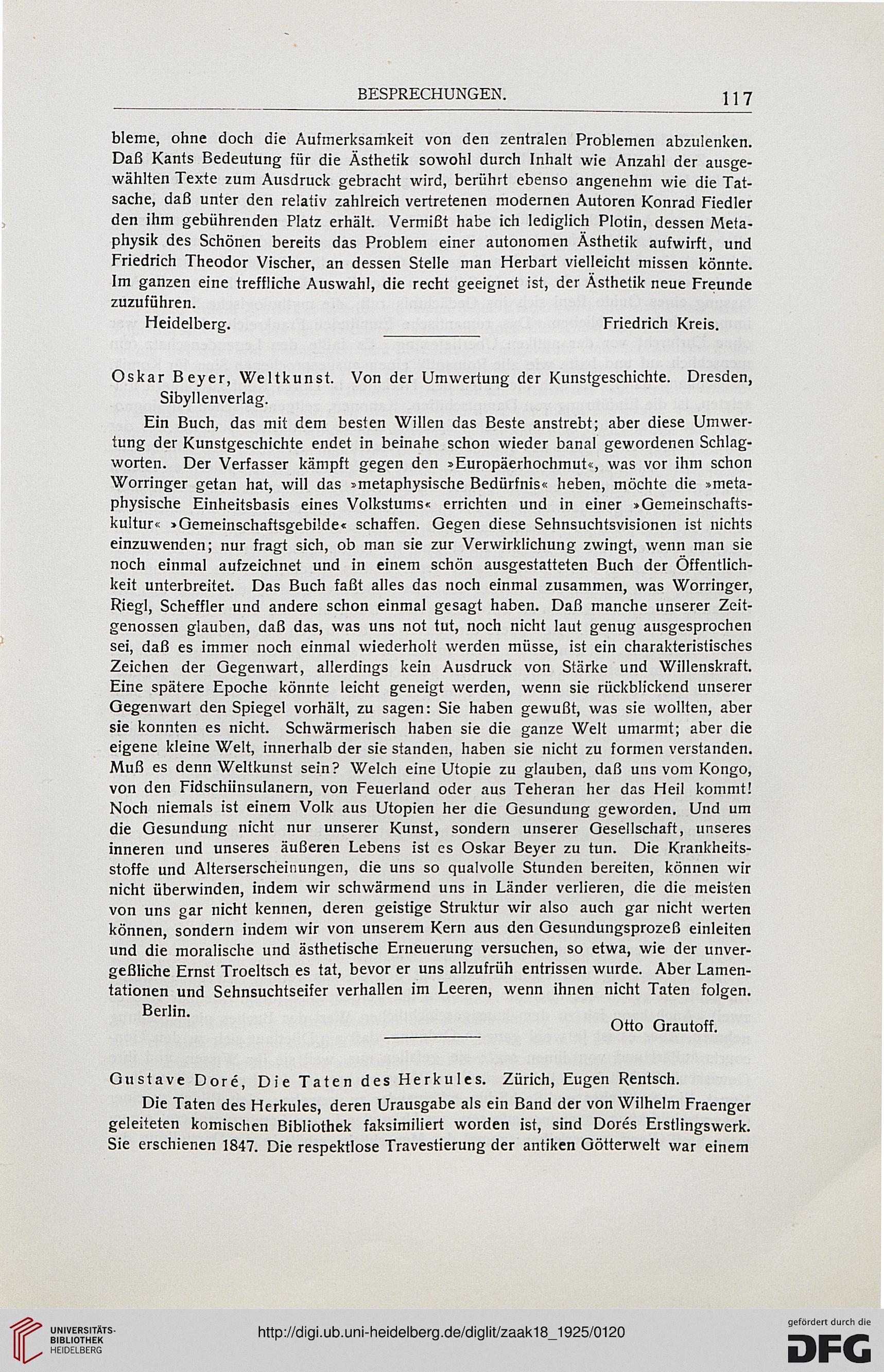BESPRECHUNGEN. 1 ] 7
bleme, ohne doch die Aufmerksamkeit von den zentralen Problemen abzulenken.
Daß Kants Bedeutung für die Ästhetik sowohl durch Inhalt wie Anzahl der ausge-
wählten Texte zum Ausdruck gebracht wird, berührt ebenso angenehm wie die Tat-
sache, daß unter den relativ zahlreich vertretenen modernen Autoren Konrad Fiedler
den ihm gebührenden Platz erhält. Vermißt habe ich lediglich Plotin, dessen Meta-
physik des Schönen bereits das Problem einer autonomen Ästhetik aufwirft, und
Friedrich Theodor Vischer, an dessen Stelle man Herbart vielleicht missen könnte.
Im ganzen eine treffliche Auswahl, die recht geeignet ist, der Ästhetik neue Freunde
zuzuführen.
Heidelberg. Friedrich Kreis.
Oskar Beyer, Weltkunst. Von der Umwertung der Kunstgeschichte. Dresden,
Sibyllenverlag.
Ein Buch, das mit dem besten Willen das Beste anstrebt; aber diese Umwer-
tung der Kunstgeschichte endet in beinahe schon wieder banal gewordenen Schlag-
worten. Der Verfasser kämpft gegen den »Europäerhochmut«, was vor ihm schon
Worringer getan hat, will das »metaphysische Bedürfnis« heben, möchte die »meta-
physische Einheitsbasis eines Volkstums« errichten und in einer »Gemeinschafts-
kultur« »Gemeinschaftsgebüde« schaffen. Gegen diese Sehnsuchtsvisionen ist nichts
einzuwenden; nur fragt sich, ob man sie zur Verwirklichung zwingt, wenn man sie
noch einmal aufzeichnet und in einem schön ausgestatteten Buch der Öffentlich-
keit unterbreitet. Das Buch faßt alles das noch einmal zusammen, was Worringer,
Riegl, Scheffler und andere schon einmal gesagt haben. Daß manche unserer Zeit-
genossen glauben, daß das, was uns not tut, noch nicht laut genug ausgesprochen
sei, daß es immer noch einmal wiederholt werden müsse, ist ein charakteristisches
Zeichen der Gegenwart, allerdings kein Ausdruck von Stärke und Willenskraft.
Eine spätere Epoche könnte leicht geneigt werden, wenn sie rückblickend unserer
Gegenwart den Spiegel vorhält, zu sagen: Sie haben gewußt, was sie wollten, aber
sie konnten es nicht. Schwärmerisch haben sie die ganze Welt umarmt; aber die
eigene kleine Welt, innerhalb der sie standen, haben sie nicht zu formen verstanden.
Muß es denn Weltkunst sein? Welch eine Utopie zu glauben, daß uns vom Kongo,
von den Fidschiinsulanern, von Feuerland oder aus Teheran her das Heil kommt!
Noch niemals ist einem Volk aus Utopien her die Gesundung geworden. Und um
die Gesundung nicht nur unserer Kunst, sondern unserer Gesellschaft, unseres
inneren und unseres äußeren Lebens ist es Oskar Beyer zu tun. Die Krankheits-
stoffe und Alterserscheinungen, die uns so qualvolle Stunden bereiten, können wir
nicht überwinden, indem wir schwärmend uns in Länder verlieren, die die meisten
von uns gar nicht kennen, deren geistige Struktur wir also auch gar nicht werten
können, sondern indem wir von unserem Kern aus den Gesundungsprozeß einleiten
und die moralische und ästhetische Erneuerung versuchen, so etwa, wie der unver-
geßliche Ernst Troeltsch es tat, bevor er uns allzufrüh entrissen wurde. Aber Lamen-
tationen und Sehnsuchtseifer verhallen im Leeren, wenn ihnen nicht Taten folgen.
Berlin.
___________ Otto Grautoff.
Gustave Dore, Die Taten des Herkules. Zürich, Eugen Rentsch.
Die Taten des Herkules, deren Urausgabe als ein Band der von Wilhelm Fraenger
geleiteten komischen Bibliothek faksimiliert worden ist, sind Dores Erstlingswerk.
Sie erschienen 1847. Die respektlose Travestierung der antiken Götterwelt war einem
bleme, ohne doch die Aufmerksamkeit von den zentralen Problemen abzulenken.
Daß Kants Bedeutung für die Ästhetik sowohl durch Inhalt wie Anzahl der ausge-
wählten Texte zum Ausdruck gebracht wird, berührt ebenso angenehm wie die Tat-
sache, daß unter den relativ zahlreich vertretenen modernen Autoren Konrad Fiedler
den ihm gebührenden Platz erhält. Vermißt habe ich lediglich Plotin, dessen Meta-
physik des Schönen bereits das Problem einer autonomen Ästhetik aufwirft, und
Friedrich Theodor Vischer, an dessen Stelle man Herbart vielleicht missen könnte.
Im ganzen eine treffliche Auswahl, die recht geeignet ist, der Ästhetik neue Freunde
zuzuführen.
Heidelberg. Friedrich Kreis.
Oskar Beyer, Weltkunst. Von der Umwertung der Kunstgeschichte. Dresden,
Sibyllenverlag.
Ein Buch, das mit dem besten Willen das Beste anstrebt; aber diese Umwer-
tung der Kunstgeschichte endet in beinahe schon wieder banal gewordenen Schlag-
worten. Der Verfasser kämpft gegen den »Europäerhochmut«, was vor ihm schon
Worringer getan hat, will das »metaphysische Bedürfnis« heben, möchte die »meta-
physische Einheitsbasis eines Volkstums« errichten und in einer »Gemeinschafts-
kultur« »Gemeinschaftsgebüde« schaffen. Gegen diese Sehnsuchtsvisionen ist nichts
einzuwenden; nur fragt sich, ob man sie zur Verwirklichung zwingt, wenn man sie
noch einmal aufzeichnet und in einem schön ausgestatteten Buch der Öffentlich-
keit unterbreitet. Das Buch faßt alles das noch einmal zusammen, was Worringer,
Riegl, Scheffler und andere schon einmal gesagt haben. Daß manche unserer Zeit-
genossen glauben, daß das, was uns not tut, noch nicht laut genug ausgesprochen
sei, daß es immer noch einmal wiederholt werden müsse, ist ein charakteristisches
Zeichen der Gegenwart, allerdings kein Ausdruck von Stärke und Willenskraft.
Eine spätere Epoche könnte leicht geneigt werden, wenn sie rückblickend unserer
Gegenwart den Spiegel vorhält, zu sagen: Sie haben gewußt, was sie wollten, aber
sie konnten es nicht. Schwärmerisch haben sie die ganze Welt umarmt; aber die
eigene kleine Welt, innerhalb der sie standen, haben sie nicht zu formen verstanden.
Muß es denn Weltkunst sein? Welch eine Utopie zu glauben, daß uns vom Kongo,
von den Fidschiinsulanern, von Feuerland oder aus Teheran her das Heil kommt!
Noch niemals ist einem Volk aus Utopien her die Gesundung geworden. Und um
die Gesundung nicht nur unserer Kunst, sondern unserer Gesellschaft, unseres
inneren und unseres äußeren Lebens ist es Oskar Beyer zu tun. Die Krankheits-
stoffe und Alterserscheinungen, die uns so qualvolle Stunden bereiten, können wir
nicht überwinden, indem wir schwärmend uns in Länder verlieren, die die meisten
von uns gar nicht kennen, deren geistige Struktur wir also auch gar nicht werten
können, sondern indem wir von unserem Kern aus den Gesundungsprozeß einleiten
und die moralische und ästhetische Erneuerung versuchen, so etwa, wie der unver-
geßliche Ernst Troeltsch es tat, bevor er uns allzufrüh entrissen wurde. Aber Lamen-
tationen und Sehnsuchtseifer verhallen im Leeren, wenn ihnen nicht Taten folgen.
Berlin.
___________ Otto Grautoff.
Gustave Dore, Die Taten des Herkules. Zürich, Eugen Rentsch.
Die Taten des Herkules, deren Urausgabe als ein Band der von Wilhelm Fraenger
geleiteten komischen Bibliothek faksimiliert worden ist, sind Dores Erstlingswerk.
Sie erschienen 1847. Die respektlose Travestierung der antiken Götterwelt war einem