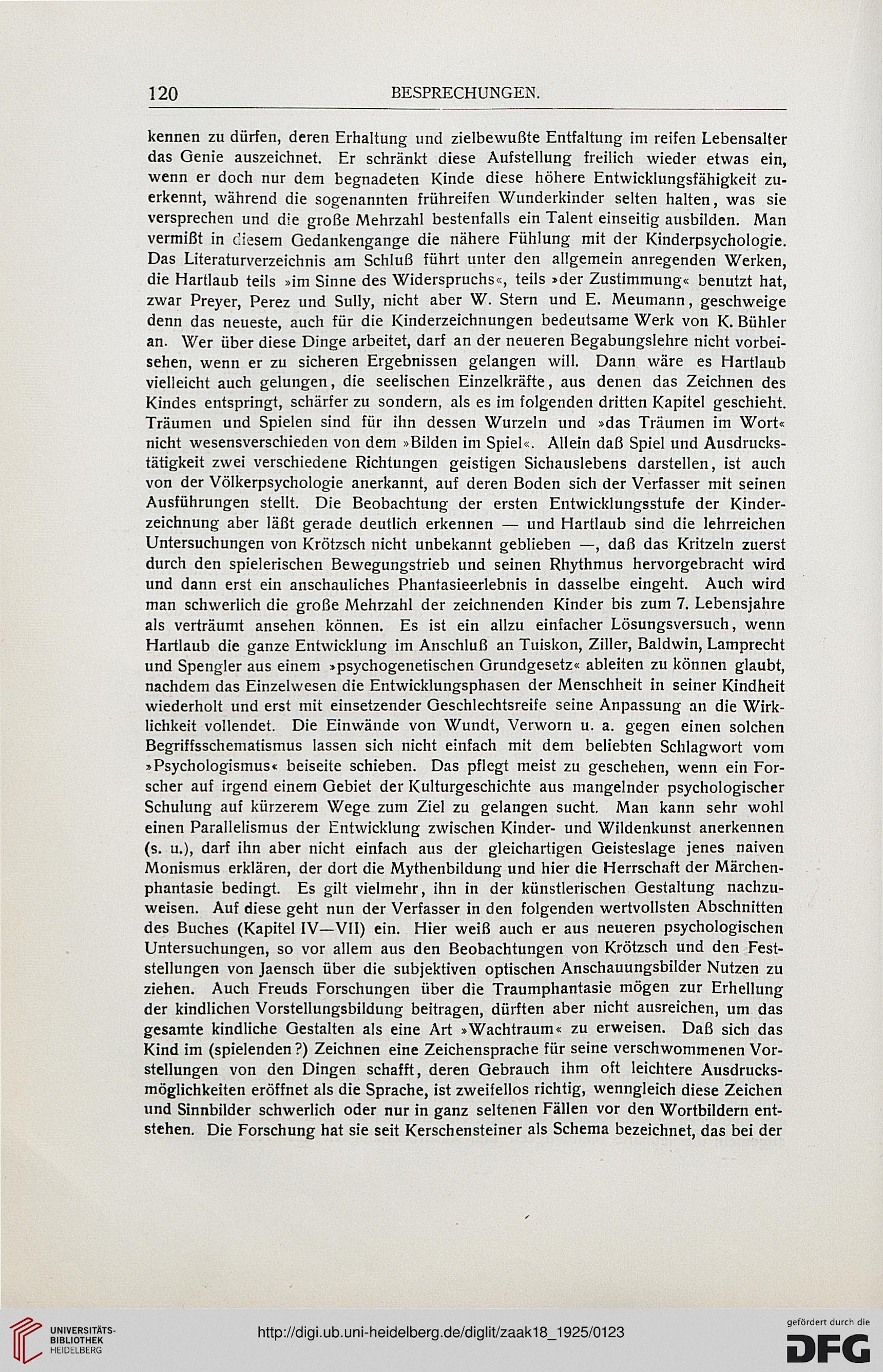120 BESPRECHUNGEN.
kennen zu dürfen, deren Erhaltung und zielbewußte Entfaltung im reifen Lebensalter
das Genie auszeichnet. Er schränkt diese Aufstellung freilich wieder etwas ein,
wenn er doch nur dem begnadeten Kinde diese höhere Entwicklungsfähigkeit zu-
erkennt, während die sogenannten frühreifen Wunderkinder selten halten, was sie
versprechen und die große Mehrzahl bestenfalls ein Talent einseitig ausbilden. Man
vermißt in diesem Gedankengange die nähere Fühlung mit der Kinderpsychologie.
Das Literaturverzeichnis am Schluß führt unter den allgemein anregenden Werken,
die Hartlaub teils »im Sinne des Widerspruchs«, teils »der Zustimmung« benutzt hat,
zwar Preyer, Perez und Sully, nicht aber W. Stern und E. Meumann, geschweige
denn das neueste, auch für die Kinderzeichnungen bedeutsame Werk von K. Bühler
an. Wer über diese Dinge arbeitet, darf an der neueren Begabungslehre nicht vorbei-
sehen, wenn er zu sicheren Ergebnissen gelangen will. Dann wäre es Hartlaub
vielleicht auch gelungen, die seelischen Einzelkräfte, aus denen das Zeichnen des
Kindes entspringt, schärfer zu sondern, als es im folgenden dritten Kapitel geschieht.
Träumen und Spielen sind für ihn dessen Wurzeln und »das Träumen im Wort«
nicht wesensverschieden von dem »Bilden im Spiel«. Allein daß Spiel und Ausdrucks-
tätigkeit zwei verschiedene Richtungen geistigen Sichauslebens darstellen, ist auch
von der Völkerpsychologie anerkannt, auf deren Boden sich der Verfasser mit seinen
Ausführungen stellt. Die Beobachtung der ersten Entwicklungsstufe der Kinder-
zeichnung aber läßt gerade deutlich erkennen — und Hartlaub sind die lehrreichen
Untersuchungen von Krötzsch nicht unbekannt geblieben —, daß das Kritzeln zuerst
durch den spielerischen Bewegungstrieb und seinen Rhythmus hervorgebracht wird
und dann erst ein anschauliches Phantasieerlebnis in dasselbe eingeht. Auch wird
man schwerlich die große Mehrzahl der zeichnenden Kinder bis zum 7. Lebensjahre
als verträumt ansehen können. Es ist ein allzu einfacher Lösungsversuch, wenn
Hartlaub die ganze Entwicklung im Anschluß an Tuiskon, Ziller, Baldwin, Lamprecht
und Spengler aus einem »psychogenetischen Grundgesetz« ableiten zu können glaubt,
nachdem das Einzelwesen die Entwicklungsphasen der Menschheit in seiner Kindheit
wiederholt und erst mit einsetzender Geschlechtsreife seine Anpassung an die Wirk-
lichkeit vollendet. Die Einwände von Wundt, Verworn u. a. gegen einen solchen
Begriffsschematismus lassen sich nicht einfach mit dem beliebten Schlagwort vom
»Psychologismus« beiseite schieben. Das pflegt meist zu geschehen, wenn ein For-
scher auf irgend einem Gebiet der Kulturgeschichte aus mangelnder psychologischer
Schulung auf kürzerem Wege zum Ziel zu gelangen sucht. Man kann sehr wohl
einen Parallelismus der Entwicklung zwischen Kinder- und Wildenkunst anerkennen
(s. u.), darf ihn aber nicht einfach aus der gleichartigen Geisteslage jenes naiven
Monismus erklären, der dort die Mythenbildung und hier die Herrschaft der Märchen-
phantasie bedingt. Es gilt vielmehr, ihn in der künstlerischen Gestaltung nachzu-
weisen. Auf diese geht nun der Verfasser in den folgenden wertvollsten Abschnitten
des Buches (Kapitel IV—VII) ein. Hier weiß auch er aus neueren psychologischen
Untersuchungen, so vor allem aus den Beobachtungen von Krötzsch und den Fest-
stellungen von Jaensch über die subjektiven optischen Anschauungsbilder Nutzen zu
ziehen. Auch Freuds Forschungen über die Traumphantasie mögen zur Erhellung
der kindlichen Vorstellungsbildung beitragen, dürften aber nicht ausreichen, um das
gesamte kindliche Gestalten als eine Art »Wachtraum« zu erweisen. Daß sich das
Kind im (spielenden?) Zeichnen eine Zeichensprache für seine verschwommenen Vor-
stellungen von den Dingen schafft, deren Gebrauch ihm oft leichtere Ausdrucks-
möglichkeiten eröffnet als die Sprache, ist zweifellos richtig, wenngleich diese Zeichen
und Sinnbilder schwerlich oder nur in ganz seltenen Fällen vor den Wortbildern ent-
stehen. Die Forschung hat sie seit Kerschensteiner als Schema bezeichnet, das bei der