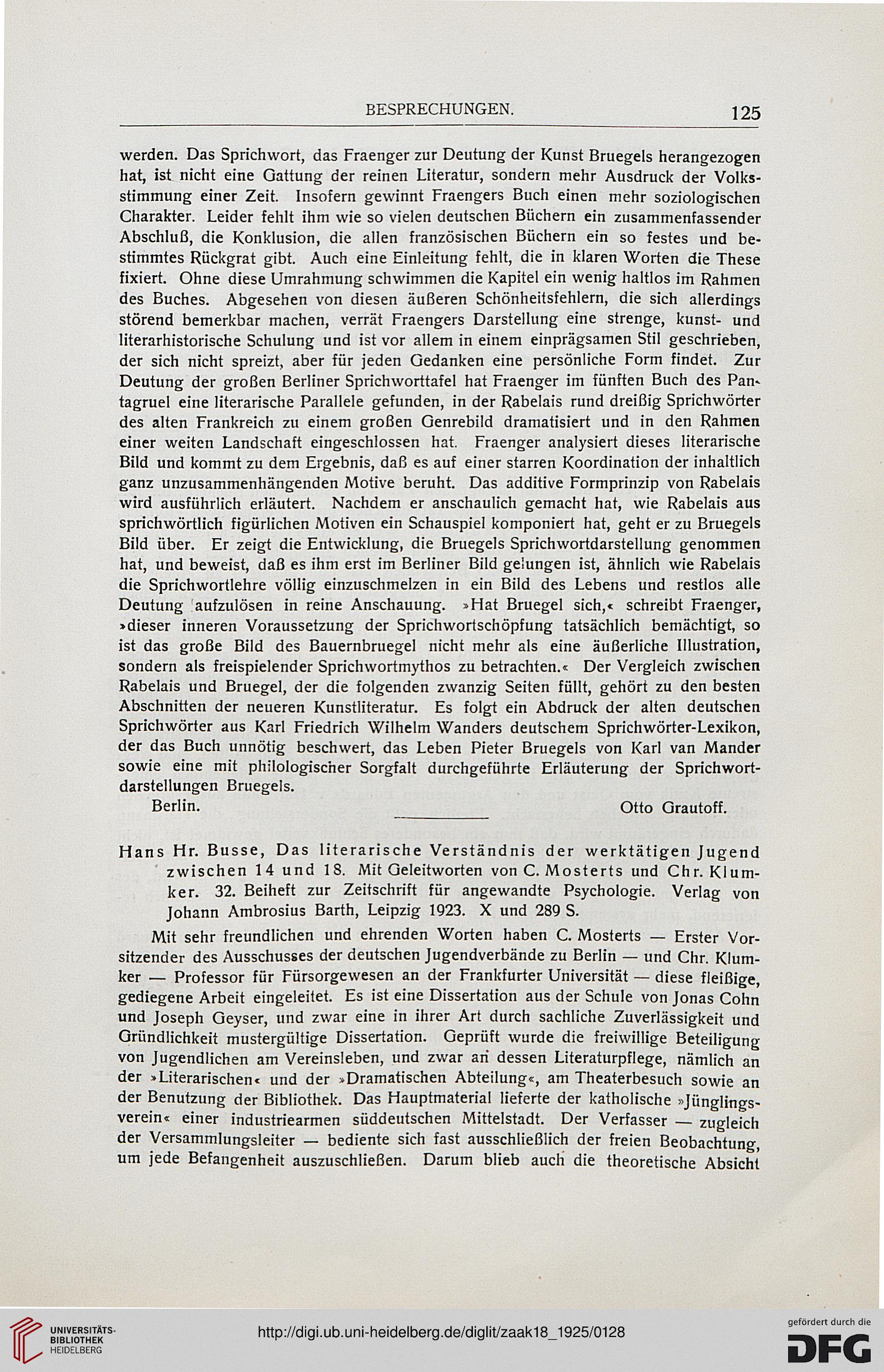BESPRECHUNGEN. } 25
werden. Das Sprichwort, das Fraenger zur Deutung der Kunst Bruegels herangezogen
hat, ist nicht eine Gattung der reinen Literatur, sondern mehr Ausdruck der Volks-
stimmung einer Zeit. Insofern gewinnt Fraengers Buch einen mehr soziologischen
Charakter. Leider fehlt ihm wie so vielen deutschen Büchern ein zusammenfassender
Abschluß, die Konklusion, die allen französischen Büchern ein so festes und be-
stimmtes Rückgrat gibt. Auch eine Einleitung fehlt, die in klaren Worten die These
fixiert. Ohne diese Umrahmung schwimmen die Kapitel ein wenig haltlos im Rahmen
des Buches. Abgesehen von diesen äußeren Schönheitsfehlern, die sich allerdings
störend bemerkbar machen, verrät Fraengers Darstellung eine strenge, kunst- und
literarhistorische Schulung und ist vor allem in einem einprägsamen Stil geschrieben,
der sich nicht spreizt, aber für jeden Gedanken eine persönliche Form findet. Zur
Deutung der großen Berliner Sprichworttafel hat Fraenger im fünften Buch des Pan-
tagruel eine literarische Parallele gefunden, in der Rabelais rund dreißig Sprichwörter
des alten Frankreich zu einem großen Genrebild dramatisiert und in den Rahmen
einer weiten Landschaft eingeschlossen hat. Fraenger analysiert dieses literarische
Bild und kommt zu dem Ergebnis, daß es auf einer starren Koordination der inhaltlich
ganz unzusammenhängenden Motive beruht. Das additive Formprinzip von Rabelais
wird ausführlich erläutert. Nachdem er anschaulich gemacht hat, wie Rabelais aus
sprichwörtlich figürlichen Motiven ein Schauspiel komponiert hat, geht er zu Bruegels
Bild über. Er zeigt die Entwicklung, die Bruegels Sprichwortdarstellung genommen
hat, und beweist, daß es ihm erst im Berliner Bild gelungen ist, ähnlich wie Rabelais
die Sprichwortlehre völlig einzuschmelzen in ein Bild des Lebens und restlos alle
Deutung aufzulösen in reine Anschauung. »Hat Bruegel sich,« schreibt Fraenger,
»dieser inneren Voraussetzung der Sprichwortschöpfung tatsächlich bemächtigt, so
ist das große Bild des Bauernbruegel nicht mehr als eine äußerliche Illustration,
sondern als freispielender Sprichwortmythos zu betrachten.« Der Vergleich zwischen
Rabelais und Bruegel, der die folgenden zwanzig Seiten füllt, gehört zu den besten
Abschnitten der neueren Kunstliteratur. Es folgt ein Abdruck der alten deutschen
Sprichwörter aus Karl Friedrich Wilhelm Wanders deutschem Sprichwörter-Lexikon,
der das Buch unnötig beschwert, das Leben Pieter Bruegels von Karl van Mander
sowie eine mit philologischer Sorgfalt durchgeführte Erläuterung der Sprichwort-
darstellungen Bruegels.
Berlin. ___________ Otto Grautoff.
Hans Hr. Busse, Das literarische Verständnis der werktätigen Jugend
zwischen 14 und 18. Mit Geleitworten von C. Mosterts und Chr. Kium-
ker. 32. Beiheft zur Zeitschrift für angewandte Psychologie. Verlag von
Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1923. X und 289 S.
Mit sehr freundlichen und ehrenden Worten haben C. Mosterts — Erster Vor-
sitzender des Ausschusses der deutschen Jugendverbände zu Berlin — und Chr. Klum-
ker — Professor für Fürsorgewesen an der Frankfurter Universität — diese fleißige,
gediegene Arbeit eingeleitet. Es ist eine Dissertation aus der Schule von Jonas Colin
und Joseph Geyser, und zwar eine in ihrer Art durch sachliche Zuverlässigkeit und
Gründlichkeit mustergültige Dissertation. Geprüft wurde die freiwillige Beteiligung
von Jugendlichen am Vereinsleben, und zwar ari dessen Literaturpflege, nämlich an
der »Literarischen« und der »Dramatischen Abteilung«, am Theaterbesuch sowie an
der Benutzung der Bibliothek. Das Hauptmaterial lieferte der katholische »Jünglings-
verein« einer industriearmen süddeutschen Mittelstadt. Der Verfasser — zugleich
der Versammlungsleiter — bediente sich fast ausschließlich der freien Beobachtung,
um jede Befangenheit auszuschließen. Darum blieb auch die theoretische Absicht
werden. Das Sprichwort, das Fraenger zur Deutung der Kunst Bruegels herangezogen
hat, ist nicht eine Gattung der reinen Literatur, sondern mehr Ausdruck der Volks-
stimmung einer Zeit. Insofern gewinnt Fraengers Buch einen mehr soziologischen
Charakter. Leider fehlt ihm wie so vielen deutschen Büchern ein zusammenfassender
Abschluß, die Konklusion, die allen französischen Büchern ein so festes und be-
stimmtes Rückgrat gibt. Auch eine Einleitung fehlt, die in klaren Worten die These
fixiert. Ohne diese Umrahmung schwimmen die Kapitel ein wenig haltlos im Rahmen
des Buches. Abgesehen von diesen äußeren Schönheitsfehlern, die sich allerdings
störend bemerkbar machen, verrät Fraengers Darstellung eine strenge, kunst- und
literarhistorische Schulung und ist vor allem in einem einprägsamen Stil geschrieben,
der sich nicht spreizt, aber für jeden Gedanken eine persönliche Form findet. Zur
Deutung der großen Berliner Sprichworttafel hat Fraenger im fünften Buch des Pan-
tagruel eine literarische Parallele gefunden, in der Rabelais rund dreißig Sprichwörter
des alten Frankreich zu einem großen Genrebild dramatisiert und in den Rahmen
einer weiten Landschaft eingeschlossen hat. Fraenger analysiert dieses literarische
Bild und kommt zu dem Ergebnis, daß es auf einer starren Koordination der inhaltlich
ganz unzusammenhängenden Motive beruht. Das additive Formprinzip von Rabelais
wird ausführlich erläutert. Nachdem er anschaulich gemacht hat, wie Rabelais aus
sprichwörtlich figürlichen Motiven ein Schauspiel komponiert hat, geht er zu Bruegels
Bild über. Er zeigt die Entwicklung, die Bruegels Sprichwortdarstellung genommen
hat, und beweist, daß es ihm erst im Berliner Bild gelungen ist, ähnlich wie Rabelais
die Sprichwortlehre völlig einzuschmelzen in ein Bild des Lebens und restlos alle
Deutung aufzulösen in reine Anschauung. »Hat Bruegel sich,« schreibt Fraenger,
»dieser inneren Voraussetzung der Sprichwortschöpfung tatsächlich bemächtigt, so
ist das große Bild des Bauernbruegel nicht mehr als eine äußerliche Illustration,
sondern als freispielender Sprichwortmythos zu betrachten.« Der Vergleich zwischen
Rabelais und Bruegel, der die folgenden zwanzig Seiten füllt, gehört zu den besten
Abschnitten der neueren Kunstliteratur. Es folgt ein Abdruck der alten deutschen
Sprichwörter aus Karl Friedrich Wilhelm Wanders deutschem Sprichwörter-Lexikon,
der das Buch unnötig beschwert, das Leben Pieter Bruegels von Karl van Mander
sowie eine mit philologischer Sorgfalt durchgeführte Erläuterung der Sprichwort-
darstellungen Bruegels.
Berlin. ___________ Otto Grautoff.
Hans Hr. Busse, Das literarische Verständnis der werktätigen Jugend
zwischen 14 und 18. Mit Geleitworten von C. Mosterts und Chr. Kium-
ker. 32. Beiheft zur Zeitschrift für angewandte Psychologie. Verlag von
Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1923. X und 289 S.
Mit sehr freundlichen und ehrenden Worten haben C. Mosterts — Erster Vor-
sitzender des Ausschusses der deutschen Jugendverbände zu Berlin — und Chr. Klum-
ker — Professor für Fürsorgewesen an der Frankfurter Universität — diese fleißige,
gediegene Arbeit eingeleitet. Es ist eine Dissertation aus der Schule von Jonas Colin
und Joseph Geyser, und zwar eine in ihrer Art durch sachliche Zuverlässigkeit und
Gründlichkeit mustergültige Dissertation. Geprüft wurde die freiwillige Beteiligung
von Jugendlichen am Vereinsleben, und zwar ari dessen Literaturpflege, nämlich an
der »Literarischen« und der »Dramatischen Abteilung«, am Theaterbesuch sowie an
der Benutzung der Bibliothek. Das Hauptmaterial lieferte der katholische »Jünglings-
verein« einer industriearmen süddeutschen Mittelstadt. Der Verfasser — zugleich
der Versammlungsleiter — bediente sich fast ausschließlich der freien Beobachtung,
um jede Befangenheit auszuschließen. Darum blieb auch die theoretische Absicht