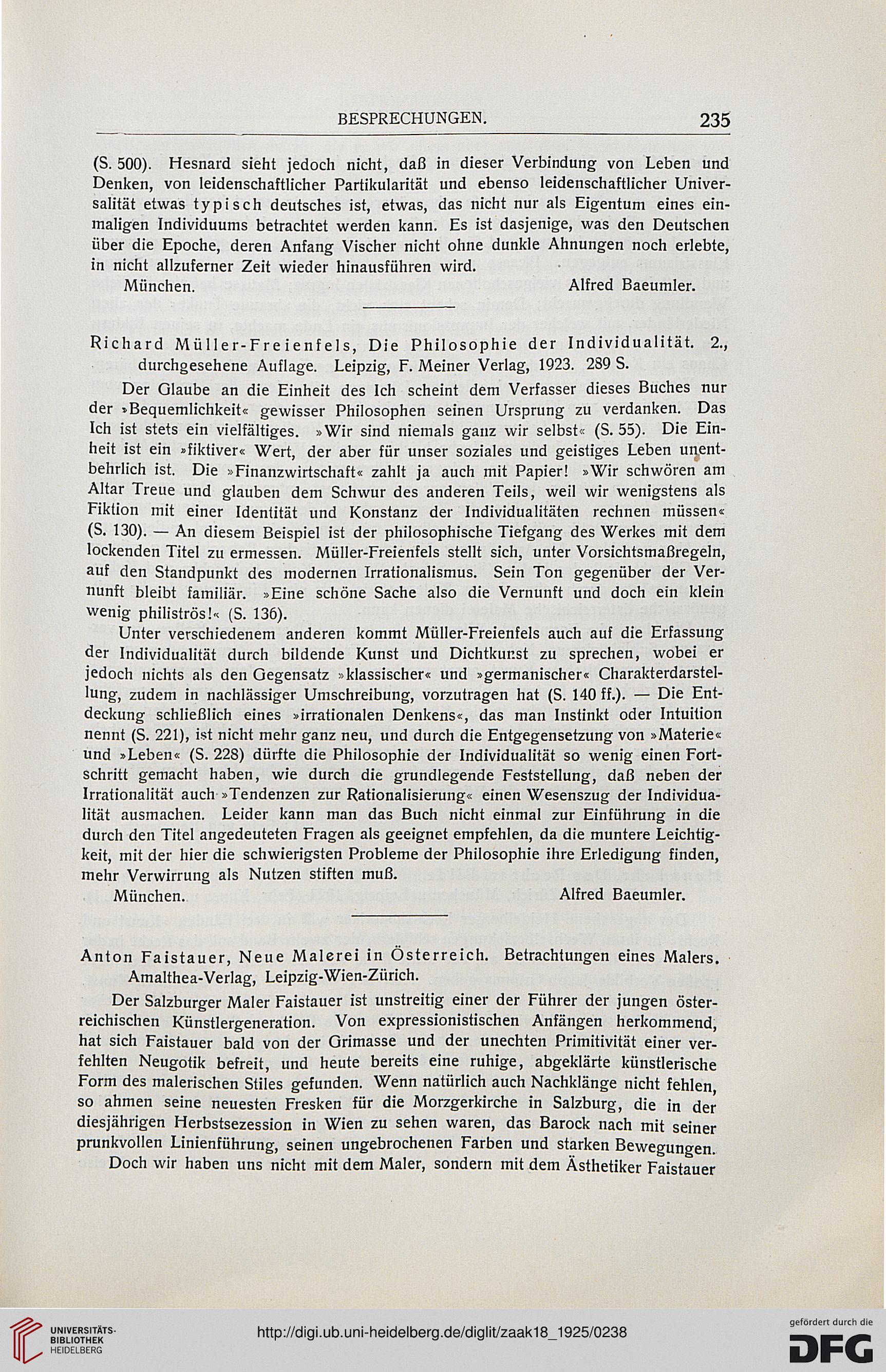BESPRECHUNGEN. 235
(S. 500). Hesnard sieht jedoch nicht, daß in dieser Verbindung von Leben und
Denken, von leidenschaftlicher Partikularität und ebenso leidenschaftlicher Univer-
salität etwas typisch deutsches ist, etwas, das nicht nur als Eigentum eines ein-
maligen Individuums betrachtet werden kann. Es ist dasjenige, was den Deutschen
über die Epoche, deren Anfang Vischer nicht ohne dunkle Ahnungen noch erlebte,
in nicht allzuferner Zeit wieder hinausführen wird.
München. Alfred Baeumler.
Richard Müller-Freienfels, Die Philosophie der Individualität. 2.,
durchgesehene Auflage. Leipzig, F. Meiner Verlag, 1923. 289 S.
Der Glaube an die Einheit des Ich scheint dem Verfasser dieses Buches nur
der »Bequemlichkeit« gewisser Philosophen seinen Ursprung zu verdanken. Das
Ich ist stets ein vielfältiges. »Wir sind niemals ganz wir selbst« (S. 55). Die Ein-
heit ist ein »fiktiver« Wert, der aber für unser soziales und geistiges Leben unent-
behrlich ist. Die »Finanzwirtschaft« zahlt ja auch mit Papier! »Wir schwören am
Altar Treue und glauben dem Schwur des anderen Teils, weil wir wenigstens als
Fiktion mit einer Identität und Konstanz der Individualitäten rechnen müssen«
(S. 130). — An diesem Beispiel ist der philosophische Tiefgang des Werkes mit dem
lockenden Titel zu ermessen. Müller-Freienfels stellt sich, unter Vorsichtsmaßregeln,
auf den Standpunkt des modernen Irrationalismus. Sein Ton gegenüber der Ver-
nunft bleibt familiär. »Eine schöne Sache also die Vernunft und doch ein klein
wenig philiströs!« (S. 136).
Unter verschiedenem anderen kommt Müller-Freienfels auch auf die Erfassung
der Individualität durch bildende Kunst und Dichtkunst zu sprechen, wobei er
jedoch nichts als den Gegensatz »klassischer« und »germanischer« Charakterdarstel-
lung, zudem in nachlässiger Umschreibung, vorzutragen hat (S. 140 ff.). — Die Ent-
deckung schließlich eines »irrationalen Denkens«, das man Instinkt oder Intuition
nennt (S. 221), ist nicht mehr ganz neu, und durch die Entgegensetzung von »Materie«
und »Leben« (S. 228) dürfte die Philosophie der Individualität so wenig einen Fort-
schritt gemacht haben, wie durch die grundlegende Feststellung, daß neben der
Irrationalität auch »Tendenzen zur Rationalisierung« einen Wesenszug der Individua-
lität ausmachen. Leider kann man das Buch nicht einmal zur Einführung in die
durch den Titel angedeuteten Fragen als geeignet empfehlen, da die muntere Leichtig-
keit, mit der hier die schwierigsten Probleme der Philosophie ihre Erledigung finden,
mehr Verwirrung als Nutzen stiften muß.
München. Alfred Baeumler.
Anton Faistauer, Neue Malerei in Österreich. Betrachtungen eines Malers.
Amalthea-Verlag, Leipzig-Wien-Zürich.
Der Salzburger Maler Faistauer ist unstreitig einer der Führer der jungen öster-
reichischen Künstlergeneration. Von expressionistischen Anfängen herkommend,
hat sich Faistauer bald von der Grimasse und der unechten Primitivität einer ver-
fehlten Neugotik befreit, und heute bereits eine ruhige, abgeklärte künstlerische
Form des malerischen Stiles gefunden. Wenn natürlich auch Nachklänge nicht fehlen
so ahmen seine neuesten Fresken für die Morzgerkirche in Salzburg, die in der
diesjährigen Herbstsezession in Wien zu sehen waren, das Barock nach mit seiner
prunkvollen Linienführung, seinen ungebrochenen Farben und starken Bewegungen.
Doch wir haben uns nicht mit dem Maler, sondern mit dem Ästhetiker Faistauer
(S. 500). Hesnard sieht jedoch nicht, daß in dieser Verbindung von Leben und
Denken, von leidenschaftlicher Partikularität und ebenso leidenschaftlicher Univer-
salität etwas typisch deutsches ist, etwas, das nicht nur als Eigentum eines ein-
maligen Individuums betrachtet werden kann. Es ist dasjenige, was den Deutschen
über die Epoche, deren Anfang Vischer nicht ohne dunkle Ahnungen noch erlebte,
in nicht allzuferner Zeit wieder hinausführen wird.
München. Alfred Baeumler.
Richard Müller-Freienfels, Die Philosophie der Individualität. 2.,
durchgesehene Auflage. Leipzig, F. Meiner Verlag, 1923. 289 S.
Der Glaube an die Einheit des Ich scheint dem Verfasser dieses Buches nur
der »Bequemlichkeit« gewisser Philosophen seinen Ursprung zu verdanken. Das
Ich ist stets ein vielfältiges. »Wir sind niemals ganz wir selbst« (S. 55). Die Ein-
heit ist ein »fiktiver« Wert, der aber für unser soziales und geistiges Leben unent-
behrlich ist. Die »Finanzwirtschaft« zahlt ja auch mit Papier! »Wir schwören am
Altar Treue und glauben dem Schwur des anderen Teils, weil wir wenigstens als
Fiktion mit einer Identität und Konstanz der Individualitäten rechnen müssen«
(S. 130). — An diesem Beispiel ist der philosophische Tiefgang des Werkes mit dem
lockenden Titel zu ermessen. Müller-Freienfels stellt sich, unter Vorsichtsmaßregeln,
auf den Standpunkt des modernen Irrationalismus. Sein Ton gegenüber der Ver-
nunft bleibt familiär. »Eine schöne Sache also die Vernunft und doch ein klein
wenig philiströs!« (S. 136).
Unter verschiedenem anderen kommt Müller-Freienfels auch auf die Erfassung
der Individualität durch bildende Kunst und Dichtkunst zu sprechen, wobei er
jedoch nichts als den Gegensatz »klassischer« und »germanischer« Charakterdarstel-
lung, zudem in nachlässiger Umschreibung, vorzutragen hat (S. 140 ff.). — Die Ent-
deckung schließlich eines »irrationalen Denkens«, das man Instinkt oder Intuition
nennt (S. 221), ist nicht mehr ganz neu, und durch die Entgegensetzung von »Materie«
und »Leben« (S. 228) dürfte die Philosophie der Individualität so wenig einen Fort-
schritt gemacht haben, wie durch die grundlegende Feststellung, daß neben der
Irrationalität auch »Tendenzen zur Rationalisierung« einen Wesenszug der Individua-
lität ausmachen. Leider kann man das Buch nicht einmal zur Einführung in die
durch den Titel angedeuteten Fragen als geeignet empfehlen, da die muntere Leichtig-
keit, mit der hier die schwierigsten Probleme der Philosophie ihre Erledigung finden,
mehr Verwirrung als Nutzen stiften muß.
München. Alfred Baeumler.
Anton Faistauer, Neue Malerei in Österreich. Betrachtungen eines Malers.
Amalthea-Verlag, Leipzig-Wien-Zürich.
Der Salzburger Maler Faistauer ist unstreitig einer der Führer der jungen öster-
reichischen Künstlergeneration. Von expressionistischen Anfängen herkommend,
hat sich Faistauer bald von der Grimasse und der unechten Primitivität einer ver-
fehlten Neugotik befreit, und heute bereits eine ruhige, abgeklärte künstlerische
Form des malerischen Stiles gefunden. Wenn natürlich auch Nachklänge nicht fehlen
so ahmen seine neuesten Fresken für die Morzgerkirche in Salzburg, die in der
diesjährigen Herbstsezession in Wien zu sehen waren, das Barock nach mit seiner
prunkvollen Linienführung, seinen ungebrochenen Farben und starken Bewegungen.
Doch wir haben uns nicht mit dem Maler, sondern mit dem Ästhetiker Faistauer