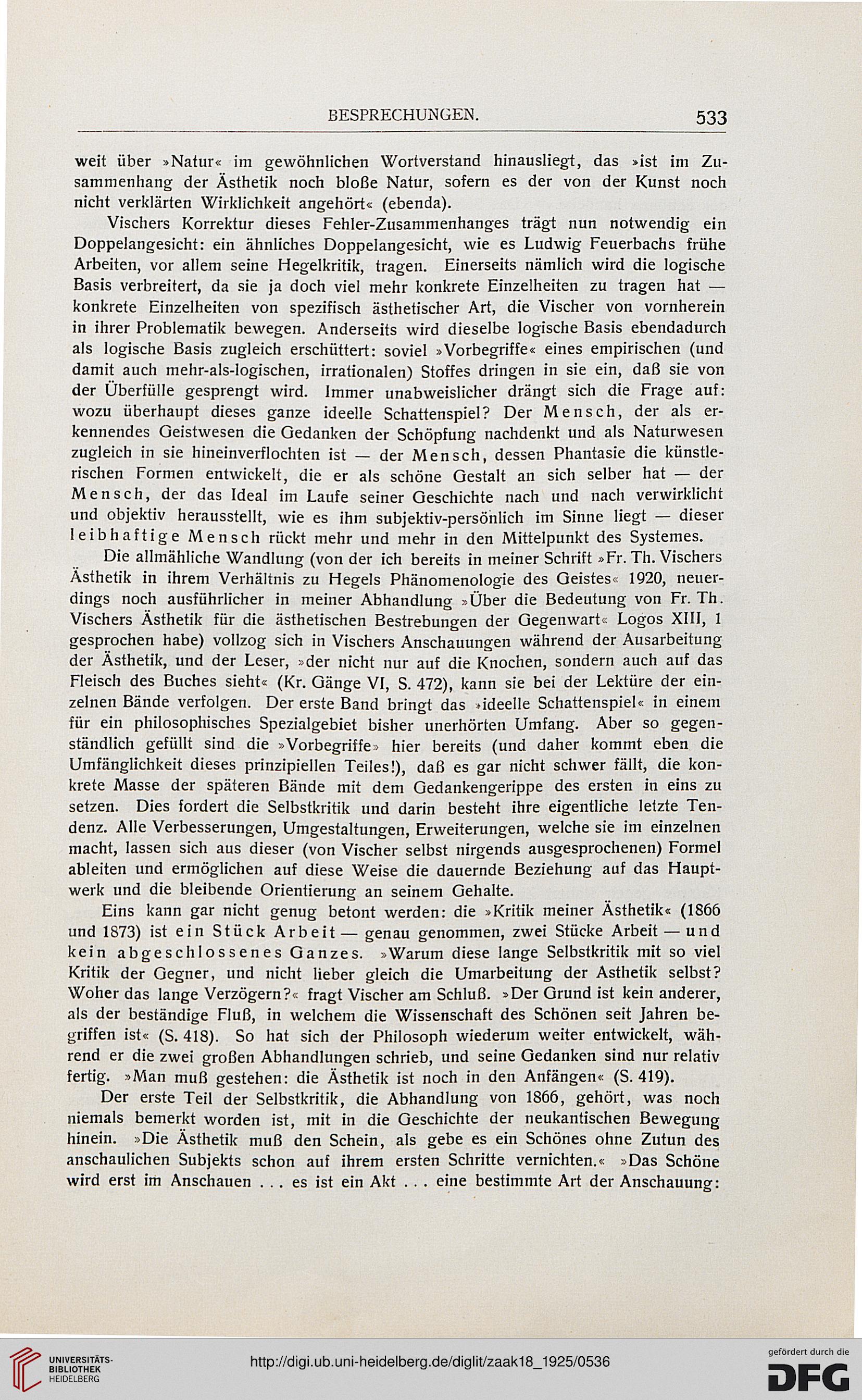BESPRECHUNGEN. 533
weit über »Natur« im gewöhnlichen Wortverstand hinausliegt, das >ist im Zu-
sammenhang der Ästhetik noch bloße Natur, sofern es der von der Kunst noch
nicht verklärten Wirklichkeit angehört« (ebenda).
Vischers Korrektur dieses Fehler-Zusammenhanges trägt nun notwendig ein
Doppelangesicht: ein ähnliches Doppelangesicht, wie es Ludwig Feuerbachs frühe
Arbeiten, vor allem seine Hegelkritik, tragen. Einerseits nämlich wird die logische
Basis verbreitert, da sie ja doch viel mehr konkrete Einzelheiten zu tragen hat —
konkrete Einzelheiten von spezifisch ästhetischer Art, die Vischer von vornherein
in ihrer Problematik bewegen. Anderseits wird dieselbe logische Basis ebendadurch
als logische Basis zugleich erschüttert: soviel »Vorbegriffe« eines empirischen (und
damit auch mehr-als-logischen, irrationalen) Stoffes dringen in sie ein, daß sie von
der Überfülle gesprengt wird. Immer unabweislicher drängt sich die Frage auf:
wozu überhaupt dieses ganze ideelle Schattenspiel? Der Mensch, der als er-
kennendes Oeistwesen die Gedanken der Schöpfung nachdenkt und als Naturwesen
zugleich in sie hineinverflochten ist — der Mensch, dessen Phantasie die künstle-
rischen Formen entwickelt, die er als schöne Gestalt an sich selber hat — der
Mensch, der das Ideal im Laufe seiner Geschichte nach und nach verwirklicht
und objektiv herausstellt, wie es ihm subjektiv-persönlich im Sinne liegt — dieser
leibhaftige Mensch rückt mehr und mehr in den Mittelpunkt des Systemes.
Die allmähliche Wandlung (von der ich bereits in meiner Schrift »Fr. Th. Vischers
Ästhetik in ihrem Verhältnis zu Hegels Phänomenologie des Geistes« 1920, neuer-
dings noch ausführlicher in meiner Abhandlung »Über die Bedeutung von Fr. Th.
Vischers Ästhetik für die ästhetischen Bestrebungen der Gegenwart« Logos XIII, 1
gesprochen habe) vollzog sich in Vischers Anschauungen während der Ausarbeitung
der Ästhetik, und der Leser, »der nicht nur auf die Knochen, sondern auch auf das
Fleisch des Buches sieht« (Kr. Gänge VI, S. 472), kann sie bei der Lektüre der ein-
zelnen Bände verfolgen. Der erste Band bringt das .ideelle Schattenspiel« in einem
für ein philosophisches Spezialgebiet bisher unerhörten Umfang. Aber so gegen-
ständlich gefüllt sind die »Vorbegriffe > hier bereits (und daher kommt eben die
Umfänglichkeit dieses prinzipiellen Teiles!), daß es gar nicht schwer fällt, die kon-
krete Masse der späteren Bände mit dem Gedankengerippe des ersten in eins zu
setzen. Dies fordert die Selbstkritik und darin besteht ihre eigentliche letzte Ten-
denz. Alle Verbesserungen, Umgestaltungen, Erweiterungen, welche sie im einzelnen
macht, lassen sich aus dieser (von Vischer selbst nirgends ausgesprochenen) Formel
ableiten und ermöglichen auf diese Weise die dauernde Beziehung auf das Haupt-
werk und die bleibende Orientierung an seinem Gehalte.
Eins kann gar nicht genug betont werden: die »Kritik meiner Ästhetik« (1866
und 1873) ist ein Stück Arbeit— genau genommen, zwei Stücke Arbeit —und
kein abgeschlossenes Ganzes. »Warum diese lange Selbstkritik mit so viel
Kritik der Gegner, und nicht lieber gleich die Umarbeitung der Ästhetik selbst?
Woher das lange Verzögern?« fragt Vischer am Schluß. »Der Grund ist kein anderer,
als der beständige Fluß, in welchem die Wissenschaft des Schönen seit Jahren be-
griffen ist« (S. 418). So hat sich der Philosoph wiederum weiter entwickelt, wäh-
rend er die zwei großen Abhandlungen schrieb, und seine Gedanken sind nur relativ
fertig. »Man muß gestehen: die Ästhetik ist noch in den Anfängen« (S. 419).
Der erste Teil der Selbstkritik, die Abhandlung von 1866, gehört, was noch
niemals bemerkt worden ist, mit in die Geschichte der neukantischen Bewegung
hinein. »Die Ästhetik muß den Schein, als gebe es ein Schönes ohne Zutun des
anschaulichen Subjekts schon auf ihrem ersten Schritte vernichten.« »Das Schöne
wird erst im Anschauen ... es ist ein Akt . . . eine bestimmte Art der Anschauung:
weit über »Natur« im gewöhnlichen Wortverstand hinausliegt, das >ist im Zu-
sammenhang der Ästhetik noch bloße Natur, sofern es der von der Kunst noch
nicht verklärten Wirklichkeit angehört« (ebenda).
Vischers Korrektur dieses Fehler-Zusammenhanges trägt nun notwendig ein
Doppelangesicht: ein ähnliches Doppelangesicht, wie es Ludwig Feuerbachs frühe
Arbeiten, vor allem seine Hegelkritik, tragen. Einerseits nämlich wird die logische
Basis verbreitert, da sie ja doch viel mehr konkrete Einzelheiten zu tragen hat —
konkrete Einzelheiten von spezifisch ästhetischer Art, die Vischer von vornherein
in ihrer Problematik bewegen. Anderseits wird dieselbe logische Basis ebendadurch
als logische Basis zugleich erschüttert: soviel »Vorbegriffe« eines empirischen (und
damit auch mehr-als-logischen, irrationalen) Stoffes dringen in sie ein, daß sie von
der Überfülle gesprengt wird. Immer unabweislicher drängt sich die Frage auf:
wozu überhaupt dieses ganze ideelle Schattenspiel? Der Mensch, der als er-
kennendes Oeistwesen die Gedanken der Schöpfung nachdenkt und als Naturwesen
zugleich in sie hineinverflochten ist — der Mensch, dessen Phantasie die künstle-
rischen Formen entwickelt, die er als schöne Gestalt an sich selber hat — der
Mensch, der das Ideal im Laufe seiner Geschichte nach und nach verwirklicht
und objektiv herausstellt, wie es ihm subjektiv-persönlich im Sinne liegt — dieser
leibhaftige Mensch rückt mehr und mehr in den Mittelpunkt des Systemes.
Die allmähliche Wandlung (von der ich bereits in meiner Schrift »Fr. Th. Vischers
Ästhetik in ihrem Verhältnis zu Hegels Phänomenologie des Geistes« 1920, neuer-
dings noch ausführlicher in meiner Abhandlung »Über die Bedeutung von Fr. Th.
Vischers Ästhetik für die ästhetischen Bestrebungen der Gegenwart« Logos XIII, 1
gesprochen habe) vollzog sich in Vischers Anschauungen während der Ausarbeitung
der Ästhetik, und der Leser, »der nicht nur auf die Knochen, sondern auch auf das
Fleisch des Buches sieht« (Kr. Gänge VI, S. 472), kann sie bei der Lektüre der ein-
zelnen Bände verfolgen. Der erste Band bringt das .ideelle Schattenspiel« in einem
für ein philosophisches Spezialgebiet bisher unerhörten Umfang. Aber so gegen-
ständlich gefüllt sind die »Vorbegriffe > hier bereits (und daher kommt eben die
Umfänglichkeit dieses prinzipiellen Teiles!), daß es gar nicht schwer fällt, die kon-
krete Masse der späteren Bände mit dem Gedankengerippe des ersten in eins zu
setzen. Dies fordert die Selbstkritik und darin besteht ihre eigentliche letzte Ten-
denz. Alle Verbesserungen, Umgestaltungen, Erweiterungen, welche sie im einzelnen
macht, lassen sich aus dieser (von Vischer selbst nirgends ausgesprochenen) Formel
ableiten und ermöglichen auf diese Weise die dauernde Beziehung auf das Haupt-
werk und die bleibende Orientierung an seinem Gehalte.
Eins kann gar nicht genug betont werden: die »Kritik meiner Ästhetik« (1866
und 1873) ist ein Stück Arbeit— genau genommen, zwei Stücke Arbeit —und
kein abgeschlossenes Ganzes. »Warum diese lange Selbstkritik mit so viel
Kritik der Gegner, und nicht lieber gleich die Umarbeitung der Ästhetik selbst?
Woher das lange Verzögern?« fragt Vischer am Schluß. »Der Grund ist kein anderer,
als der beständige Fluß, in welchem die Wissenschaft des Schönen seit Jahren be-
griffen ist« (S. 418). So hat sich der Philosoph wiederum weiter entwickelt, wäh-
rend er die zwei großen Abhandlungen schrieb, und seine Gedanken sind nur relativ
fertig. »Man muß gestehen: die Ästhetik ist noch in den Anfängen« (S. 419).
Der erste Teil der Selbstkritik, die Abhandlung von 1866, gehört, was noch
niemals bemerkt worden ist, mit in die Geschichte der neukantischen Bewegung
hinein. »Die Ästhetik muß den Schein, als gebe es ein Schönes ohne Zutun des
anschaulichen Subjekts schon auf ihrem ersten Schritte vernichten.« »Das Schöne
wird erst im Anschauen ... es ist ein Akt . . . eine bestimmte Art der Anschauung: