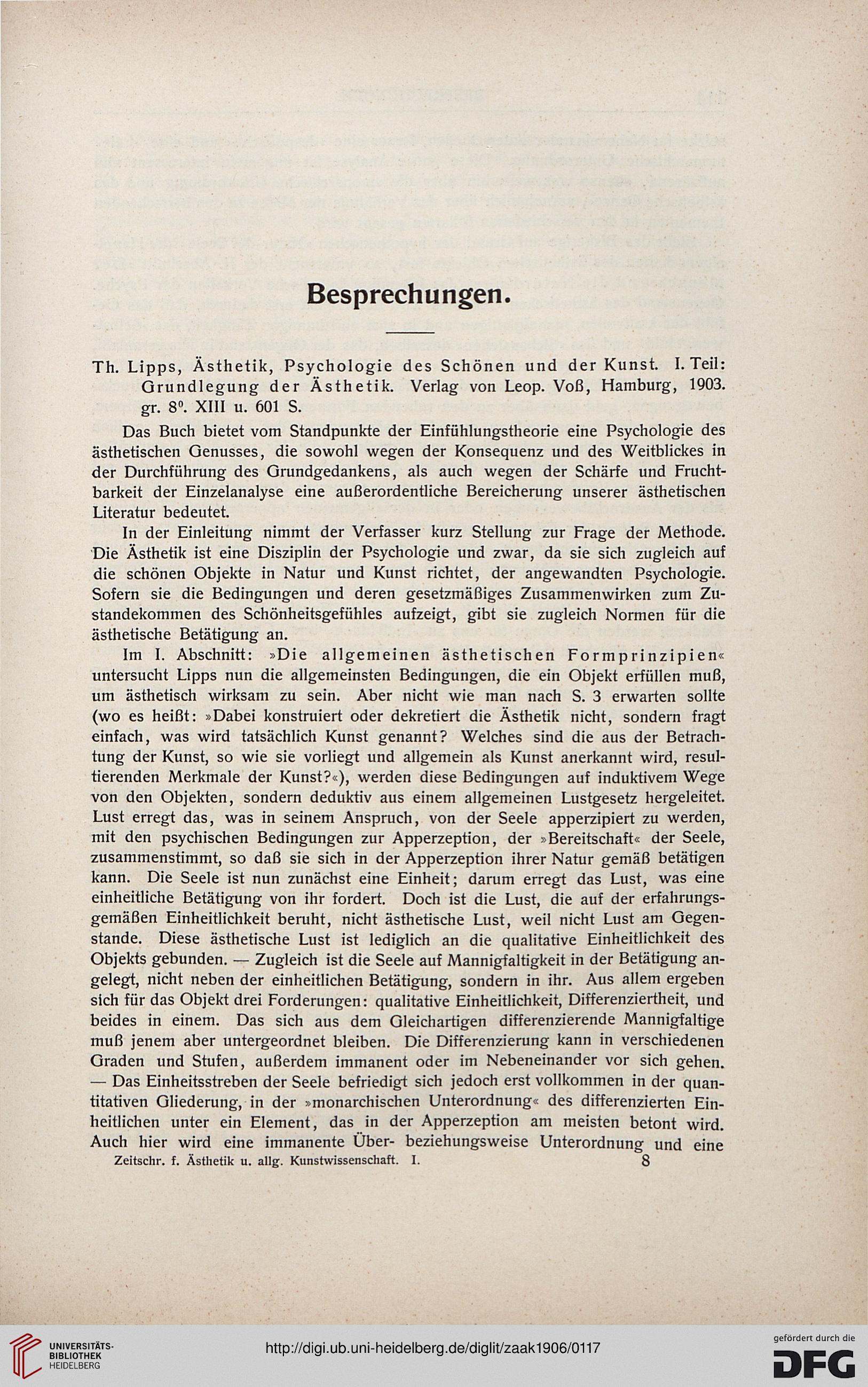Besprechungen.
Th. Lipps, Ästhetik, Psychologie des Schönen und der Kunst. I.Teil:
Grundlegung der Ästhetik. Verlag von Leop. Voß, Hamburg, 1903.
gr. 8°. XIII u. 601 S.
Das Buch bietet vom Standpunkte der Einfühlungstheorie eine Psychologie des
ästhetischen Genusses, die sowohl wegen der Konsequenz und des Weitblickes in
der Durchführung des Grundgedankens, als auch wegen der Schärfe und Frucht-
barkeit der Einzelanalyse eine außerordentliche Bereicherung unserer ästhetischen
Literatur bedeutet.
In der Einleitung nimmt der Verfasser kurz Stellung zur Frage der Methode.
Die Ästhetik ist eine Disziplin der Psychologie und zwar, da sie sich zugleich auf
die schönen Objekte in Natur und Kunst richtet, der angewandten Psychologie.
Sofern sie die Bedingungen und deren gesetzmäßiges Zusammenwirken zum Zu-
standekommen des Schönheitsgefühles aufzeigt, gibt sie zugleich Normen für die
ästhetische Betätigung an.
Im I. Abschnitt: »Die allgemeinen ästhetischen Formprinzipien«
untersucht Lipps nun die allgemeinsten Bedingungen, die ein Objekt erfüllen muß,
um ästhetisch wirksam zu sein. Aber nicht wie man nach S. 3 erwarten sollte
(wo es heißt: »Dabei konstruiert oder dekretiert die Ästhetik nicht, sondern fragt
einfach, was wird tatsächlich Kunst genannt? Welches sind die aus der Betrach-
tung der Kunst, so wie sie vorliegt und allgemein als Kunst anerkannt wird, resul-
tierenden Merkmale der Kunst?«), werden diese Bedingungen auf induktivem Wege
von den Objekten, sondern deduktiv aus einem allgemeinen Lustgesetz hergeleitet.
Lust erregt das, was in seinem Anspruch, von der Seele apperzipiert zu werden,
mit den psychischen Bedingungen zur Apperzeption, der »Bereitschaft« der Seele,
zusammenstimmt, so daß sie sich in der Apperzeption ihrer Natur gemäß betätigen
kann. Die Seele ist nun zunächst eine Einheit; darum erregt das Lust, was eine
einheitliche Betätigung von ihr fordert. Doch ist die Lust, die auf der erfahrungs-
gemäßen Einheitlichkeit beruht, nicht ästhetische Lust, weil nicht Lust am Gegen-
stande. Diese ästhetische Lust ist lediglich an die qualitative Einheitlichkeit des
Objekts gebunden. — Zugleich ist die Seele auf Mannigfaltigkeit in der Betätigung an-
gelegt, nicht neben der einheitlichen Betätigung, sondern in ihr. Aus allem ergeben
sich für das Objekt drei Forderungen: qualitative Einheitlichkeit, Differenziertheit, und
beides in einem. Das sich aus dem Gleichartigen differenzierende Mannigfaltige
muß jenem aber untergeordnet bleiben. Die Differenzierung kann in verschiedenen
Graden und Stufen, außerdem immanent oder im Nebeneinander vor sich gehen.
— Das Einheitsstreben der Seele befriedigt sich jedoch erst vollkommen in der quan-
titativen Gliederung, in der »monarchischen Unterordnung« des differenzierten Ein-
heitlichen unter ein Element, das in der Apperzeption am meisten betont wird.
Auch hier wird eine immanente Über- beziehungsweise Unterordnung und eine
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. I. 8
Th. Lipps, Ästhetik, Psychologie des Schönen und der Kunst. I.Teil:
Grundlegung der Ästhetik. Verlag von Leop. Voß, Hamburg, 1903.
gr. 8°. XIII u. 601 S.
Das Buch bietet vom Standpunkte der Einfühlungstheorie eine Psychologie des
ästhetischen Genusses, die sowohl wegen der Konsequenz und des Weitblickes in
der Durchführung des Grundgedankens, als auch wegen der Schärfe und Frucht-
barkeit der Einzelanalyse eine außerordentliche Bereicherung unserer ästhetischen
Literatur bedeutet.
In der Einleitung nimmt der Verfasser kurz Stellung zur Frage der Methode.
Die Ästhetik ist eine Disziplin der Psychologie und zwar, da sie sich zugleich auf
die schönen Objekte in Natur und Kunst richtet, der angewandten Psychologie.
Sofern sie die Bedingungen und deren gesetzmäßiges Zusammenwirken zum Zu-
standekommen des Schönheitsgefühles aufzeigt, gibt sie zugleich Normen für die
ästhetische Betätigung an.
Im I. Abschnitt: »Die allgemeinen ästhetischen Formprinzipien«
untersucht Lipps nun die allgemeinsten Bedingungen, die ein Objekt erfüllen muß,
um ästhetisch wirksam zu sein. Aber nicht wie man nach S. 3 erwarten sollte
(wo es heißt: »Dabei konstruiert oder dekretiert die Ästhetik nicht, sondern fragt
einfach, was wird tatsächlich Kunst genannt? Welches sind die aus der Betrach-
tung der Kunst, so wie sie vorliegt und allgemein als Kunst anerkannt wird, resul-
tierenden Merkmale der Kunst?«), werden diese Bedingungen auf induktivem Wege
von den Objekten, sondern deduktiv aus einem allgemeinen Lustgesetz hergeleitet.
Lust erregt das, was in seinem Anspruch, von der Seele apperzipiert zu werden,
mit den psychischen Bedingungen zur Apperzeption, der »Bereitschaft« der Seele,
zusammenstimmt, so daß sie sich in der Apperzeption ihrer Natur gemäß betätigen
kann. Die Seele ist nun zunächst eine Einheit; darum erregt das Lust, was eine
einheitliche Betätigung von ihr fordert. Doch ist die Lust, die auf der erfahrungs-
gemäßen Einheitlichkeit beruht, nicht ästhetische Lust, weil nicht Lust am Gegen-
stande. Diese ästhetische Lust ist lediglich an die qualitative Einheitlichkeit des
Objekts gebunden. — Zugleich ist die Seele auf Mannigfaltigkeit in der Betätigung an-
gelegt, nicht neben der einheitlichen Betätigung, sondern in ihr. Aus allem ergeben
sich für das Objekt drei Forderungen: qualitative Einheitlichkeit, Differenziertheit, und
beides in einem. Das sich aus dem Gleichartigen differenzierende Mannigfaltige
muß jenem aber untergeordnet bleiben. Die Differenzierung kann in verschiedenen
Graden und Stufen, außerdem immanent oder im Nebeneinander vor sich gehen.
— Das Einheitsstreben der Seele befriedigt sich jedoch erst vollkommen in der quan-
titativen Gliederung, in der »monarchischen Unterordnung« des differenzierten Ein-
heitlichen unter ein Element, das in der Apperzeption am meisten betont wird.
Auch hier wird eine immanente Über- beziehungsweise Unterordnung und eine
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. I. 8