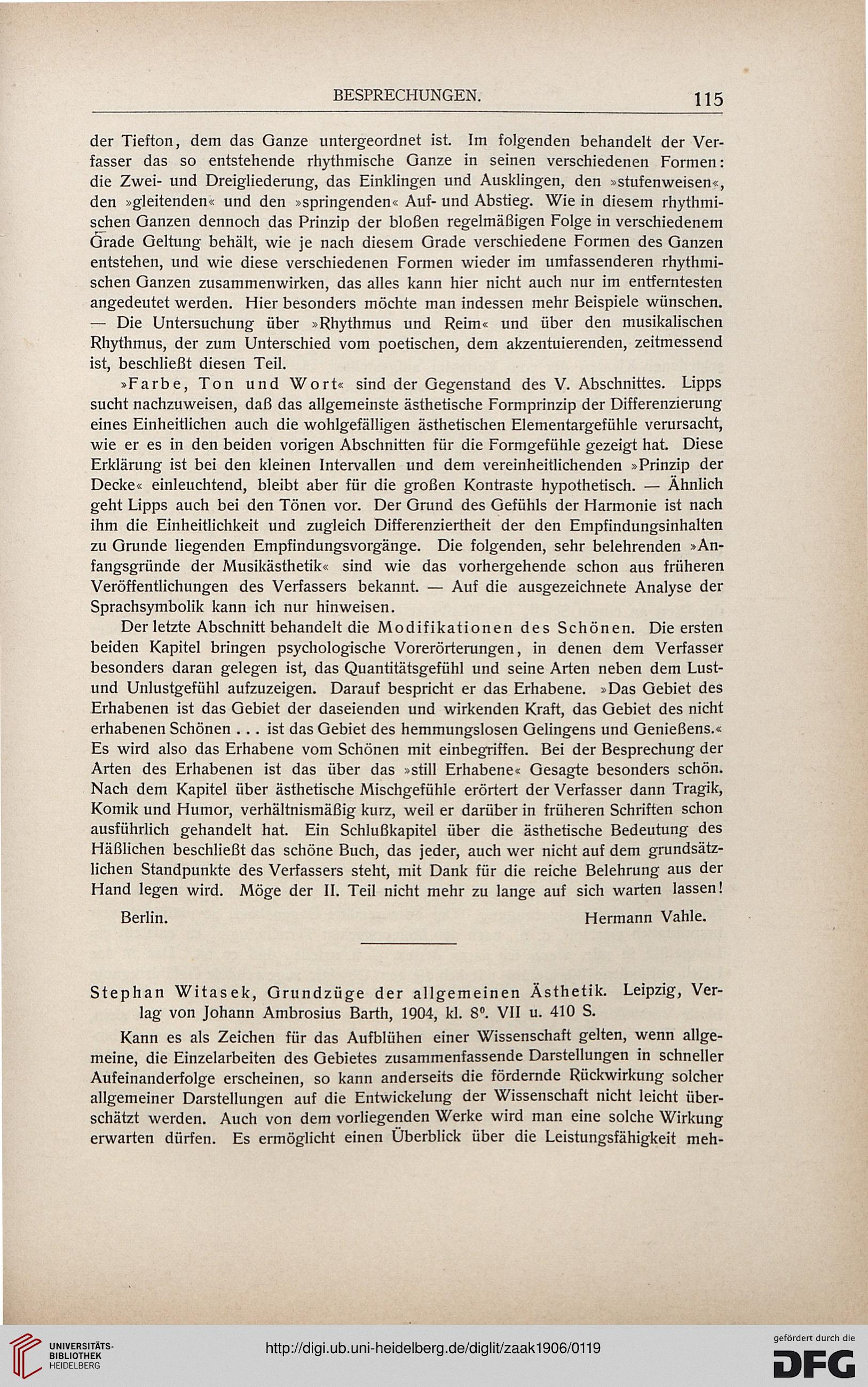BESPRECHUNGEN. 115
der Tiefton, dem das Ganze untergeordnet ist. Im folgenden behandelt der Ver-
fasser das so entstehende rhythmische Ganze in seinen verschiedenen Formen:
die Zwei- und Dreigliederung, das Einklingen und Ausklingen, den »stufenweisen«,
den »gleitenden« und den »springenden« Auf- und Abstieg. Wie in diesem rhythmi-
schen Ganzen dennoch das Prinzip der bloßen regelmäßigen Folge in verschiedenem
Grade Geltung behält, wie je nach diesem Grade verschiedene Formen des Ganzen
entstehen, und wie diese verschiedenen Formen wieder im umfassenderen rhythmi-
schen Ganzen zusammenwirken, das alles kann hier nicht auch nur im entferntesten
angedeutet werden. Hier besonders möchte man indessen mehr Beispiele wünschen.
— Die Untersuchung über »Rhythmus und Reim« und über den musikalischen
Rhythmus, der zum Unterschied vom poetischen, dem akzentuierenden, zeitmessend
ist, beschließt diesen Teil.
»Farbe, Ton und Wort« sind der Gegenstand des V. Abschnittes. Lipps
sucht nachzuweisen, daß das allgemeinste ästhetische Formprinzip der Differenzierung
eines Einheitlichen auch die wohlgefälligen ästhetischen Elementargefühle verursacht,
wie er es in den beiden vorigen Abschnitten für die Formgefühle gezeigt hat. Diese
Erklärung ist bei den kleinen Intervallen und dem vereinheitlichenden »Prinzip der
Decke« einleuchtend, bleibt aber für die großen Kontraste hypothetisch. — Ähnlich
geht Lipps auch bei den Tönen vor. Der Grund des Gefühls der Harmonie ist nach
ihm die Einheitlichkeit und zugleich Differenziertheit der den Empfindungsinhalten
zu Grunde liegenden Empfindungsvorgänge. Die folgenden, sehr belehrenden »An-
fangsgründe der Musikästhetik« sind wie das vorhergehende schon aus früheren
Veröffentlichungen des Verfassers bekannt. — Auf die ausgezeichnete Analyse der
Sprachsymbolik kann ich nur hinweisen.
Der letzte Abschnitt behandelt die Modifikationen des Schönen. Die ersten
beiden Kapitel bringen psychologische Vorerörterungen, in denen dem Verfasser
besonders daran gelegen ist, das Quantitätsgefühl und seine Arten neben dem Lust-
und Unlustgefühl aufzuzeigen. Darauf bespricht er das Erhabene. »Das Gebiet des
Erhabenen ist das Gebiet der daseienden und wirkenden Kraft, das Gebiet des nicht
erhabenen Schönen ... ist das Gebiet des hemmungslosen Gelingens und Genießens.«
Es wird also das Erhabene vom Schönen mit einbegriffen. Bei der Besprechung der
Arten des Erhabenen ist das über das »still Erhabene« Gesagte besonders schön.
Nach dem Kapitel über ästhetische Mischgefühle erörtert der Verfasser dann Tragik,
Komik und Humor, verhältnismäßig kurz, weil er darüber in früheren Schriften schon
ausführlich gehandelt hat. Ein Schlußkapitel über die ästhetische Bedeutung des
Häßlichen beschließt das schöne Buch, das jeder, auch wer nicht auf dem grundsätz-
lichen Standpunkte des Verfassers steht, mit Dank für die reiche Belehrung aus der
Hand legen wird. Möge der II. Teil nicht mehr zu lange auf sich warten lassen!
Berlin. Hermann Vahle.
Stephan Witasek, Grundzüge der allgemeinen Ästhetik. Leipzig, Ver-
lag von Johann Ambrosius Barth, 1904, kl. 8°. VII u. 410 S.
Kann es als Zeichen für das Aufblühen einer Wissenschaft gelten, wenn allge-
meine, die Einzelarbeiten des Gebietes zusammenfassende Darstellungen in schneller
Aufeinanderfolge erscheinen, so kann anderseits die fördernde Rückwirkung solcher
allgemeiner Darstellungen auf die Entwicklung der Wissenschaft nicht leicht über-
schätzt werden. Auch von dem vorliegenden Werke wird man eine solche Wirkung
erwarten dürfen. Es ermöglicht einen Überblick über die Leistungsfähigkeit meh-
der Tiefton, dem das Ganze untergeordnet ist. Im folgenden behandelt der Ver-
fasser das so entstehende rhythmische Ganze in seinen verschiedenen Formen:
die Zwei- und Dreigliederung, das Einklingen und Ausklingen, den »stufenweisen«,
den »gleitenden« und den »springenden« Auf- und Abstieg. Wie in diesem rhythmi-
schen Ganzen dennoch das Prinzip der bloßen regelmäßigen Folge in verschiedenem
Grade Geltung behält, wie je nach diesem Grade verschiedene Formen des Ganzen
entstehen, und wie diese verschiedenen Formen wieder im umfassenderen rhythmi-
schen Ganzen zusammenwirken, das alles kann hier nicht auch nur im entferntesten
angedeutet werden. Hier besonders möchte man indessen mehr Beispiele wünschen.
— Die Untersuchung über »Rhythmus und Reim« und über den musikalischen
Rhythmus, der zum Unterschied vom poetischen, dem akzentuierenden, zeitmessend
ist, beschließt diesen Teil.
»Farbe, Ton und Wort« sind der Gegenstand des V. Abschnittes. Lipps
sucht nachzuweisen, daß das allgemeinste ästhetische Formprinzip der Differenzierung
eines Einheitlichen auch die wohlgefälligen ästhetischen Elementargefühle verursacht,
wie er es in den beiden vorigen Abschnitten für die Formgefühle gezeigt hat. Diese
Erklärung ist bei den kleinen Intervallen und dem vereinheitlichenden »Prinzip der
Decke« einleuchtend, bleibt aber für die großen Kontraste hypothetisch. — Ähnlich
geht Lipps auch bei den Tönen vor. Der Grund des Gefühls der Harmonie ist nach
ihm die Einheitlichkeit und zugleich Differenziertheit der den Empfindungsinhalten
zu Grunde liegenden Empfindungsvorgänge. Die folgenden, sehr belehrenden »An-
fangsgründe der Musikästhetik« sind wie das vorhergehende schon aus früheren
Veröffentlichungen des Verfassers bekannt. — Auf die ausgezeichnete Analyse der
Sprachsymbolik kann ich nur hinweisen.
Der letzte Abschnitt behandelt die Modifikationen des Schönen. Die ersten
beiden Kapitel bringen psychologische Vorerörterungen, in denen dem Verfasser
besonders daran gelegen ist, das Quantitätsgefühl und seine Arten neben dem Lust-
und Unlustgefühl aufzuzeigen. Darauf bespricht er das Erhabene. »Das Gebiet des
Erhabenen ist das Gebiet der daseienden und wirkenden Kraft, das Gebiet des nicht
erhabenen Schönen ... ist das Gebiet des hemmungslosen Gelingens und Genießens.«
Es wird also das Erhabene vom Schönen mit einbegriffen. Bei der Besprechung der
Arten des Erhabenen ist das über das »still Erhabene« Gesagte besonders schön.
Nach dem Kapitel über ästhetische Mischgefühle erörtert der Verfasser dann Tragik,
Komik und Humor, verhältnismäßig kurz, weil er darüber in früheren Schriften schon
ausführlich gehandelt hat. Ein Schlußkapitel über die ästhetische Bedeutung des
Häßlichen beschließt das schöne Buch, das jeder, auch wer nicht auf dem grundsätz-
lichen Standpunkte des Verfassers steht, mit Dank für die reiche Belehrung aus der
Hand legen wird. Möge der II. Teil nicht mehr zu lange auf sich warten lassen!
Berlin. Hermann Vahle.
Stephan Witasek, Grundzüge der allgemeinen Ästhetik. Leipzig, Ver-
lag von Johann Ambrosius Barth, 1904, kl. 8°. VII u. 410 S.
Kann es als Zeichen für das Aufblühen einer Wissenschaft gelten, wenn allge-
meine, die Einzelarbeiten des Gebietes zusammenfassende Darstellungen in schneller
Aufeinanderfolge erscheinen, so kann anderseits die fördernde Rückwirkung solcher
allgemeiner Darstellungen auf die Entwicklung der Wissenschaft nicht leicht über-
schätzt werden. Auch von dem vorliegenden Werke wird man eine solche Wirkung
erwarten dürfen. Es ermöglicht einen Überblick über die Leistungsfähigkeit meh-