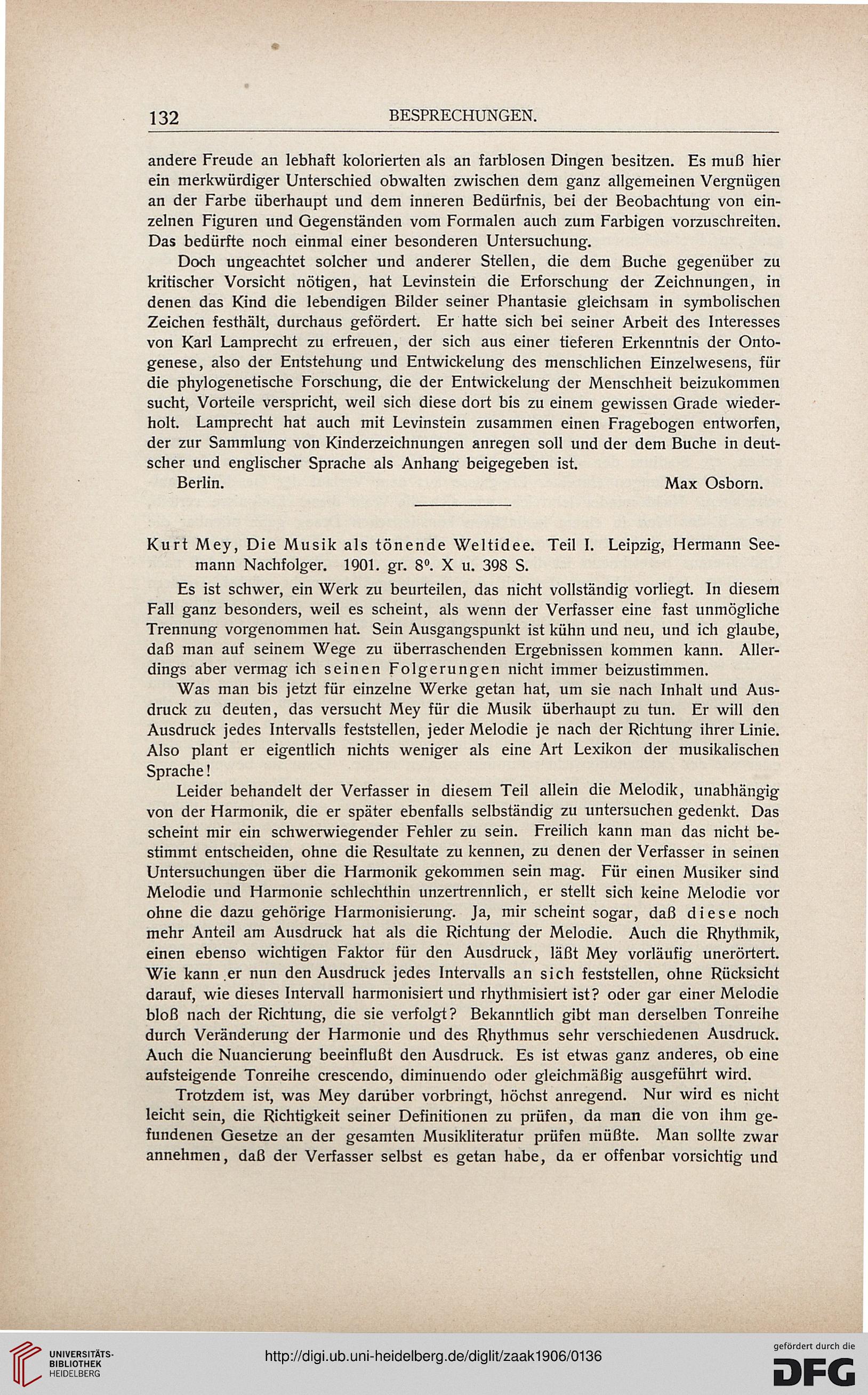132 BESPRECHUNGEN.
andere Freude an lebhaft kolorierten als an farblosen Dingen besitzen. Es muß hier
ein merkwürdiger Unterschied obwalten zwischen dem ganz allgemeinen Vergnügen
an der Farbe überhaupt und dem inneren Bedürfnis, bei der Beobachtung von ein-
zelnen Figuren und Gegenständen vom Formalen auch zum Farbigen vorzuschreiten.
Das bedürfte noch einmal einer besonderen Untersuchung.
Doch ungeachtet solcher und anderer Stellen, die dem Buche gegenüber zu
kritischer Vorsicht nötigen, hat Levinstein die Erforschung der Zeichnungen, in
denen das Kind die lebendigen Bilder seiner Phantasie gleichsam in symbolischen
Zeichen festhält, durchaus gefördert. Er hatte sich bei seiner Arbeit des Interesses
von Karl Lamprecht zu erfreuen, der sich aus einer tieferen Erkenntnis der Onto-
genese, also der Entstehung und Entwickelung des menschlichen Einzelwesens, für
die phylogenetische Forschung, die der Entwickelung der Menschheit beizukommen
sucht, Vorteile verspricht, weil sich diese dort bis zu einem gewissen Grade wieder-
holt. Lamprecht hat auch mit Levinstein zusammen einen Fragebogen entworfen,
der zur Sammlung von Kinderzeichnungen anregen soll und der dem Buche in deut-
scher und englischer Sprache als Anhang beigegeben ist.
Berlin. Max Osborn.
Kurt Mey, Die Musik als tönende Weltidee. Teil I. Leipzig, Hermann See-
mann Nachfolger. 1901. gr. 8°. X u. 398 S.
Es ist schwer, ein Werk zu beurteilen, das nicht vollständig vorliegt. In diesem
Fall ganz besonders, weil es scheint, als wenn der Verfasser eine fast unmögliche
Trennung vorgenommen hat. Sein Ausgangspunkt ist kühn und neu, und ich glaube,
daß man auf seinem Wege zu überraschenden Ergebnissen kommen kann. Aller-
dings aber vermag ich seinen Folgerungen nicht immer beizustimmen.
Was man bis jetzt für einzelne Werke getan hat, um sie nach Inhalt und Aus-
druck zu deuten, das versucht Mey für die Musik überhaupt zu tun. Er will den
Ausdruck jedes Intervalls feststellen, jeder Melodie je nach der Richtung ihrer Linie.
Also plant er eigentlich nichts weniger als eine Art Lexikon der musikalischen
Sprache!
Leider behandelt der Verfasser in diesem Teil allein die Melodik, unabhängig
von der Harmonik, die er später ebenfalls selbständig zu untersuchen gedenkt. Das
scheint mir ein schwerwiegender Fehler zu sein. Freilich kann man das nicht be-
stimmt entscheiden, ohne die Resultate zu kennen, zu denen der Verfasser in seinen
Untersuchungen über die Harmonik gekommen sein mag. Für einen Musiker sind
Melodie und Harmonie schlechthin unzertrennlich, er stellt sich keine Melodie vor
ohne die dazu gehörige Harmonisierung. Ja, mir scheint sogar, daß diese noch
mehr Anteil am Ausdruck hat als die Richtung der Melodie. Auch die Rhythmik,
einen ebenso wichtigen Faktor für den Ausdruck, läßt Mey vorläufig unerörtert.
Wie kann er nun den Ausdruck jedes Intervalls an sich feststellen, ohne Rücksicht
darauf, wie dieses Intervall harmonisiert und rhythmisiert ist? oder gar einer Melodie
bloß nach der Richtung, die sie verfolgt? Bekanntlich gibt man derselben Tonreihe
durch Veränderung der Harmonie und des Rhythmus sehr verschiedenen Ausdruck.
Auch die Nuancierung beeinflußt den Ausdruck. Es ist etwas ganz anderes, ob eine
aufsteigende Tonreihe crescendo, diminuendo oder gleichmäßig ausgeführt wird.
Trotzdem ist, was Mey darüber vorbringt, höchst anregend. Nur wird es nicht
leicht sein, die Richtigkeit seiner Definitionen zu prüfen, da man die von ihm ge-
fundenen Gesetze an der gesamten Musikliteratur prüfen müßte. Man sollte zwar
annehmen, daß der Verfasser selbst es getan habe, da er offenbar vorsichtig und
andere Freude an lebhaft kolorierten als an farblosen Dingen besitzen. Es muß hier
ein merkwürdiger Unterschied obwalten zwischen dem ganz allgemeinen Vergnügen
an der Farbe überhaupt und dem inneren Bedürfnis, bei der Beobachtung von ein-
zelnen Figuren und Gegenständen vom Formalen auch zum Farbigen vorzuschreiten.
Das bedürfte noch einmal einer besonderen Untersuchung.
Doch ungeachtet solcher und anderer Stellen, die dem Buche gegenüber zu
kritischer Vorsicht nötigen, hat Levinstein die Erforschung der Zeichnungen, in
denen das Kind die lebendigen Bilder seiner Phantasie gleichsam in symbolischen
Zeichen festhält, durchaus gefördert. Er hatte sich bei seiner Arbeit des Interesses
von Karl Lamprecht zu erfreuen, der sich aus einer tieferen Erkenntnis der Onto-
genese, also der Entstehung und Entwickelung des menschlichen Einzelwesens, für
die phylogenetische Forschung, die der Entwickelung der Menschheit beizukommen
sucht, Vorteile verspricht, weil sich diese dort bis zu einem gewissen Grade wieder-
holt. Lamprecht hat auch mit Levinstein zusammen einen Fragebogen entworfen,
der zur Sammlung von Kinderzeichnungen anregen soll und der dem Buche in deut-
scher und englischer Sprache als Anhang beigegeben ist.
Berlin. Max Osborn.
Kurt Mey, Die Musik als tönende Weltidee. Teil I. Leipzig, Hermann See-
mann Nachfolger. 1901. gr. 8°. X u. 398 S.
Es ist schwer, ein Werk zu beurteilen, das nicht vollständig vorliegt. In diesem
Fall ganz besonders, weil es scheint, als wenn der Verfasser eine fast unmögliche
Trennung vorgenommen hat. Sein Ausgangspunkt ist kühn und neu, und ich glaube,
daß man auf seinem Wege zu überraschenden Ergebnissen kommen kann. Aller-
dings aber vermag ich seinen Folgerungen nicht immer beizustimmen.
Was man bis jetzt für einzelne Werke getan hat, um sie nach Inhalt und Aus-
druck zu deuten, das versucht Mey für die Musik überhaupt zu tun. Er will den
Ausdruck jedes Intervalls feststellen, jeder Melodie je nach der Richtung ihrer Linie.
Also plant er eigentlich nichts weniger als eine Art Lexikon der musikalischen
Sprache!
Leider behandelt der Verfasser in diesem Teil allein die Melodik, unabhängig
von der Harmonik, die er später ebenfalls selbständig zu untersuchen gedenkt. Das
scheint mir ein schwerwiegender Fehler zu sein. Freilich kann man das nicht be-
stimmt entscheiden, ohne die Resultate zu kennen, zu denen der Verfasser in seinen
Untersuchungen über die Harmonik gekommen sein mag. Für einen Musiker sind
Melodie und Harmonie schlechthin unzertrennlich, er stellt sich keine Melodie vor
ohne die dazu gehörige Harmonisierung. Ja, mir scheint sogar, daß diese noch
mehr Anteil am Ausdruck hat als die Richtung der Melodie. Auch die Rhythmik,
einen ebenso wichtigen Faktor für den Ausdruck, läßt Mey vorläufig unerörtert.
Wie kann er nun den Ausdruck jedes Intervalls an sich feststellen, ohne Rücksicht
darauf, wie dieses Intervall harmonisiert und rhythmisiert ist? oder gar einer Melodie
bloß nach der Richtung, die sie verfolgt? Bekanntlich gibt man derselben Tonreihe
durch Veränderung der Harmonie und des Rhythmus sehr verschiedenen Ausdruck.
Auch die Nuancierung beeinflußt den Ausdruck. Es ist etwas ganz anderes, ob eine
aufsteigende Tonreihe crescendo, diminuendo oder gleichmäßig ausgeführt wird.
Trotzdem ist, was Mey darüber vorbringt, höchst anregend. Nur wird es nicht
leicht sein, die Richtigkeit seiner Definitionen zu prüfen, da man die von ihm ge-
fundenen Gesetze an der gesamten Musikliteratur prüfen müßte. Man sollte zwar
annehmen, daß der Verfasser selbst es getan habe, da er offenbar vorsichtig und