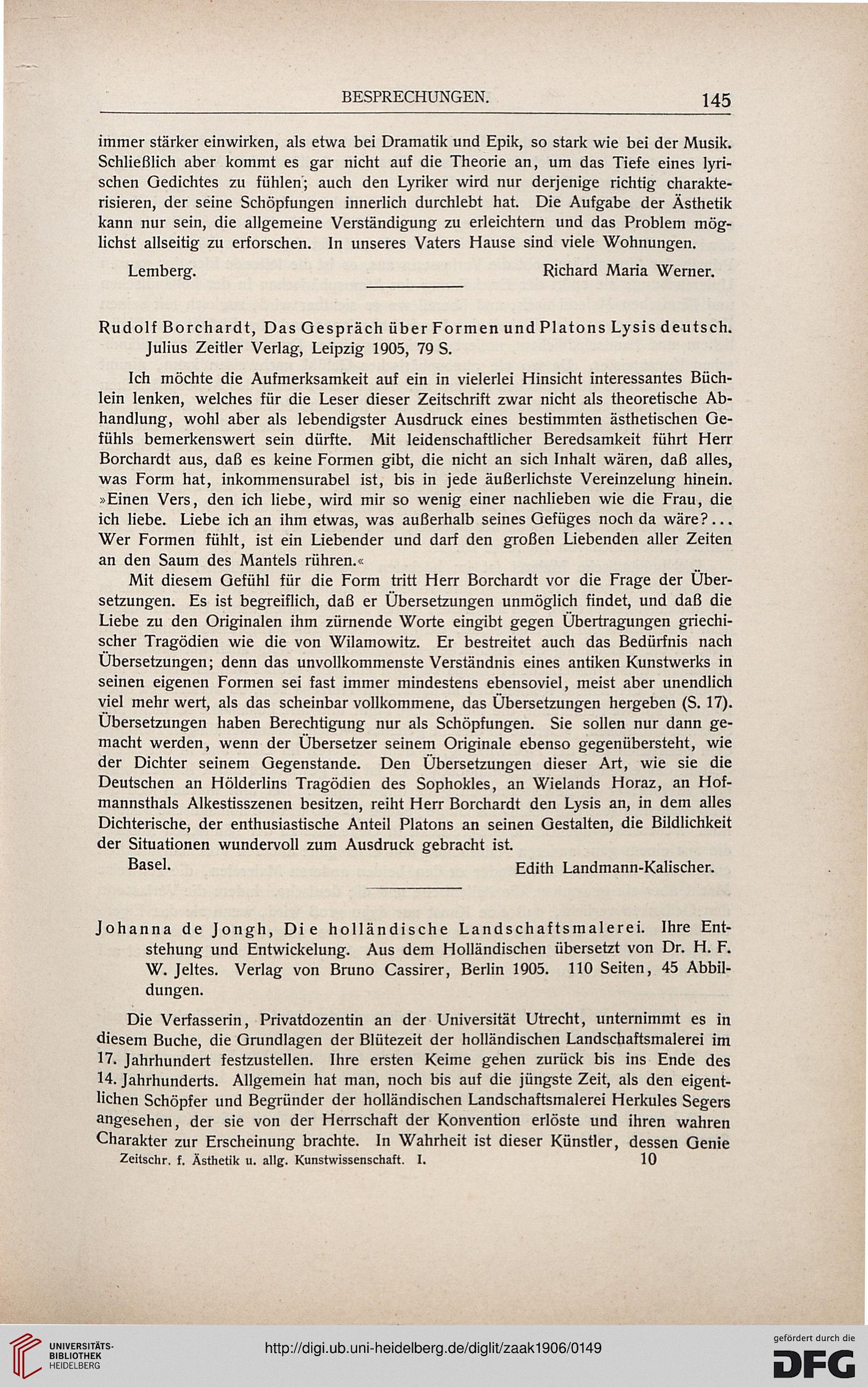BESPRECHUNGEN. 145
immer stärker einwirken, als etwa bei Dramatik und Epik, so stark wie bei der Musik.
Schließlich aber kommt es gar nicht auf die Theorie an, um das Tiefe eines lyri-
schen Gedichtes zu fühlen; auch den Lyriker wird nur derjenige richtig charakte-
risieren, der seine Schöpfungen innerlich durchlebt hat. Die Aufgabe der Ästhetik
kann nur sein, die allgemeine Verständigung zu erleichtern und das Problem mög-
lichst allseitig zu erforschen. In unseres Vaters Hause sind viele Wohnungen.
Lemberg. Richard Maria Werner.
RudolfBorchardt, Das Gespräch über Formen und Piatons Lysis deutsch.
Julius Zeitler Verlag, Leipzig 1905, 79 S.
Ich möchte die Aufmerksamkeit auf ein in vielerlei Hinsicht interessantes Büch-
lein lenken, welches für die Leser dieser Zeitschrift zwar nicht als theoretische Ab-
handlung, wohl aber als lebendigster Ausdruck eines bestimmten ästhetischen Ge-
fühls bemerkenswert sein dürfte. Mit leidenschaftlicher Beredsamkeit führt Herr
Borchardt aus, daß es keine Formen gibt, die nicht an sich Inhalt wären, daß alles,
was Form hat, inkommensurabel ist, bis in jede äußerlichste Vereinzelung hinein.
»Einen Vers, den ich liebe, wird mir so wenig einer nachlieben wie die Frau, die
ich liebe. Liebe ich an ihm etwas, was außerhalb seines Gefüges noch da wäre? ...
Wer Formen fühlt, ist ein Liebender und darf den großen Liebenden aller Zeiten
an den Saum des Mantels rühren.«
Mit diesem Gefühl für die Form tritt Herr Borchardt vor die Frage der Über-
setzungen. Es ist begreiflich, daß er Übersetzungen unmöglich findet, und daß die
Liebe zu den Originalen ihm zürnende Worte eingibt gegen Übertragungen griechi-
scher Tragödien wie die von Wilamowitz. Er bestreitet auch das Bedürfnis nach
Übersetzungen; denn das unvollkommenste Verständnis eines antiken Kunstwerks in
seinen eigenen Formen sei fast immer mindestens ebensoviel, meist aber unendlich
viel mehr wert, als das scheinbar vollkommene, das Übersetzungen hergeben (S. 17).
Übersetzungen haben Berechtigung nur als Schöpfungen. Sie sollen nur dann ge-
macht werden, wenn der Übersetzer seinem Originale ebenso gegenübersteht, wie
der Dichter seinem Gegenstande. Den Übersetzungen dieser Art, wie sie die
Deutschen an Hölderlins Tragödien des Sophokles, an Wielands Horaz, an Hof-
mannsthals Alkestisszenen besitzen, reiht Herr Borchardt den Lysis an, in dem alles
Dichterische, der enthusiastische Anteil Piatons an seinen Gestalten, die Bildlichkeit
der Situationen wundervoll zum Ausdruck gebracht ist
Basel. Edith Landmann-Kalischer.
Johanna de Jongh, Die holländische Landschaftsmalerei. Ihre Ent-
stehung und Entwickelung. Aus dem Holländischen übersetzt von Dr. H. F.
W. Jeltes. Verlag von Bruno Cassirer, Berlin 1905. 110 Seiten, 45 Abbil-
dungen.
Die Verfasserin, Privatdozentin an der Universität Utrecht, unternimmt es in
diesem Buche, die Grundlagen der Blütezeit der holländischen Landschaftsmalerei im
17. Jahrhundert festzustellen. Ihre ersten Keime gehen zurück bis ins Ende des
14. Jahrhunderts. Allgemein hat man, noch bis auf die jüngste Zeit, als den eigent-
lichen Schöpfer und Begründer der holländischen Landschaftsmalerei Herkules Segers
angesehen, der sie von der Herrschaft der Konvention erlöste und ihren wahren
Charakter zur Erscheinung brachte. In Wahrheit ist dieser Künstler, dessen Genie
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. I. 10
immer stärker einwirken, als etwa bei Dramatik und Epik, so stark wie bei der Musik.
Schließlich aber kommt es gar nicht auf die Theorie an, um das Tiefe eines lyri-
schen Gedichtes zu fühlen; auch den Lyriker wird nur derjenige richtig charakte-
risieren, der seine Schöpfungen innerlich durchlebt hat. Die Aufgabe der Ästhetik
kann nur sein, die allgemeine Verständigung zu erleichtern und das Problem mög-
lichst allseitig zu erforschen. In unseres Vaters Hause sind viele Wohnungen.
Lemberg. Richard Maria Werner.
RudolfBorchardt, Das Gespräch über Formen und Piatons Lysis deutsch.
Julius Zeitler Verlag, Leipzig 1905, 79 S.
Ich möchte die Aufmerksamkeit auf ein in vielerlei Hinsicht interessantes Büch-
lein lenken, welches für die Leser dieser Zeitschrift zwar nicht als theoretische Ab-
handlung, wohl aber als lebendigster Ausdruck eines bestimmten ästhetischen Ge-
fühls bemerkenswert sein dürfte. Mit leidenschaftlicher Beredsamkeit führt Herr
Borchardt aus, daß es keine Formen gibt, die nicht an sich Inhalt wären, daß alles,
was Form hat, inkommensurabel ist, bis in jede äußerlichste Vereinzelung hinein.
»Einen Vers, den ich liebe, wird mir so wenig einer nachlieben wie die Frau, die
ich liebe. Liebe ich an ihm etwas, was außerhalb seines Gefüges noch da wäre? ...
Wer Formen fühlt, ist ein Liebender und darf den großen Liebenden aller Zeiten
an den Saum des Mantels rühren.«
Mit diesem Gefühl für die Form tritt Herr Borchardt vor die Frage der Über-
setzungen. Es ist begreiflich, daß er Übersetzungen unmöglich findet, und daß die
Liebe zu den Originalen ihm zürnende Worte eingibt gegen Übertragungen griechi-
scher Tragödien wie die von Wilamowitz. Er bestreitet auch das Bedürfnis nach
Übersetzungen; denn das unvollkommenste Verständnis eines antiken Kunstwerks in
seinen eigenen Formen sei fast immer mindestens ebensoviel, meist aber unendlich
viel mehr wert, als das scheinbar vollkommene, das Übersetzungen hergeben (S. 17).
Übersetzungen haben Berechtigung nur als Schöpfungen. Sie sollen nur dann ge-
macht werden, wenn der Übersetzer seinem Originale ebenso gegenübersteht, wie
der Dichter seinem Gegenstande. Den Übersetzungen dieser Art, wie sie die
Deutschen an Hölderlins Tragödien des Sophokles, an Wielands Horaz, an Hof-
mannsthals Alkestisszenen besitzen, reiht Herr Borchardt den Lysis an, in dem alles
Dichterische, der enthusiastische Anteil Piatons an seinen Gestalten, die Bildlichkeit
der Situationen wundervoll zum Ausdruck gebracht ist
Basel. Edith Landmann-Kalischer.
Johanna de Jongh, Die holländische Landschaftsmalerei. Ihre Ent-
stehung und Entwickelung. Aus dem Holländischen übersetzt von Dr. H. F.
W. Jeltes. Verlag von Bruno Cassirer, Berlin 1905. 110 Seiten, 45 Abbil-
dungen.
Die Verfasserin, Privatdozentin an der Universität Utrecht, unternimmt es in
diesem Buche, die Grundlagen der Blütezeit der holländischen Landschaftsmalerei im
17. Jahrhundert festzustellen. Ihre ersten Keime gehen zurück bis ins Ende des
14. Jahrhunderts. Allgemein hat man, noch bis auf die jüngste Zeit, als den eigent-
lichen Schöpfer und Begründer der holländischen Landschaftsmalerei Herkules Segers
angesehen, der sie von der Herrschaft der Konvention erlöste und ihren wahren
Charakter zur Erscheinung brachte. In Wahrheit ist dieser Künstler, dessen Genie
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. I. 10