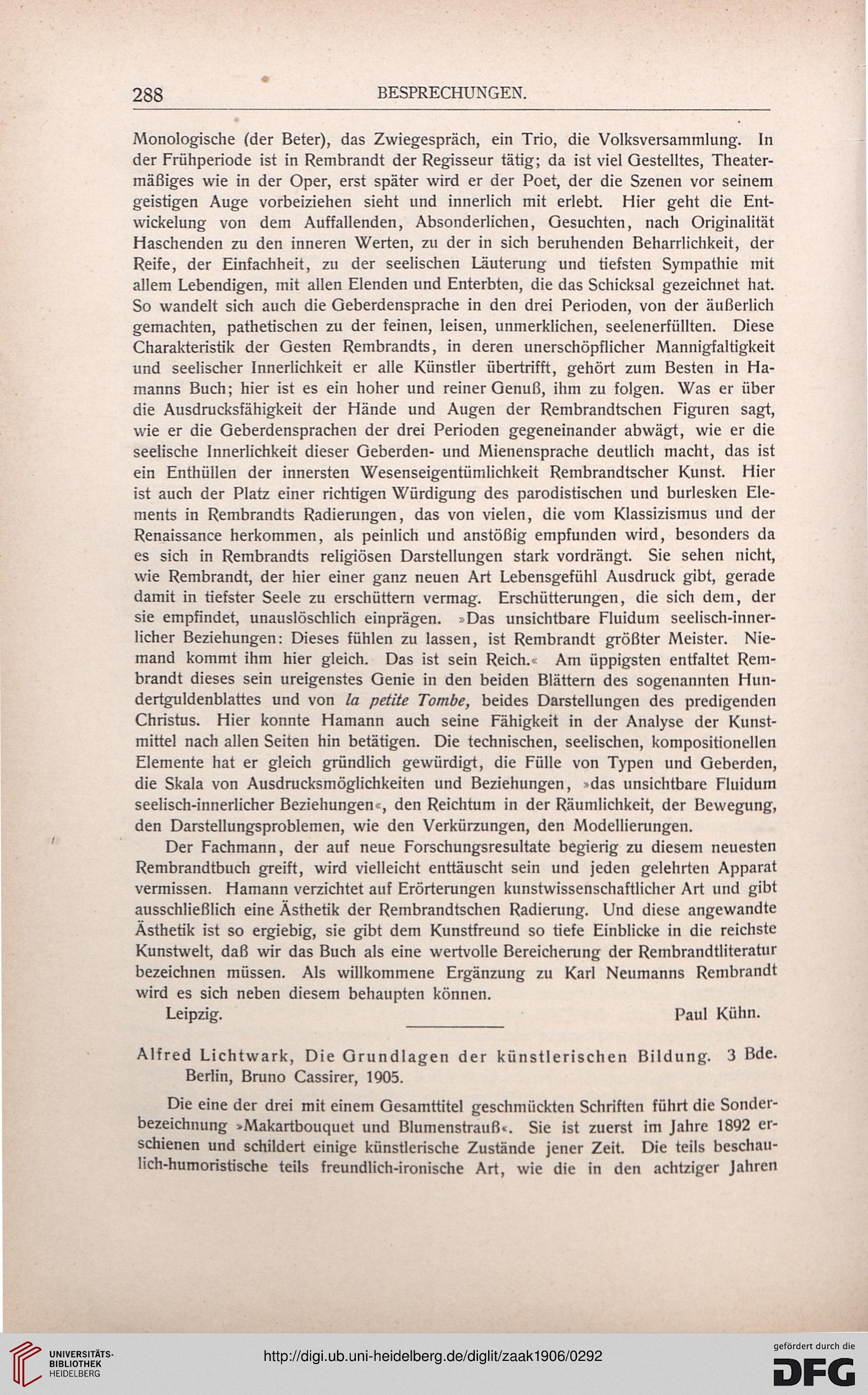288 BESPRECHUNGEN.
Monologische (der Beter), das Zwiegespräch, ein Trio, die Volksversammlung. In
der Frühperiode ist in Rembrandt der Regisseur tätig; da ist viel Gestelltes, Theater-
mäßiges wie in der Oper, erst später wird er der Poet, der die Szenen vor seinem
geistigen Auge vorbeiziehen sieht und innerlich mit erlebt. Hier geht die Ent-
wicklung von dem Auffallenden, Absonderlichen, Gesuchten, nach Originalität
Haschenden zu den inneren Werten, zu der in sich beruhenden Beharrlichkeit, der
Reife, der Einfachheit, zu der seelischen Läuterung und tiefsten Sympathie mit
allem Lebendigen, mit allen Elenden und Enterbten, die das Schicksal gezeichnet hat.
So wandelt sich auch die Geberdensprache in den drei Perioden, von der äußerlich
gemachten, pathetischen zu der feinen, leisen, unmerklichen, seelenerfüllten. Diese
Charakteristik der Gesten Rembrandts, in deren unerschöpflicher Mannigfaltigkeit
und seelischer Innerlichkeit er alle Künstler übertrifft, gehört zum Besten in Ha-
manns Buch; hier ist es ein hoher und reiner Genuß, ihm zu folgen. Was er über
die Ausdrucksfähigkeit der Hände und Augen der Rembrandtschen Figuren sagt,
wie er die Geberdensprachen der drei Perioden gegeneinander abwägt, wie er die
seelische Innerlichkeit dieser Geberden- und Mienensprache deutlich macht, das ist
ein Enthüllen der innersten Wesenseigentümlichkeit Rembrandtscher Kunst. Hier
ist auch der Platz einer richtigen Würdigung des parodistischen und burlesken Ele-
ments in Rembrandts Radierungen, das von vielen, die vom Klassizismus und der
Renaissance herkommen, als peinlich und anstößig empfunden wird, besonders da
es sich in Rembrandts religiösen Darstellungen stark vordrängt. Sie sehen nicht,
wie Rembrandt, der hier einer ganz neuen Art Lebensgefühl Ausdruck gibt, gerade
damit in tiefster Seele zu erschüttern vermag. Erschütterungen, die sich dem, der
sie empfindet, unauslöschlich einprägen. -Das unsichtbare Fluidum seelisch-inner-
licher Beziehungen: Dieses fühlen zu lassen, ist Rembrandt größter Meister. Nie-
mand kommt ihm hier gleich. Das ist sein Reich.« Am üppigsten entfaltet Rem-
brandt dieses sein ureigenstes Genie in den beiden Blättern des sogenannten Hun-
dertguldenblattes und von la petite Tombe, beides Darstellungen des predigenden
Christus. Hier konnte Hamann auch seine Fähigkeit in der Analyse der Kunst-
mittel nach allen Seiten hin betätigen. Die technischen, seelischen, kompositionellen
Elemente hat er gleich gründlich gewürdigt, die Fülle von Typen und Geberden,
die Skala von Ausdrucksmöglichkeiten und Beziehungen, »das unsichtbare Fluidum
seelisch-innerlicher Beziehungen«:, den Reichtum in der Räumlichkeit, der Bewegung,
den Darstellungsproblemen, wie den Verkürzungen, den Modellierungen.
Der Fachmann, der auf neue Forschungsresultate begierig zu diesem neuesten
Rembrandtbuch greift, wird vielleicht enttäuscht sein und jeden gelehrten Apparat
vermissen. Hamann verzichtet auf Erörterungen kunstwissenschaftlicher Art und gibt
ausschließlich eine Ästhetik der Rembrandtschen Radierung. Und diese angewandte
Ästhetik ist so ergiebig, sie gibt dem Kunstfreund so tiefe Einblicke in die reichste
Kunstwelt, daß wir das Buch als eine wertvolle Bereicherung der Rembrandtliteratur
bezeichnen müssen. Als willkommene Ergänzung zu Karl Neumanns Rembrandt
wird es sich neben diesem behaupten können.
Leipzig. Paul Kühn.
Alfred Lichtwark, Die Grundlagen der künstlerischen Bildung. 3 Bde.
Berlin, Bruno Cassirer, 1905.
Die eine der drei mit einem Gesamttitel geschmückten Schriften führt die Sonder-
bezeichnung »Makartbouquet und Blumenstrauß«. Sie ist zuerst im Jahre 1892 er-
schienen und schildert einige künstlerische Zustände jener Zeit. Die teils beschau-
lich-humoristische teils freundlich-ironische Art, wie die in den achtziger Jahren