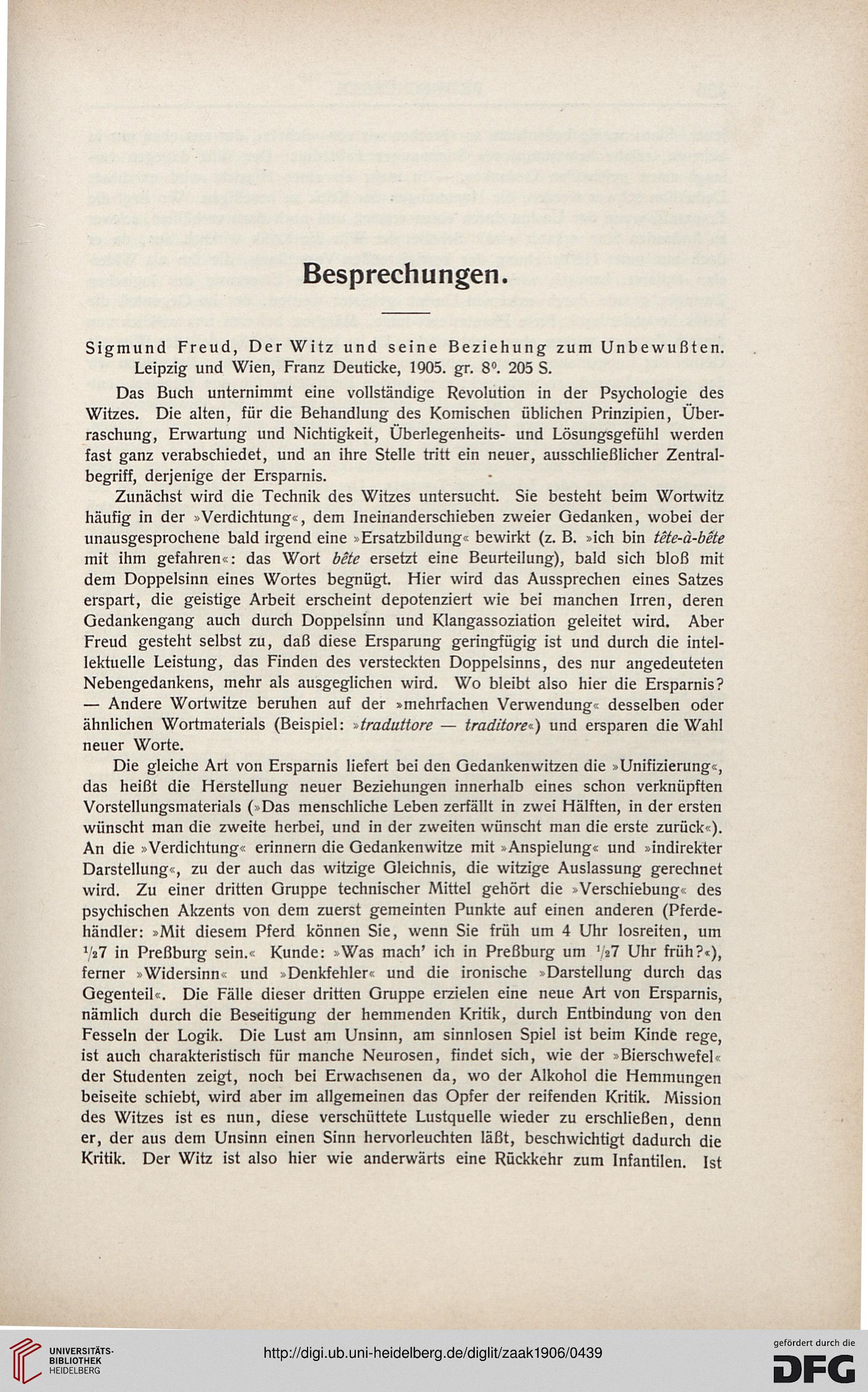Besprechungen.
Sigmund Freud, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten.
Leipzig und Wien, Franz Deuticke, 1905. gr. 8°. 205 S.
Das Buch unternimmt eine vollständige Revolution in der Psychologie des
Witzes. Die alten, für die Behandlung des Komischen üblichen Prinzipien, Über-
raschung, Erwartung und Nichtigkeit, Überlegenheits- und Lösungsgefühl werden
fast ganz verabschiedet, und an ihre Stelle tritt ein neuer, ausschließlicher Zentral-
begriff, derjenige der Ersparnis.
Zunächst wird die Technik des Witzes untersucht. Sie besteht beim Wortwitz
häufig in der »Verdichtung«, dem Ineinanderschieben zweier Gedanken, wobei der
unausgesprochene bald irgend eine »Ersatzbildung« bewirkt (z. B. »ich bin tete-ä-bete
mit ihm gefahren«: das Wort bete ersetzt eine Beurteilung), bald sich bloß mit
dem Doppelsinn eines Wortes begnügt. Hier wird das Aussprechen eines Satzes
erspart, die geistige Arbeit erscheint depotenziert wie bei manchen Irren, deren
Gedankengang auch durch Doppelsinn und Klangassoziation geleitet wird. Aber
Freud gesteht selbst zu, daß diese Ersparung geringfügig ist und durch die intel-
lektuelle Leistung, das Finden des versteckten Doppelsinns, des nur angedeuteten
Nebengedankens, mehr als ausgeglichen wird. Wo bleibt also hier die Ersparnis?
— Andere Wortwitze beruhen auf der »mehrfachen Verwendung« desselben oder
ähnlichen Wortmaterials (Beispiel: -traduttore — traditore^ und ersparen die Wahl
neuer Worte.
Die gleiche Art von Ersparnis liefert bei den Gedankenwitzen die »Unifizierung«,
das heißt die Herstellung neuer Beziehungen innerhalb eines schon verknüpften
Vorstellungsmaterials (»Das menschliche Leben zerfällt in zwei Hälften, in der ersten
wünscht man die zweite herbei, und in der zweiten wünscht man die erste zurück«).
An die »Verdichtung« erinnern die Gedankenwitze mit »Anspielung« und »indirekter
Darstellung«, zu der auch das witzige Gleichnis, die witzige Auslassung gerechnet
wird. Zu einer dritten Gruppe technischer Mittel gehört die »Verschiebung« des
psychischen Akzents von dem zuerst gemeinten Punkte auf einen anderen (Pferde-
händler: »Mit diesem Pferd können Sie, wenn Sie früh um 4 Uhr losreiten, um
V27 in Preßburg sein.« Kunde: »Was mach' ich in Preßburg um '/i7 Uhr früh?«),
ferner »Widersinn« und »Denkfehler« und die ironische »Darstellung durch das
Gegenteil«. Die Fälle dieser dritten Gruppe erzielen eine neue Art von Ersparnis,
nämlich durch die Beseitigung der hemmenden Kritik, durch Entbindung von den
Fesseln der Logik. Die Lust am Unsinn, am sinnlosen Spiel ist beim Kinde rege,
ist auch charakteristisch für manche Neurosen, findet sich, wie der »Bierschwefel«
der Studenten zeigt, noch bei Erwachsenen da, wo der Alkohol die Hemmungen
beiseite schiebt, wird aber im allgemeinen das Opfer der reifenden Kritik. Mission
des Witzes ist es nun, diese verschüttete Lustquelle wieder zu erschließen, denn
er, der aus dem Unsinn einen Sinn hervorleuchten läßt, beschwichtigt dadurch die
Kritik. Der Witz ist also hier wie anderwärts eine Rückkehr zum Infantilen. Ist
Sigmund Freud, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten.
Leipzig und Wien, Franz Deuticke, 1905. gr. 8°. 205 S.
Das Buch unternimmt eine vollständige Revolution in der Psychologie des
Witzes. Die alten, für die Behandlung des Komischen üblichen Prinzipien, Über-
raschung, Erwartung und Nichtigkeit, Überlegenheits- und Lösungsgefühl werden
fast ganz verabschiedet, und an ihre Stelle tritt ein neuer, ausschließlicher Zentral-
begriff, derjenige der Ersparnis.
Zunächst wird die Technik des Witzes untersucht. Sie besteht beim Wortwitz
häufig in der »Verdichtung«, dem Ineinanderschieben zweier Gedanken, wobei der
unausgesprochene bald irgend eine »Ersatzbildung« bewirkt (z. B. »ich bin tete-ä-bete
mit ihm gefahren«: das Wort bete ersetzt eine Beurteilung), bald sich bloß mit
dem Doppelsinn eines Wortes begnügt. Hier wird das Aussprechen eines Satzes
erspart, die geistige Arbeit erscheint depotenziert wie bei manchen Irren, deren
Gedankengang auch durch Doppelsinn und Klangassoziation geleitet wird. Aber
Freud gesteht selbst zu, daß diese Ersparung geringfügig ist und durch die intel-
lektuelle Leistung, das Finden des versteckten Doppelsinns, des nur angedeuteten
Nebengedankens, mehr als ausgeglichen wird. Wo bleibt also hier die Ersparnis?
— Andere Wortwitze beruhen auf der »mehrfachen Verwendung« desselben oder
ähnlichen Wortmaterials (Beispiel: -traduttore — traditore^ und ersparen die Wahl
neuer Worte.
Die gleiche Art von Ersparnis liefert bei den Gedankenwitzen die »Unifizierung«,
das heißt die Herstellung neuer Beziehungen innerhalb eines schon verknüpften
Vorstellungsmaterials (»Das menschliche Leben zerfällt in zwei Hälften, in der ersten
wünscht man die zweite herbei, und in der zweiten wünscht man die erste zurück«).
An die »Verdichtung« erinnern die Gedankenwitze mit »Anspielung« und »indirekter
Darstellung«, zu der auch das witzige Gleichnis, die witzige Auslassung gerechnet
wird. Zu einer dritten Gruppe technischer Mittel gehört die »Verschiebung« des
psychischen Akzents von dem zuerst gemeinten Punkte auf einen anderen (Pferde-
händler: »Mit diesem Pferd können Sie, wenn Sie früh um 4 Uhr losreiten, um
V27 in Preßburg sein.« Kunde: »Was mach' ich in Preßburg um '/i7 Uhr früh?«),
ferner »Widersinn« und »Denkfehler« und die ironische »Darstellung durch das
Gegenteil«. Die Fälle dieser dritten Gruppe erzielen eine neue Art von Ersparnis,
nämlich durch die Beseitigung der hemmenden Kritik, durch Entbindung von den
Fesseln der Logik. Die Lust am Unsinn, am sinnlosen Spiel ist beim Kinde rege,
ist auch charakteristisch für manche Neurosen, findet sich, wie der »Bierschwefel«
der Studenten zeigt, noch bei Erwachsenen da, wo der Alkohol die Hemmungen
beiseite schiebt, wird aber im allgemeinen das Opfer der reifenden Kritik. Mission
des Witzes ist es nun, diese verschüttete Lustquelle wieder zu erschließen, denn
er, der aus dem Unsinn einen Sinn hervorleuchten läßt, beschwichtigt dadurch die
Kritik. Der Witz ist also hier wie anderwärts eine Rückkehr zum Infantilen. Ist