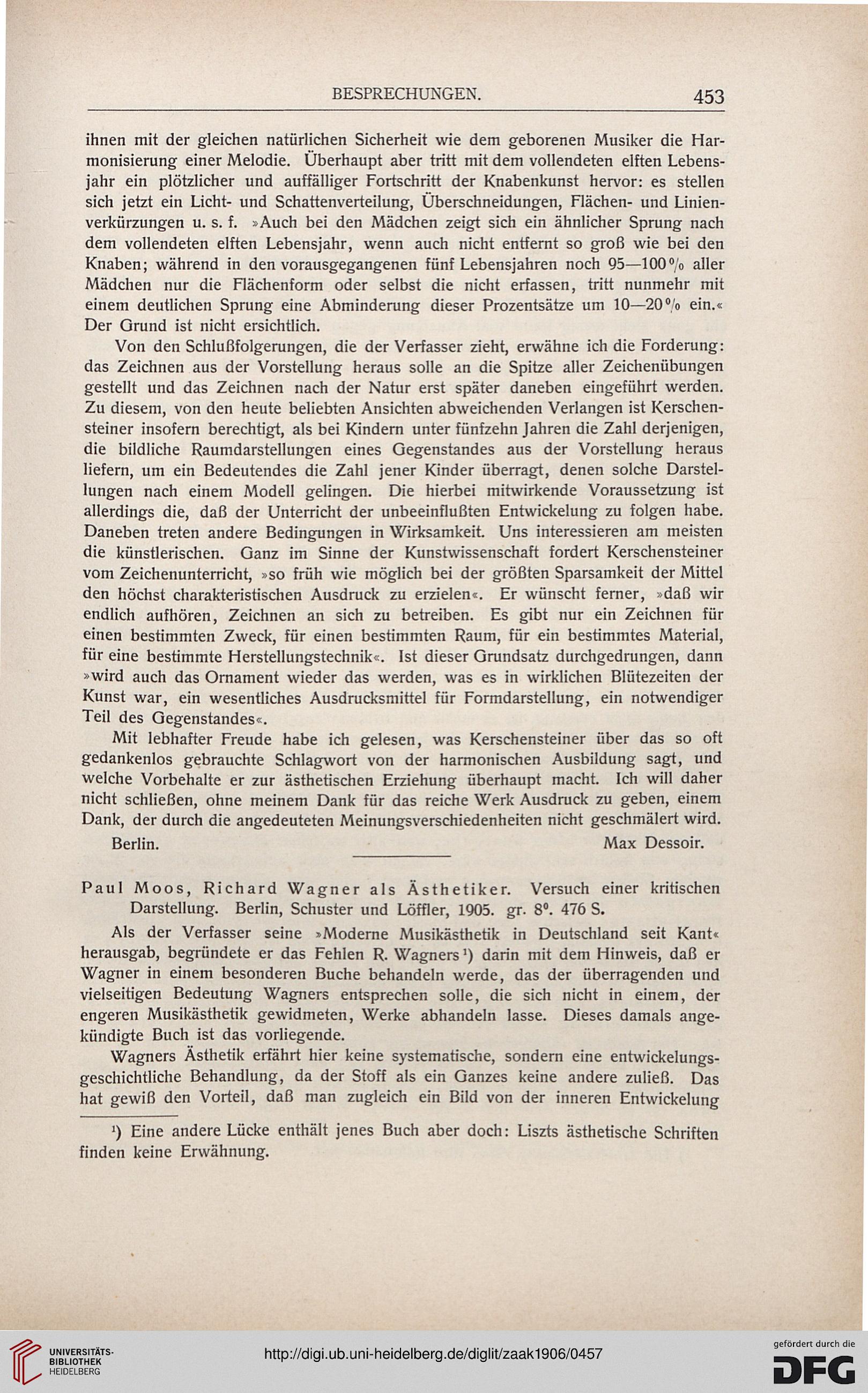BESPRECHUNGEN. 453
ihnen mit der gleichen natürlichen Sicherheit wie dem geborenen Musiker die Har-
monisierung einer Melodie. Überhaupt aber tritt mit dem vollendeten elften Lebens-
jahr ein plötzlicher und auffälliger Fortschritt der Knabenkunst hervor: es stellen
sich jetzt ein Licht- und Schattenverteilung, Überschneidungen, Flächen- und Linien-
verkürzungen u. s. f. »Auch bei den Mädchen zeigt sich ein ähnlicher Sprung nach
dem vollendeten elften Lebensjahr, wenn auch nicht entfernt so groß wie bei den
Knaben; während in den vorausgegangenen fünf Lebensjahren noch 95—100°/o aller
Mädchen nur die Flächenform oder selbst die nicht erfassen, tritt nunmehr mit
einem deutlichen Sprung eine Abminderung dieser Prozentsätze um 10—20% ein.«
Der Grund ist nicht ersichtlich.
Von den Schlußfolgerungen, die der Verfasser zieht, erwähne ich die Forderung:
das Zeichnen aus der Vorstellung heraus solle an die Spitze aller Zeichenübungen
gestellt und das Zeichnen nach der Natur erst später daneben eingeführt werden.
Zu diesem, von den heute beliebten Ansichten abweichenden Verlangen ist Kerschen-
steiner insofern berechtigt, als bei Kindern unter fünfzehn Jahren die Zahl derjenigen,
die bildliche Raumdarstellungen eines Gegenstandes aus der Vorstellung heraus
liefern, um ein Bedeutendes die Zahl jener Kinder überragt, denen solche Darstel-
lungen nach einem Modell gelingen. Die hierbei mitwirkende Voraussetzung ist
allerdings die, daß der Unterricht der unbeeinflußten Entwickelung zu folgen habe.
Daneben treten andere Bedingungen in Wirksamkeit. Uns interessieren am meisten
die künstlerischen. Ganz im Sinne der Kunstwissenschaft fordert Kerschensteiner
vom Zeichenunterricht, »so früh wie möglich bei der größten Sparsamkeit der Mittel
den höchst charakteristischen Ausdruck zu erzielen«. Er wünscht ferner, »daß wir
endlich aufhören, Zeichnen an sich zu betreiben. Es gibt nur ein Zeichnen für
einen bestimmten Zweck, für einen bestimmten Raum, für ein bestimmtes Material,
für eine bestimmte Herstellungstechnik«. Ist dieser Grundsatz durchgedrungen, dann
»wird auch das Ornament wieder das werden, was es in wirklichen Blütezeiten der
Kunst war, ein wesentliches Ausdrucksmittel für Formdarstellung, ein notwendiger
Teil des Gegenstandes«.
Mit lebhafter Freude habe ich gelesen, was Kerschensteiner über das so oft
gedankenlos gebrauchte Schlagwort von der harmonischen Ausbildung sagt, und
welche Vorbehalte er zur ästhetischen Erziehung überhaupt macht. Ich will daher
nicht schließen, ohne meinem Dank für das reiche Werk Ausdruck zu geben, einem
Dank, der durch die angedeuteten Meinungsverschiedenheiten nicht geschmälert wird.
Berlin. Max Dessoir.
Paul Moos, Richard Wagner als Ästhetiker. Versuch einer kritischen
Darstellung. Berlin, Schuster und Löffler, 1905. gr. 8°. 476 S.
Als der Verfasser seine »Moderne Musikästhetik in Deutschland seit Kant«
herausgab, begründete er das Fehlen R. Wagners') darin mit dem Hinweis, daß er
Wagner in einem besonderen Buche behandeln werde, das der überragenden und
vielseitigen Bedeutung Wagners entsprechen solle, die sich nicht in einem, der
engeren Musikästhetik gewidmeten, Werke abhandeln lasse. Dieses damals ange-
kündigte Buch ist das vorliegende.
Wagners Ästhetik erfährt hier keine systematische, sondern eine entwickelungs-
geschichtliche Behandlung, da der Stoff als ein Ganzes keine andere zuließ. Das
hat gewiß den Vorteil, daß man zugleich ein Bild von der inneren Entwickelung
') Eine andere Lücke enthält jenes Buch aber doch: Liszts ästhetische Schriften
finden keine Erwähnung.
ihnen mit der gleichen natürlichen Sicherheit wie dem geborenen Musiker die Har-
monisierung einer Melodie. Überhaupt aber tritt mit dem vollendeten elften Lebens-
jahr ein plötzlicher und auffälliger Fortschritt der Knabenkunst hervor: es stellen
sich jetzt ein Licht- und Schattenverteilung, Überschneidungen, Flächen- und Linien-
verkürzungen u. s. f. »Auch bei den Mädchen zeigt sich ein ähnlicher Sprung nach
dem vollendeten elften Lebensjahr, wenn auch nicht entfernt so groß wie bei den
Knaben; während in den vorausgegangenen fünf Lebensjahren noch 95—100°/o aller
Mädchen nur die Flächenform oder selbst die nicht erfassen, tritt nunmehr mit
einem deutlichen Sprung eine Abminderung dieser Prozentsätze um 10—20% ein.«
Der Grund ist nicht ersichtlich.
Von den Schlußfolgerungen, die der Verfasser zieht, erwähne ich die Forderung:
das Zeichnen aus der Vorstellung heraus solle an die Spitze aller Zeichenübungen
gestellt und das Zeichnen nach der Natur erst später daneben eingeführt werden.
Zu diesem, von den heute beliebten Ansichten abweichenden Verlangen ist Kerschen-
steiner insofern berechtigt, als bei Kindern unter fünfzehn Jahren die Zahl derjenigen,
die bildliche Raumdarstellungen eines Gegenstandes aus der Vorstellung heraus
liefern, um ein Bedeutendes die Zahl jener Kinder überragt, denen solche Darstel-
lungen nach einem Modell gelingen. Die hierbei mitwirkende Voraussetzung ist
allerdings die, daß der Unterricht der unbeeinflußten Entwickelung zu folgen habe.
Daneben treten andere Bedingungen in Wirksamkeit. Uns interessieren am meisten
die künstlerischen. Ganz im Sinne der Kunstwissenschaft fordert Kerschensteiner
vom Zeichenunterricht, »so früh wie möglich bei der größten Sparsamkeit der Mittel
den höchst charakteristischen Ausdruck zu erzielen«. Er wünscht ferner, »daß wir
endlich aufhören, Zeichnen an sich zu betreiben. Es gibt nur ein Zeichnen für
einen bestimmten Zweck, für einen bestimmten Raum, für ein bestimmtes Material,
für eine bestimmte Herstellungstechnik«. Ist dieser Grundsatz durchgedrungen, dann
»wird auch das Ornament wieder das werden, was es in wirklichen Blütezeiten der
Kunst war, ein wesentliches Ausdrucksmittel für Formdarstellung, ein notwendiger
Teil des Gegenstandes«.
Mit lebhafter Freude habe ich gelesen, was Kerschensteiner über das so oft
gedankenlos gebrauchte Schlagwort von der harmonischen Ausbildung sagt, und
welche Vorbehalte er zur ästhetischen Erziehung überhaupt macht. Ich will daher
nicht schließen, ohne meinem Dank für das reiche Werk Ausdruck zu geben, einem
Dank, der durch die angedeuteten Meinungsverschiedenheiten nicht geschmälert wird.
Berlin. Max Dessoir.
Paul Moos, Richard Wagner als Ästhetiker. Versuch einer kritischen
Darstellung. Berlin, Schuster und Löffler, 1905. gr. 8°. 476 S.
Als der Verfasser seine »Moderne Musikästhetik in Deutschland seit Kant«
herausgab, begründete er das Fehlen R. Wagners') darin mit dem Hinweis, daß er
Wagner in einem besonderen Buche behandeln werde, das der überragenden und
vielseitigen Bedeutung Wagners entsprechen solle, die sich nicht in einem, der
engeren Musikästhetik gewidmeten, Werke abhandeln lasse. Dieses damals ange-
kündigte Buch ist das vorliegende.
Wagners Ästhetik erfährt hier keine systematische, sondern eine entwickelungs-
geschichtliche Behandlung, da der Stoff als ein Ganzes keine andere zuließ. Das
hat gewiß den Vorteil, daß man zugleich ein Bild von der inneren Entwickelung
') Eine andere Lücke enthält jenes Buch aber doch: Liszts ästhetische Schriften
finden keine Erwähnung.