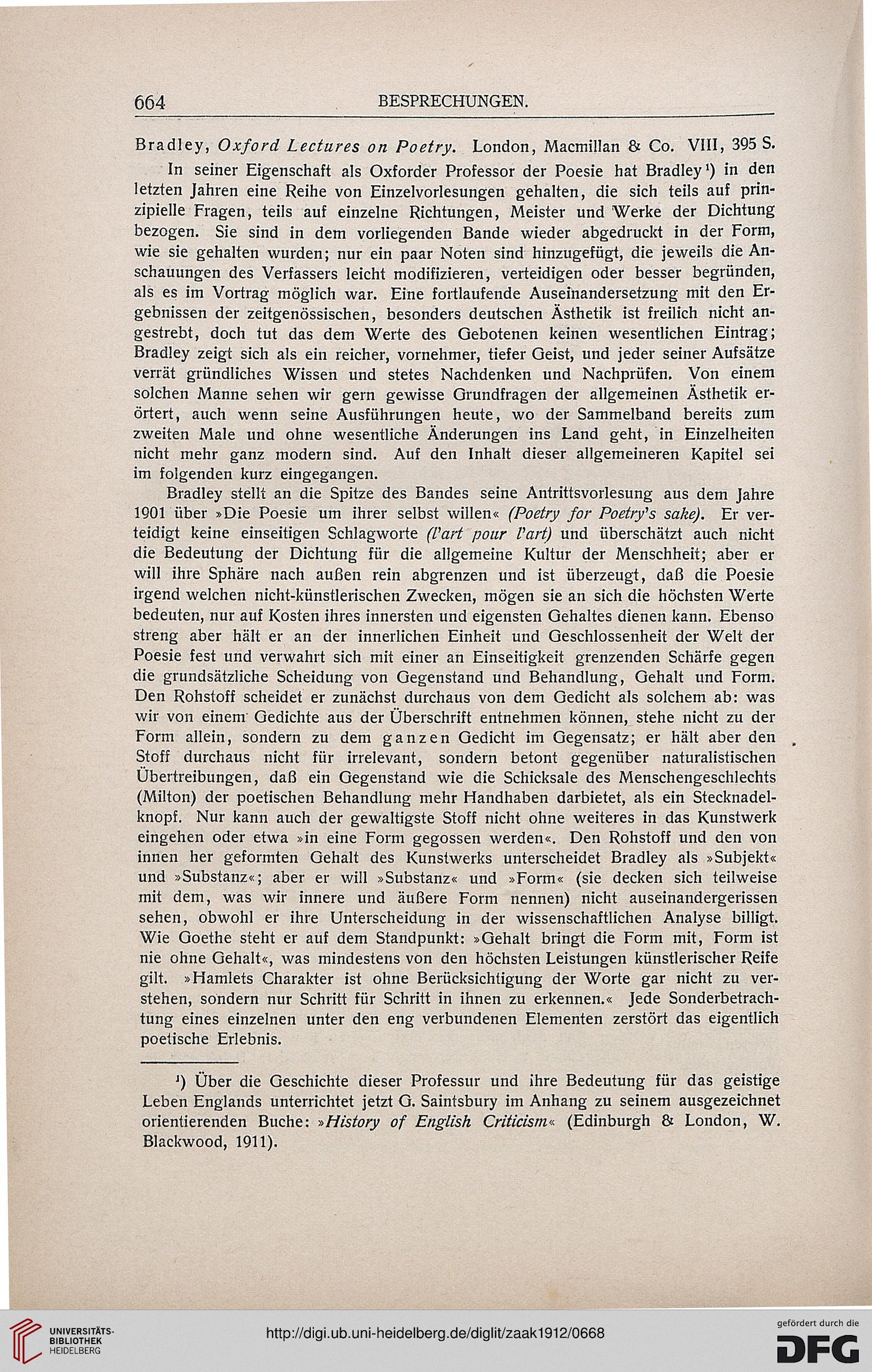664 BESPRECHUNGEN.
Bradley, Oxford Lectures on Poetry. London, Macmillan & Co. VIII, 395 S.
In seiner Eigenschaft als Oxforder Professor der Poesie hat Bradleyl) in den
letzten Jahren eine Reihe von Einzelvorlesungen gehalten, die sich teils auf prin-
zipielle Fragen, teils auf einzelne Richtungen, Meister und Werke der Dichtung
bezogen. Sie sind in dem vorliegenden Bande wieder abgedruckt in der Form,
wie sie gehalten wurden; nur ein paar Noten sind hinzugefügt, die jeweils die An-
schauungen des Verfassers leicht modifizieren, verteidigen oder besser begründen,
als es im Vortrag möglich war. Eine fortlaufende Auseinandersetzung mit den Er-
gebnissen der zeitgenössischen, besonders deutschen Ästhetik ist freilich nicht an-
gestrebt, doch tut das dem Werte des Gebotenen keinen wesentlichen Eintrag;
Bradley zeigt sich als ein reicher, vornehmer, tiefer Geist, und jeder seiner Aufsätze
verrät gründliches Wissen und stetes Nachdenken und Nachprüfen. Von einem
solchen Manne sehen wir gern gewisse Grundfragen der allgemeinen Ästhetik er-
örtert, auch wenn seine Ausführungen heute, wo der Sammelband bereits zum
zweiten Male und ohne wesentliche Änderungen ins Land geht, in Einzelheiten
nicht mehr ganz modern sind. Auf den Inhalt dieser allgemeineren Kapitel sei
im folgenden kurz eingegangen.
Bradley stellt an die Spitze des Bandes seine Antrittsvorlesung aus dem Jahre
1901 über »Die Poesie um ihrer selbst willen« (Poetry for Poetry's sake). Er ver-
teidigt keine einseitigen Schlagworte (l'art pour Part) und überschätzt auch nicht
die Bedeutung der Dichtung für die allgemeine Kultur der Menschheit; aber er
will ihre Sphäre nach außen rein abgrenzen und ist überzeugt, daß die Poesie
irgend welchen nicht-künstlerischen Zwecken, mögen sie an sich die höchsten Werte
bedeuten, nur auf Kosten ihres innersten und eigensten Gehaltes dienen kann. Ebenso
streng aber hält er an der innerlichen Einheit und Geschlossenheit der Welt der
Poesie fest und verwahrt sich mit einer an Einseitigkeit grenzenden Schärfe gegen
die grundsätzliche Scheidung von Gegenstand und Behandlung, Gehalt und Form.
Den Rohstoff scheidet er zunächst durchaus von dem Gedicht als solchem ab: was
wir von einem Gedichte aus der Überschrift entnehmen können, stehe nicht zu der
Form allein, sondern zu dem ganzen Gedicht im Gegensatz; er hält aber den
Stoff durchaus nicht für irrelevant, sondern betont gegenüber naturalistischen
Übertreibungen, daß ein Gegenstand wie die Schicksale des Menschengeschlechts
(Milton) der poetischen Behandlung mehr Handhaben darbietet, als ein Stecknadel-
knopf. Nur kann auch der gewaltigste Stoff nicht ohne weiteres in das Kunstwerk
eingehen oder etwa »in eine Form gegossen werden«. Den Rohstoff und den von
innen her geformten Gehalt des Kunstwerks unterscheidet Bradley als »Subjekt«
und »Substanz«; aber er will »Substanz« und »Form« (sie decken sich teilweise
mit dem, was wir innere und äußere Form nennen) nicht auseinandergerissen
sehen, obwohl er ihre Unterscheidung in der wissenschaftlichen Analyse billigt.
Wie Goethe steht er auf dem Standpunkt: »Gehalt bringt die Form mit, Form ist
nie ohne Gehalt«, was mindestens von den höchsten Leistungen künstlerischer Reife
gilt. »Hamlets Charakter ist ohne Berücksichtigung der Worte gar nicht zu ver-
stehen, sondern nur Schritt für Schritt in ihnen zu erkennen.« Jede Sonderbetrach-
tung eines einzelnen unter den eng verbundenen Elementen zerstört das eigentlich
poetische Erlebnis.
') Über die Geschichte dieser Professur und ihre Bedeutung für das geistige
Leben Englands unterrichtet jetzt G. Saintsbury im Anhang zu seinem ausgezeichnet
orientierenden Buche: »History of English Criticism« (Edinburgh & London, W.
Blackwood, 1911).