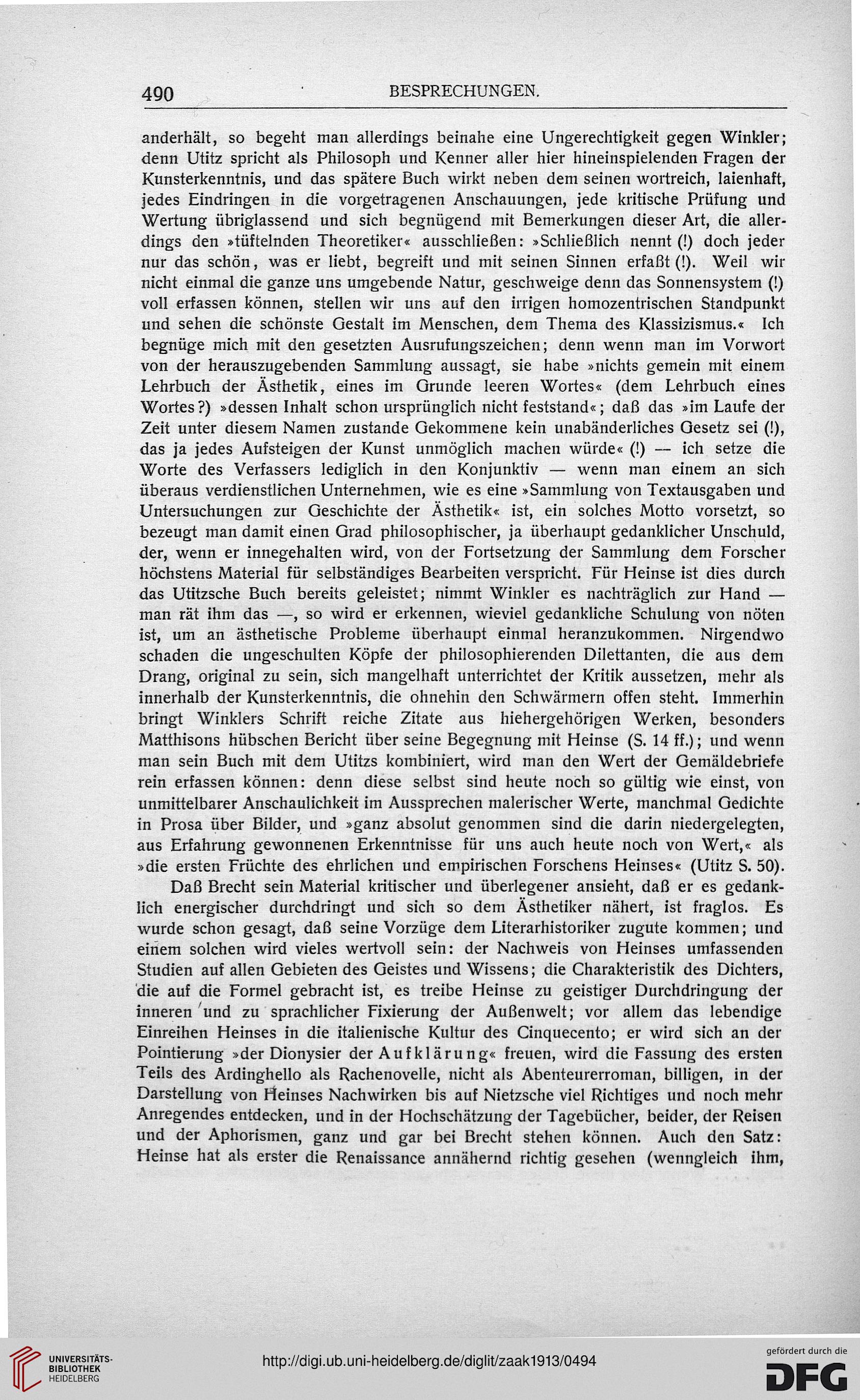490 ' BESPRECHUNGEN.
anderhält, so begeht man allerdings beinahe eine Ungerechtigkeit gegen Winkler;
denn Utitz spricht als Philosoph und Kenner aller hier hineinspielenden Fragen der
Kunsterkenntnis, und das spätere Buch wirkt neben dem seinen wortreich, laienhaft,
jedes Eindringen in die vorgetragenen Anschauungen, jede kritische Prüfung und
Wertung übriglassend und sich begnügend mit Bemerkungen dieser Art, die aller-
dings den »tüftelnden Theoretiker« ausschließen: »Schließlich nennt (!) doch jeder
nur das schön, was er liebt, begreift und mit seinen Sinnen erfaßt (!). Weil wir
nicht einmal die ganze uns umgebende Natur, geschweige denn das Sonnensystem (!)
voll erfassen können, stellen wir uns auf den irrigen homozentrischen Standpunkt
und sehen die schönste Gestalt im Menschen, dem Thema des Klassizismus.« Ich
begnüge mich mit den gesetzten Ausrufungszeichen; denn wenn man im Vorwort
von der herauszugebenden Sammlung aussagt, sie habe »nichts gemein mit einem
Lehrbuch der Ästhetik, eines im Grunde leeren Wortes« (dem Lehrbuch eines
Wortes?) »dessen Inhalt schon ursprünglich nicht feststand«; daß das »im Laufe der
Zeit unter diesem Namen zustande Gekommene kein unabänderliches Gesetz sei (!),
das ja jedes Aufsteigen der Kunst unmöglich machen würde« (!) — ich setze die
Worte des Verfassers lediglich in den Konjunktiv — wenn man einem an sich
überaus verdienstlichen Unternehmen, wie es eine »Sammlung von Textausgaben und
Untersuchungen zur Geschichte der Ästhetik« ist, ein solches Motto vorsetzt, so
bezeugt man damit einen Grad philosophischer, ja überhaupt gedanklicher Unschuld,
der, wenn er innegehalten wird, von der Fortsetzung der Sammlung dem Forscher
höchstens Material für selbständiges Bearbeiten verspricht. Für Heinse ist dies durch
das Utitzsche Buch bereits geleistet; nimmt Winkler es nachträglich zur Hand —
man rät ihm das —, so wird er erkennen, wieviel gedankliche Schulung von nöten
ist, um an ästhetische Probleme überhaupt einmal heranzukommen. Nirgendwo
schaden die ungeschulten Köpfe der philosophierenden Dilettanten, die aus dem
Drang, original zu sein, sich mangelhaft unterrichtet der Kritik aussetzen, mehr als
innerhalb der Kunsterkenntnis, die ohnehin den Schwärmern offen steht. Immerhin
bringt Winklers Schrift reiche Zitate aus hiehergehörigen Werken, besonders
Matthisons hübschen Bericht über seine Begegnung mit Heinse (S. 14 ff.); und wenn
man sein Buch mit dem Utitzs kombiniert, wird man den Wert der Gemäldebriefe
rein erfassen können: denn diese selbst sind heute noch so gültig wie einst, von
unmittelbarer Anschaulichkeit im Aussprechen malerischer Werte, manchmal Gedichte
in Prosa über Bilder, und »ganz absolut genommen sind die darin niedergelegten,
aus Erfahrung gewonnenen Erkenntnisse für uns auch heute noch von Wert,« als
»die ersten Früchte des ehrlichen und empirischen Forschens Heinses« (Utitz S. 50).
Daß Brecht sein Material kritischer und überlegener ansieht, daß er es gedank-
lich energischer durchdringt und sich so dem Ästhetiker nähert, ist fraglos. Es
wurde schon gesagt, daß seine Vorzüge dem Literarhistoriker zugute kommen; und
einem solchen wird vieles wertvoll sein: der Nachweis von Heinses umfassenden
Studien auf allen Gebieten des Geistes und Wissens; die Charakteristik des Dichters,
die auf die Formel gebracht ist, es treibe Heinse zu geistiger Durchdringung der
inneren und zu sprachlicher Fixierung der Außenwelt; vor allem das lebendige
Einreihen Heinses in die italienische Kultur des Cinquecento; er wird sich an der
Pointierung »der Dionysier der Auf klärung« freuen, wird die Fassung des ersten
Teils des Ardinghello als Rachenovelle, nicht als Abenteurerroman, billigen, in der
Darstellung von Heinses Nachwirken bis auf Nietzsche viel Richtiges und noch mehr
Anregendes entdecken, und in der Hochschätzung der Tagebücher, beider, der Reisen
und der Aphorismen, ganz und gar bei Brecht stehen können. Auch den Satz:
Heinse hat als erster die Renaissance annähernd richtig gesehen (wenngleich ihm,
anderhält, so begeht man allerdings beinahe eine Ungerechtigkeit gegen Winkler;
denn Utitz spricht als Philosoph und Kenner aller hier hineinspielenden Fragen der
Kunsterkenntnis, und das spätere Buch wirkt neben dem seinen wortreich, laienhaft,
jedes Eindringen in die vorgetragenen Anschauungen, jede kritische Prüfung und
Wertung übriglassend und sich begnügend mit Bemerkungen dieser Art, die aller-
dings den »tüftelnden Theoretiker« ausschließen: »Schließlich nennt (!) doch jeder
nur das schön, was er liebt, begreift und mit seinen Sinnen erfaßt (!). Weil wir
nicht einmal die ganze uns umgebende Natur, geschweige denn das Sonnensystem (!)
voll erfassen können, stellen wir uns auf den irrigen homozentrischen Standpunkt
und sehen die schönste Gestalt im Menschen, dem Thema des Klassizismus.« Ich
begnüge mich mit den gesetzten Ausrufungszeichen; denn wenn man im Vorwort
von der herauszugebenden Sammlung aussagt, sie habe »nichts gemein mit einem
Lehrbuch der Ästhetik, eines im Grunde leeren Wortes« (dem Lehrbuch eines
Wortes?) »dessen Inhalt schon ursprünglich nicht feststand«; daß das »im Laufe der
Zeit unter diesem Namen zustande Gekommene kein unabänderliches Gesetz sei (!),
das ja jedes Aufsteigen der Kunst unmöglich machen würde« (!) — ich setze die
Worte des Verfassers lediglich in den Konjunktiv — wenn man einem an sich
überaus verdienstlichen Unternehmen, wie es eine »Sammlung von Textausgaben und
Untersuchungen zur Geschichte der Ästhetik« ist, ein solches Motto vorsetzt, so
bezeugt man damit einen Grad philosophischer, ja überhaupt gedanklicher Unschuld,
der, wenn er innegehalten wird, von der Fortsetzung der Sammlung dem Forscher
höchstens Material für selbständiges Bearbeiten verspricht. Für Heinse ist dies durch
das Utitzsche Buch bereits geleistet; nimmt Winkler es nachträglich zur Hand —
man rät ihm das —, so wird er erkennen, wieviel gedankliche Schulung von nöten
ist, um an ästhetische Probleme überhaupt einmal heranzukommen. Nirgendwo
schaden die ungeschulten Köpfe der philosophierenden Dilettanten, die aus dem
Drang, original zu sein, sich mangelhaft unterrichtet der Kritik aussetzen, mehr als
innerhalb der Kunsterkenntnis, die ohnehin den Schwärmern offen steht. Immerhin
bringt Winklers Schrift reiche Zitate aus hiehergehörigen Werken, besonders
Matthisons hübschen Bericht über seine Begegnung mit Heinse (S. 14 ff.); und wenn
man sein Buch mit dem Utitzs kombiniert, wird man den Wert der Gemäldebriefe
rein erfassen können: denn diese selbst sind heute noch so gültig wie einst, von
unmittelbarer Anschaulichkeit im Aussprechen malerischer Werte, manchmal Gedichte
in Prosa über Bilder, und »ganz absolut genommen sind die darin niedergelegten,
aus Erfahrung gewonnenen Erkenntnisse für uns auch heute noch von Wert,« als
»die ersten Früchte des ehrlichen und empirischen Forschens Heinses« (Utitz S. 50).
Daß Brecht sein Material kritischer und überlegener ansieht, daß er es gedank-
lich energischer durchdringt und sich so dem Ästhetiker nähert, ist fraglos. Es
wurde schon gesagt, daß seine Vorzüge dem Literarhistoriker zugute kommen; und
einem solchen wird vieles wertvoll sein: der Nachweis von Heinses umfassenden
Studien auf allen Gebieten des Geistes und Wissens; die Charakteristik des Dichters,
die auf die Formel gebracht ist, es treibe Heinse zu geistiger Durchdringung der
inneren und zu sprachlicher Fixierung der Außenwelt; vor allem das lebendige
Einreihen Heinses in die italienische Kultur des Cinquecento; er wird sich an der
Pointierung »der Dionysier der Auf klärung« freuen, wird die Fassung des ersten
Teils des Ardinghello als Rachenovelle, nicht als Abenteurerroman, billigen, in der
Darstellung von Heinses Nachwirken bis auf Nietzsche viel Richtiges und noch mehr
Anregendes entdecken, und in der Hochschätzung der Tagebücher, beider, der Reisen
und der Aphorismen, ganz und gar bei Brecht stehen können. Auch den Satz:
Heinse hat als erster die Renaissance annähernd richtig gesehen (wenngleich ihm,