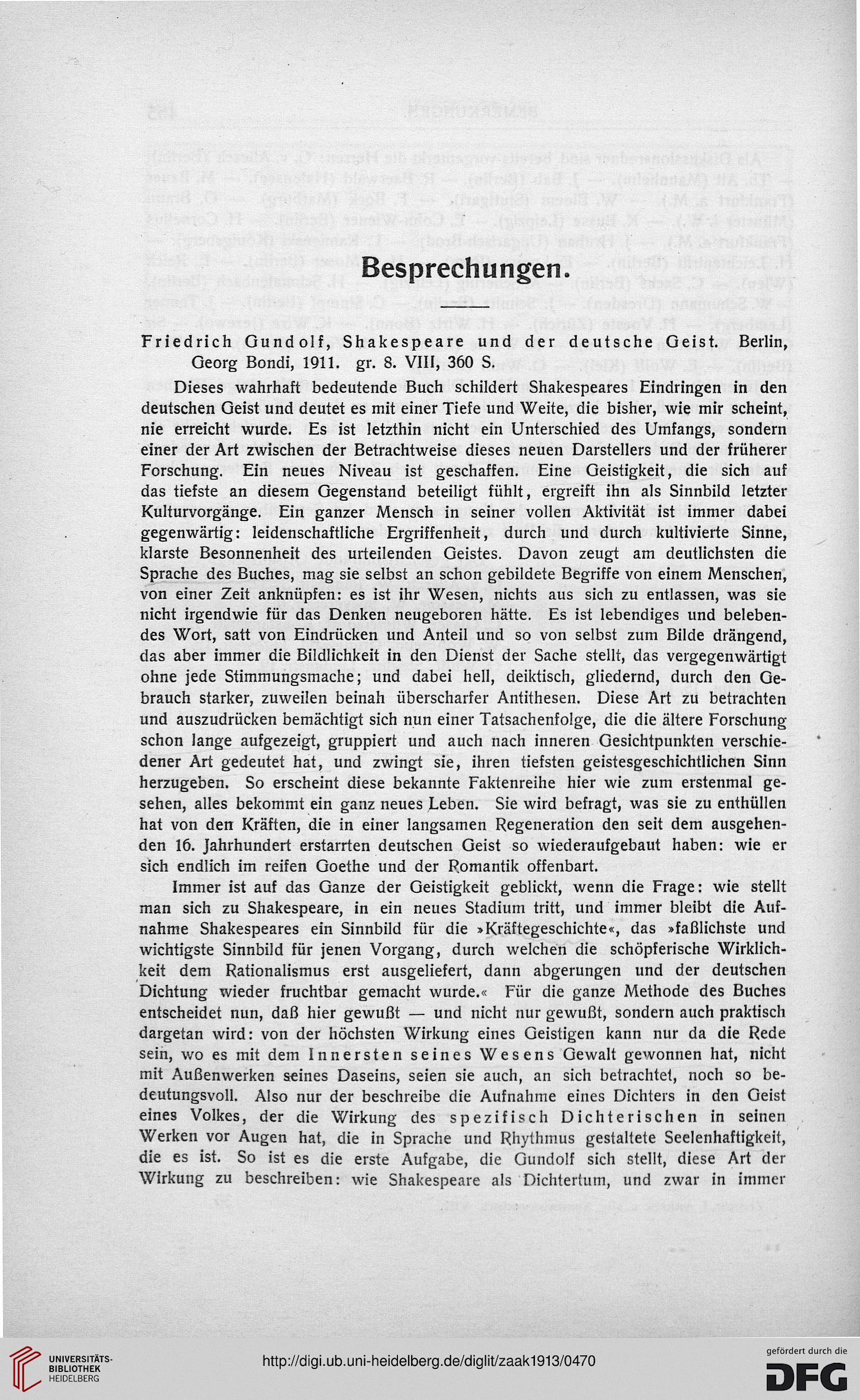Besprechungen.
Friedrich Oundolf, Shakespeare und der deutsche Geist. Berlin,
Georg Bondi, 1911. gr. 8. VIII, 360 S.
Dieses wahrhaft bedeutende Buch schildert Shakespeares Eindringen in den
deutschen Geist und deutet es mit einer Tiefe und Weite, die bisher, wie mir scheint,
nie erreicht wurde. Es ist letzthin nicht ein Unterschied des Umfangs, sondern
einer der Art zwischen der Betrachtweise dieses neuen Darstellers und der früherer
Forschung. Ein neues Niveau ist geschaffen. Eine Geistigkeit, die sich auf
das tiefste an diesem Gegenstand beteiligt fühlt, ergreift ihn als Sinnbild letzter
Kulturvorgänge. Ein ganzer Mensch in seiner vollen Aktivität ist immer dabei
gegenwärtig: leidenschaftliche Ergriffenheit, durch und durch kultivierte Sinne,
klarste Besonnenheit des urteilenden Geistes. Davon zeugt am deutlichsten die
Sprache des Buches, mag sie selbst an schon gebildete Begriffe von einem Menschen,
von einer Zeit anknüpfen: es ist ihr Wesen, nichts aus sich zu entlassen, was sie
nicht irgendwie für das Denken neugeboren hätte. Es ist lebendiges und beleben-
des Wort, satt von Eindrücken und Anteil und so von selbst zum Bilde drängend,
das aber immer die Bildlichkeit in den Dienst der Sache stellt, das vergegenwärtigt
ohne jede Stimmungsmache; und dabei hell, deiktisch, gliedernd, durch den Ge-
brauch starker, zuweilen beinah überscharfer Antithesen. Diese Art zu betrachten
und auszudrücken bemächtigt sich nun einer Tatsachenfolge, die die ältere Forschung
schon lange aufgezeigt, gruppiert und auch nach inneren Gesichtpunkten verschie-
dener Art gedeutet hat, und zwingt sie, ihren tiefsten geistesgeschichtlichen Sinn
herzugeben. So erscheint diese bekannte Faktenreihe hier wie zum erstenmal ge-
sehen, alles bekommt ein ganz neues Leben. Sie wird befragt, was sie zu enthüllen
hat von den Kräften, die in einer langsamen Regeneration den seit dem ausgehen-
den 16. Jahrhundert erstarrten deutschen Geist so wiederaufgebaut haben: wie er
sich endlich im reifen Goethe und der Romantik offenbart.
Immer ist auf das Ganze der Geistigkeit geblickt, wenn die Frage: wie stellt
man sich zu Shakespeare, in ein neues Stadium tritt, und immer bleibt die Auf-
nahme Shakespeares ein Sinnbild für die »Kräftegeschichte«, das »faßlichste und
wichtigste Sinnbild für jenen Vorgang, durch welchen die schöpferische Wirklich-
keit dem Rationalismus erst ausgeliefert, dann abgerungen und der deutschen
Dichtung wieder fruchtbar gemacht wurde.« Für die ganze Methode des Buches
entscheidet nun, daß hier gewußt — und nicht nur gewußt, sondern auch praktisch
dargetan wird: von der höchsten Wirkung eines Geistigen kann nur da die Rede
sein, wo es mit dem Innersten seines Wesens Gewalt gewonnen hat, nicht
mit Außenwerken seines Daseins, seien sie auch, an sich betrachtet, noch so be-
deutungsvoll. Also nur der beschreibe die Aufnahme eines Dichters in den Geist
eines Volkes, der die Wirkung des spezifisch Dichterischen in seinen
Werken vor Augen hat, die in Sprache und Rhythmus gestaltete Seelenhaftigkeit,
die es ist. So ist es die erste Aufgabe, die Gundolf sich stellt, diese Art der
Wirkung zu beschreiben: wie Shakespeare als Dichtertum, und zwar in immer
Friedrich Oundolf, Shakespeare und der deutsche Geist. Berlin,
Georg Bondi, 1911. gr. 8. VIII, 360 S.
Dieses wahrhaft bedeutende Buch schildert Shakespeares Eindringen in den
deutschen Geist und deutet es mit einer Tiefe und Weite, die bisher, wie mir scheint,
nie erreicht wurde. Es ist letzthin nicht ein Unterschied des Umfangs, sondern
einer der Art zwischen der Betrachtweise dieses neuen Darstellers und der früherer
Forschung. Ein neues Niveau ist geschaffen. Eine Geistigkeit, die sich auf
das tiefste an diesem Gegenstand beteiligt fühlt, ergreift ihn als Sinnbild letzter
Kulturvorgänge. Ein ganzer Mensch in seiner vollen Aktivität ist immer dabei
gegenwärtig: leidenschaftliche Ergriffenheit, durch und durch kultivierte Sinne,
klarste Besonnenheit des urteilenden Geistes. Davon zeugt am deutlichsten die
Sprache des Buches, mag sie selbst an schon gebildete Begriffe von einem Menschen,
von einer Zeit anknüpfen: es ist ihr Wesen, nichts aus sich zu entlassen, was sie
nicht irgendwie für das Denken neugeboren hätte. Es ist lebendiges und beleben-
des Wort, satt von Eindrücken und Anteil und so von selbst zum Bilde drängend,
das aber immer die Bildlichkeit in den Dienst der Sache stellt, das vergegenwärtigt
ohne jede Stimmungsmache; und dabei hell, deiktisch, gliedernd, durch den Ge-
brauch starker, zuweilen beinah überscharfer Antithesen. Diese Art zu betrachten
und auszudrücken bemächtigt sich nun einer Tatsachenfolge, die die ältere Forschung
schon lange aufgezeigt, gruppiert und auch nach inneren Gesichtpunkten verschie-
dener Art gedeutet hat, und zwingt sie, ihren tiefsten geistesgeschichtlichen Sinn
herzugeben. So erscheint diese bekannte Faktenreihe hier wie zum erstenmal ge-
sehen, alles bekommt ein ganz neues Leben. Sie wird befragt, was sie zu enthüllen
hat von den Kräften, die in einer langsamen Regeneration den seit dem ausgehen-
den 16. Jahrhundert erstarrten deutschen Geist so wiederaufgebaut haben: wie er
sich endlich im reifen Goethe und der Romantik offenbart.
Immer ist auf das Ganze der Geistigkeit geblickt, wenn die Frage: wie stellt
man sich zu Shakespeare, in ein neues Stadium tritt, und immer bleibt die Auf-
nahme Shakespeares ein Sinnbild für die »Kräftegeschichte«, das »faßlichste und
wichtigste Sinnbild für jenen Vorgang, durch welchen die schöpferische Wirklich-
keit dem Rationalismus erst ausgeliefert, dann abgerungen und der deutschen
Dichtung wieder fruchtbar gemacht wurde.« Für die ganze Methode des Buches
entscheidet nun, daß hier gewußt — und nicht nur gewußt, sondern auch praktisch
dargetan wird: von der höchsten Wirkung eines Geistigen kann nur da die Rede
sein, wo es mit dem Innersten seines Wesens Gewalt gewonnen hat, nicht
mit Außenwerken seines Daseins, seien sie auch, an sich betrachtet, noch so be-
deutungsvoll. Also nur der beschreibe die Aufnahme eines Dichters in den Geist
eines Volkes, der die Wirkung des spezifisch Dichterischen in seinen
Werken vor Augen hat, die in Sprache und Rhythmus gestaltete Seelenhaftigkeit,
die es ist. So ist es die erste Aufgabe, die Gundolf sich stellt, diese Art der
Wirkung zu beschreiben: wie Shakespeare als Dichtertum, und zwar in immer