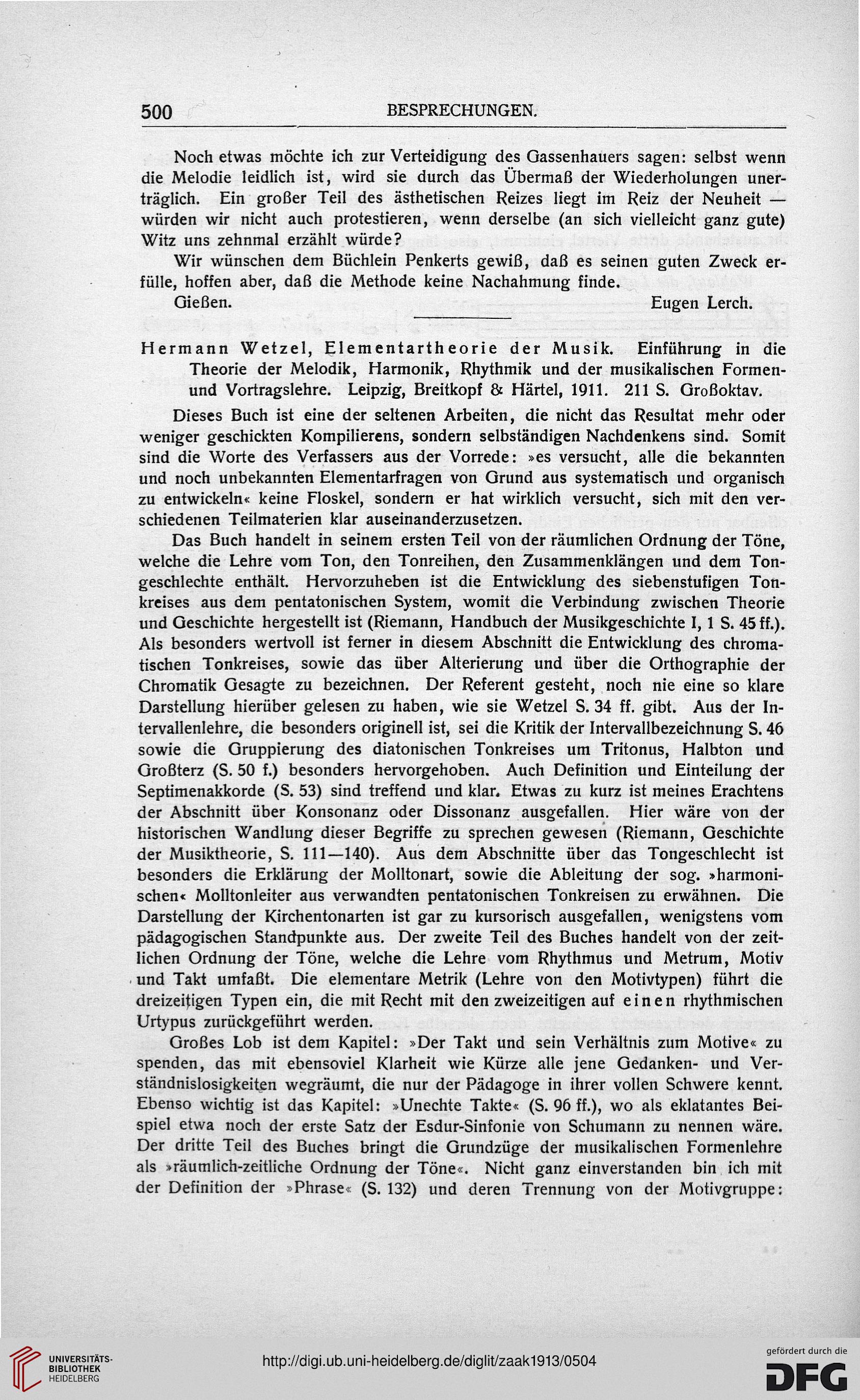500 BESPRECHUNGEN.
Noch etwas möchte ich zur Verteidigung des Gassenhauers sagen: selbst wenn
die Melodie leidlich ist, wird sie durch das Übermaß der Wiederholungen uner-
träglich. Ein großer Teil des ästhetischen Reizes liegt im Reiz der Neuheit —
würden wir nicht auch protestieren, wenn derselbe (an sich vielleicht ganz gute)
Witz uns zehnmal erzählt würde?
Wir wünschen dem Büchlein Penkerts gewiß, daß es seinen guten Zweck er-
fülle, hoffen aber, daß die Methode keine Nachahmung finde.
Gießen. Eugen Lerch.
Hermann Wetzel, Elementartheorie der Musik. Einführung in die
Theorie der Melodik, Harmonik, Rhythmik und der musikalischen Formen-
und Vortragslehre. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1911. 211 S. Großoktav.
Dieses Buch ist eine der seltenen Arbeiten, die nicht das Resultat mehr oder
weniger geschickten Kompilierens, sondern selbständigen Nachdenkens sind. Somit
sind die Worte des Verfassers aus der Vorrede: »es versucht, alle die bekannten
und noch unbekannten Elementarfragen von Grund aus systematisch und organisch
zu entwickeln«; keine Floskel, sondern er hat wirklich versucht, sich mit den ver-
schiedenen Teilmaterien klar auseinanderzusetzen.
Das Buch handelt in seinem ersten Teil von der räumlichen Ordnung der Töne,
welche die Lehre vom Ton, den Tonreihen, den Zusammenklängen und dem Ton-
geschlechte enthält. Hervorzuheben ist die Entwicklung des siebenstufigen Ton-
kreises aus dem pentatonischen System, womit die Verbindung zwischen Theorie
und Geschichte hergestellt ist (Riemann, Handbuch der Musikgeschichte 1,1 S. 45 ff.).
Als besonders wertvoll ist ferner in diesem Abschnitt die Entwicklung des chroma-
tischen Tonkreises, sowie das über Alterierung und über die Orthographie der
Chromatik Gesagte zu bezeichnen. Der Referent gesteht, noch nie eine so klare
Darstellung hierüber gelesen zu haben, wie sie Wetzel S. 34 ff. gibt. Aus der In-
tervallenlehre, die besonders originell ist, sei die Kritik der Intervallbezeichnung S. 46
sowie die Gruppierung des diatonischen Tonkreises um Tritonus, Halbton und
Großterz (S. 50 f.) besonders hervorgehoben. Auch Definition und Einteilung der
Septimenakkorde (S. 53) sind treffend und klar. Etwas zu kurz ist meines Erachtens
der Abschnitt über Konsonanz oder Dissonanz ausgefallen. Hier wäre von der
historischen Wandlung dieser Begriffe zu sprechen gewesen (Riemann, Geschichte
der Musiktheorie, S. 111—140). Aus dem Abschnitte über das Tongeschlecht ist
besonders die Erklärung der Molltonart, sowie die Ableitung der sog. »harmoni-
schen« Molltonleiter aus verwandten pentatonischen Tonkreisen zu erwähnen. Die
Darstellung der Kirchentonarten ist gar zu kursorisch ausgefallen, wenigstens vom
pädagogischen Standpunkte aus. Der zweite Teil des Buches handelt von der zeit-
lichen Ordnung der Töne, welche die Lehre vom Rhythmus und Metrum, Motiv
und Takt umfaßt. Die elementare Metrik (Lehre von den Motivtypen) führt die
dreizeitigen Typen ein, die mit Recht mit den zweizeitigen auf einen rhythmischen
Urtypus zurückgeführt werden.
Großes Lob ist dem Kapitel: »Der Takt und sein Verhältnis zum Motive« zu
spenden, das mit ebensoviel Klarheit wie Kürze alle jene Gedanken- und Ver-
ständnislosigkeiten wegräumt, die nur der Pädagoge in ihrer vollen Schwere kennt.
Ebenso wichtig ist das Kapitel: »Unechte Takte« (S. 96 ff.), wo als eklatantes Bei-
spiel etwa noch der erste Satz der Esdur-Sinfonie von Schumann zu nennen wäre.
Der dritte Teil des Buches bringt die Grundzüge der musikalischen Formenlehre
als »räumlich-zeitliche Ordnung der Töne«. Nicht ganz einverstanden bin ich mit
der Definition der »Phrase« (S. 132) und deren Trennung von der Motivgruppe:
Noch etwas möchte ich zur Verteidigung des Gassenhauers sagen: selbst wenn
die Melodie leidlich ist, wird sie durch das Übermaß der Wiederholungen uner-
träglich. Ein großer Teil des ästhetischen Reizes liegt im Reiz der Neuheit —
würden wir nicht auch protestieren, wenn derselbe (an sich vielleicht ganz gute)
Witz uns zehnmal erzählt würde?
Wir wünschen dem Büchlein Penkerts gewiß, daß es seinen guten Zweck er-
fülle, hoffen aber, daß die Methode keine Nachahmung finde.
Gießen. Eugen Lerch.
Hermann Wetzel, Elementartheorie der Musik. Einführung in die
Theorie der Melodik, Harmonik, Rhythmik und der musikalischen Formen-
und Vortragslehre. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1911. 211 S. Großoktav.
Dieses Buch ist eine der seltenen Arbeiten, die nicht das Resultat mehr oder
weniger geschickten Kompilierens, sondern selbständigen Nachdenkens sind. Somit
sind die Worte des Verfassers aus der Vorrede: »es versucht, alle die bekannten
und noch unbekannten Elementarfragen von Grund aus systematisch und organisch
zu entwickeln«; keine Floskel, sondern er hat wirklich versucht, sich mit den ver-
schiedenen Teilmaterien klar auseinanderzusetzen.
Das Buch handelt in seinem ersten Teil von der räumlichen Ordnung der Töne,
welche die Lehre vom Ton, den Tonreihen, den Zusammenklängen und dem Ton-
geschlechte enthält. Hervorzuheben ist die Entwicklung des siebenstufigen Ton-
kreises aus dem pentatonischen System, womit die Verbindung zwischen Theorie
und Geschichte hergestellt ist (Riemann, Handbuch der Musikgeschichte 1,1 S. 45 ff.).
Als besonders wertvoll ist ferner in diesem Abschnitt die Entwicklung des chroma-
tischen Tonkreises, sowie das über Alterierung und über die Orthographie der
Chromatik Gesagte zu bezeichnen. Der Referent gesteht, noch nie eine so klare
Darstellung hierüber gelesen zu haben, wie sie Wetzel S. 34 ff. gibt. Aus der In-
tervallenlehre, die besonders originell ist, sei die Kritik der Intervallbezeichnung S. 46
sowie die Gruppierung des diatonischen Tonkreises um Tritonus, Halbton und
Großterz (S. 50 f.) besonders hervorgehoben. Auch Definition und Einteilung der
Septimenakkorde (S. 53) sind treffend und klar. Etwas zu kurz ist meines Erachtens
der Abschnitt über Konsonanz oder Dissonanz ausgefallen. Hier wäre von der
historischen Wandlung dieser Begriffe zu sprechen gewesen (Riemann, Geschichte
der Musiktheorie, S. 111—140). Aus dem Abschnitte über das Tongeschlecht ist
besonders die Erklärung der Molltonart, sowie die Ableitung der sog. »harmoni-
schen« Molltonleiter aus verwandten pentatonischen Tonkreisen zu erwähnen. Die
Darstellung der Kirchentonarten ist gar zu kursorisch ausgefallen, wenigstens vom
pädagogischen Standpunkte aus. Der zweite Teil des Buches handelt von der zeit-
lichen Ordnung der Töne, welche die Lehre vom Rhythmus und Metrum, Motiv
und Takt umfaßt. Die elementare Metrik (Lehre von den Motivtypen) führt die
dreizeitigen Typen ein, die mit Recht mit den zweizeitigen auf einen rhythmischen
Urtypus zurückgeführt werden.
Großes Lob ist dem Kapitel: »Der Takt und sein Verhältnis zum Motive« zu
spenden, das mit ebensoviel Klarheit wie Kürze alle jene Gedanken- und Ver-
ständnislosigkeiten wegräumt, die nur der Pädagoge in ihrer vollen Schwere kennt.
Ebenso wichtig ist das Kapitel: »Unechte Takte« (S. 96 ff.), wo als eklatantes Bei-
spiel etwa noch der erste Satz der Esdur-Sinfonie von Schumann zu nennen wäre.
Der dritte Teil des Buches bringt die Grundzüge der musikalischen Formenlehre
als »räumlich-zeitliche Ordnung der Töne«. Nicht ganz einverstanden bin ich mit
der Definition der »Phrase« (S. 132) und deren Trennung von der Motivgruppe: