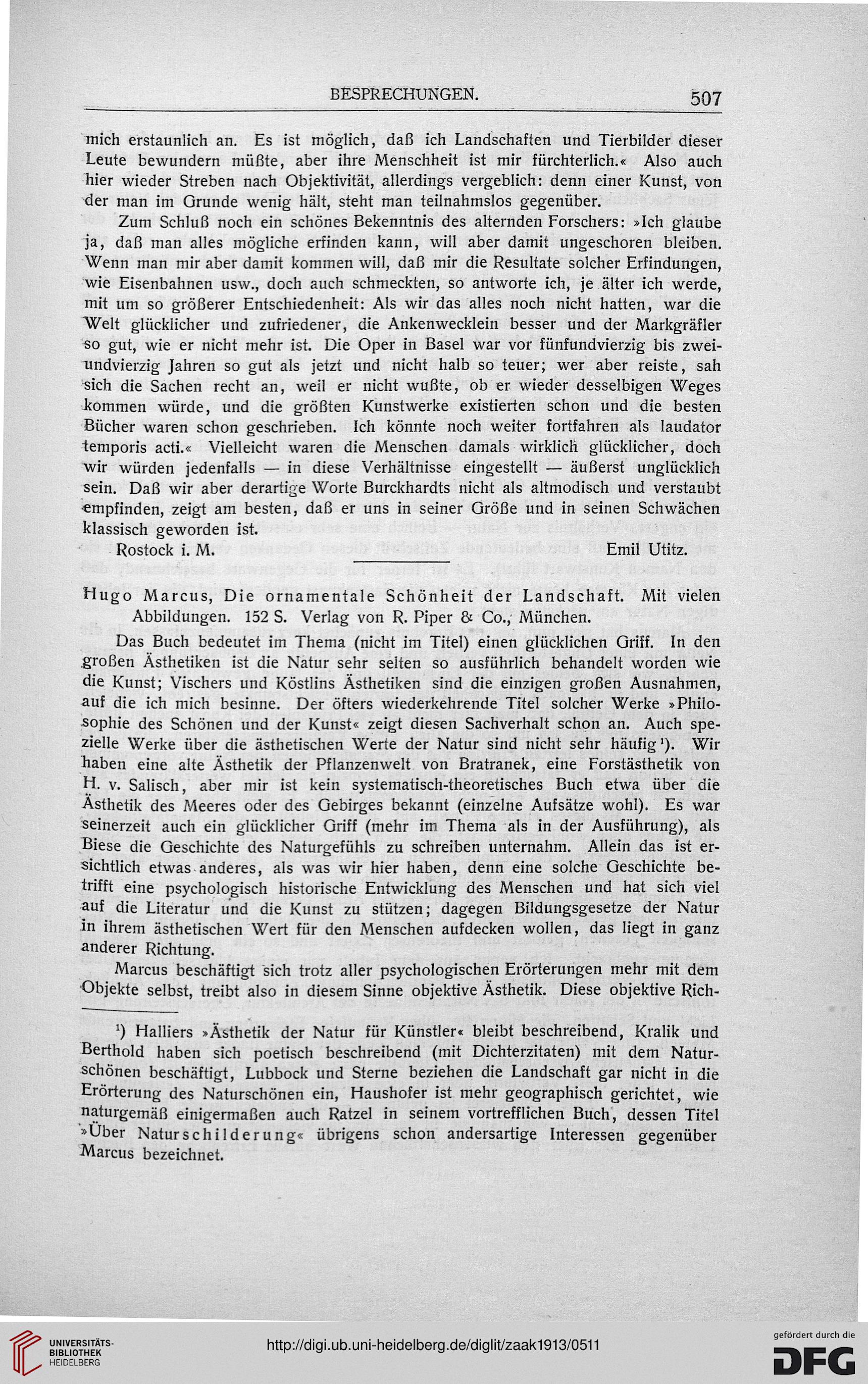BESPRECHUNGEN.
507
mich erstaunlich an. Es ist möglich, daß ich Landschaften und Tierbilder dieser
Leute bewundern müßte, aber ihre Menschheit ist mir fürchterlich.« Also auch
hier wieder Streben nach Objektivität, allerdings vergeblich: denn einer Kunst, von
der man im Grunde wenig hält, steht man teilnahmslos gegenüber.
Zum Schluß noch ein schönes Bekenntnis des alternden Forschers: »Ich glaube
ja, daß man alles mögliche erfinden kann, will aber damit ungeschoren bleiben.
Wenn man mir aber damit kommen will, daß mir die Resultate solcher Erfindungen,
wie Eisenbahnen usw., doch auch schmeckten, so antworte ich, je älter ich werde,
mit um so größerer Entschiedenheit: Als wir das alles noch nicht hatten, war die
Welt glücklicher und zufriedener, die Ankenwecklein besser und der Markgräfler
so gut, wie er nicht mehr ist. Die Oper in Basel war vor fünfundvierzig bis zwei-
undvierzig Jahren so gut als jetzt und nicht halb so teuer; wer aber reiste, sah
sich die Sachen recht an, weil er nicht wußte, ob er wieder desselbigen Weges
kommen würde, und die größten Kunstwerke existierten schon und die besten
Bücher waren schon geschrieben. Ich könnte noch weiter fortfahren als Iaudator
temporis acti.« Vielleicht waren die Menschen damals wirklich glücklicher, doch
wir würden jedenfalls — in diese Verhältnisse eingestellt — äußerst unglücklich
sein. Daß wir aber derartige Worte Burckhardts nicht als altmodisch und verstaubt
empfinden, zeigt am besten, daß er uns in seiner Größe und in seinen Schwächen
klassisch geworden ist.
Rostock i. M. Emil Utitz.
Hugo Marcus, Die ornamentale Schönheit der Landschaft. Mit vielen
Abbildungen. 152 S. Verlag von R. Piper & Co., München.
Das Buch bedeutet im Thema (nicht im Titel) einen glücklichen Griff. In den
großen Ästhetiken ist die Natur sehr selten so ausführlich behandelt worden wie
die Kunst; Vischers und Köstlins Ästhetiken sind die einzigen großen Ausnahmen,
auf die ich mich besinne. Der öfters wiederkehrende Titel solcher Werke »Philo-
sophie des Schönen und der Kunst« zeigt diesen Sachverhalt schon an. Auch spe-
zielle Werke über die ästhetischen Werte der Natur sind nicht sehr häufig'). Wir
haben eine alte Ästhetik der Pflanzenwelt von Bratranek, eine Forstästhetik von
H. v. Salisch, aber mir ist kein systematisch-theoretisches Buch etwa über die
Ästhetik des Meeres oder des Gebirges bekannt (einzelne Aufsätze wohl). Es war
seinerzeit auch ein glücklicher Griff (mehr im Thema als in der Ausführung), als
Biese die Geschichte des Naturgefühls zu schreiben unternahm. Allein das ist er-
sichtlich etwas anderes, als was wir hier haben, denn eine solche Geschichte be-
trifft eine psychologisch historische Entwicklung des Menschen und hat sich viel
auf die Literatur und die Kunst zu stützen; dagegen Bildungsgesetze der Natur
in ihrem ästhetischen Wert für den Menschen aufdecken wollen, das liegt in ganz
anderer Richtung.
Marcus beschäftigt sich trotz aller psychologischen Erörterungen mehr mit dem
Objekte selbst, treibt also in diesem Sinne objektive Ästhetik. Diese objektive Rich-
l) Halliers »Ästhetik der Natur für Künstler« bleibt beschreibend, Kralik und
Berthold haben sich poetisch beschreibend (mit Dichterzitaten) mit dem Natur-
schönen beschäftigt, Lubbock und Sterne beziehen die Landschaft gar nicht in die
Erörterung des Naturschönen ein, Haushofer ist mehr geographisch gerichtet, wie
naturgemäß einigermaßen auch Ratzel in seinem vortrefflichen Buch, dessen Titel
»Über Naturschilderung« übrigens schon andersartige Interessen gegenüber
Marcus bezeichnet.
507
mich erstaunlich an. Es ist möglich, daß ich Landschaften und Tierbilder dieser
Leute bewundern müßte, aber ihre Menschheit ist mir fürchterlich.« Also auch
hier wieder Streben nach Objektivität, allerdings vergeblich: denn einer Kunst, von
der man im Grunde wenig hält, steht man teilnahmslos gegenüber.
Zum Schluß noch ein schönes Bekenntnis des alternden Forschers: »Ich glaube
ja, daß man alles mögliche erfinden kann, will aber damit ungeschoren bleiben.
Wenn man mir aber damit kommen will, daß mir die Resultate solcher Erfindungen,
wie Eisenbahnen usw., doch auch schmeckten, so antworte ich, je älter ich werde,
mit um so größerer Entschiedenheit: Als wir das alles noch nicht hatten, war die
Welt glücklicher und zufriedener, die Ankenwecklein besser und der Markgräfler
so gut, wie er nicht mehr ist. Die Oper in Basel war vor fünfundvierzig bis zwei-
undvierzig Jahren so gut als jetzt und nicht halb so teuer; wer aber reiste, sah
sich die Sachen recht an, weil er nicht wußte, ob er wieder desselbigen Weges
kommen würde, und die größten Kunstwerke existierten schon und die besten
Bücher waren schon geschrieben. Ich könnte noch weiter fortfahren als Iaudator
temporis acti.« Vielleicht waren die Menschen damals wirklich glücklicher, doch
wir würden jedenfalls — in diese Verhältnisse eingestellt — äußerst unglücklich
sein. Daß wir aber derartige Worte Burckhardts nicht als altmodisch und verstaubt
empfinden, zeigt am besten, daß er uns in seiner Größe und in seinen Schwächen
klassisch geworden ist.
Rostock i. M. Emil Utitz.
Hugo Marcus, Die ornamentale Schönheit der Landschaft. Mit vielen
Abbildungen. 152 S. Verlag von R. Piper & Co., München.
Das Buch bedeutet im Thema (nicht im Titel) einen glücklichen Griff. In den
großen Ästhetiken ist die Natur sehr selten so ausführlich behandelt worden wie
die Kunst; Vischers und Köstlins Ästhetiken sind die einzigen großen Ausnahmen,
auf die ich mich besinne. Der öfters wiederkehrende Titel solcher Werke »Philo-
sophie des Schönen und der Kunst« zeigt diesen Sachverhalt schon an. Auch spe-
zielle Werke über die ästhetischen Werte der Natur sind nicht sehr häufig'). Wir
haben eine alte Ästhetik der Pflanzenwelt von Bratranek, eine Forstästhetik von
H. v. Salisch, aber mir ist kein systematisch-theoretisches Buch etwa über die
Ästhetik des Meeres oder des Gebirges bekannt (einzelne Aufsätze wohl). Es war
seinerzeit auch ein glücklicher Griff (mehr im Thema als in der Ausführung), als
Biese die Geschichte des Naturgefühls zu schreiben unternahm. Allein das ist er-
sichtlich etwas anderes, als was wir hier haben, denn eine solche Geschichte be-
trifft eine psychologisch historische Entwicklung des Menschen und hat sich viel
auf die Literatur und die Kunst zu stützen; dagegen Bildungsgesetze der Natur
in ihrem ästhetischen Wert für den Menschen aufdecken wollen, das liegt in ganz
anderer Richtung.
Marcus beschäftigt sich trotz aller psychologischen Erörterungen mehr mit dem
Objekte selbst, treibt also in diesem Sinne objektive Ästhetik. Diese objektive Rich-
l) Halliers »Ästhetik der Natur für Künstler« bleibt beschreibend, Kralik und
Berthold haben sich poetisch beschreibend (mit Dichterzitaten) mit dem Natur-
schönen beschäftigt, Lubbock und Sterne beziehen die Landschaft gar nicht in die
Erörterung des Naturschönen ein, Haushofer ist mehr geographisch gerichtet, wie
naturgemäß einigermaßen auch Ratzel in seinem vortrefflichen Buch, dessen Titel
»Über Naturschilderung« übrigens schon andersartige Interessen gegenüber
Marcus bezeichnet.