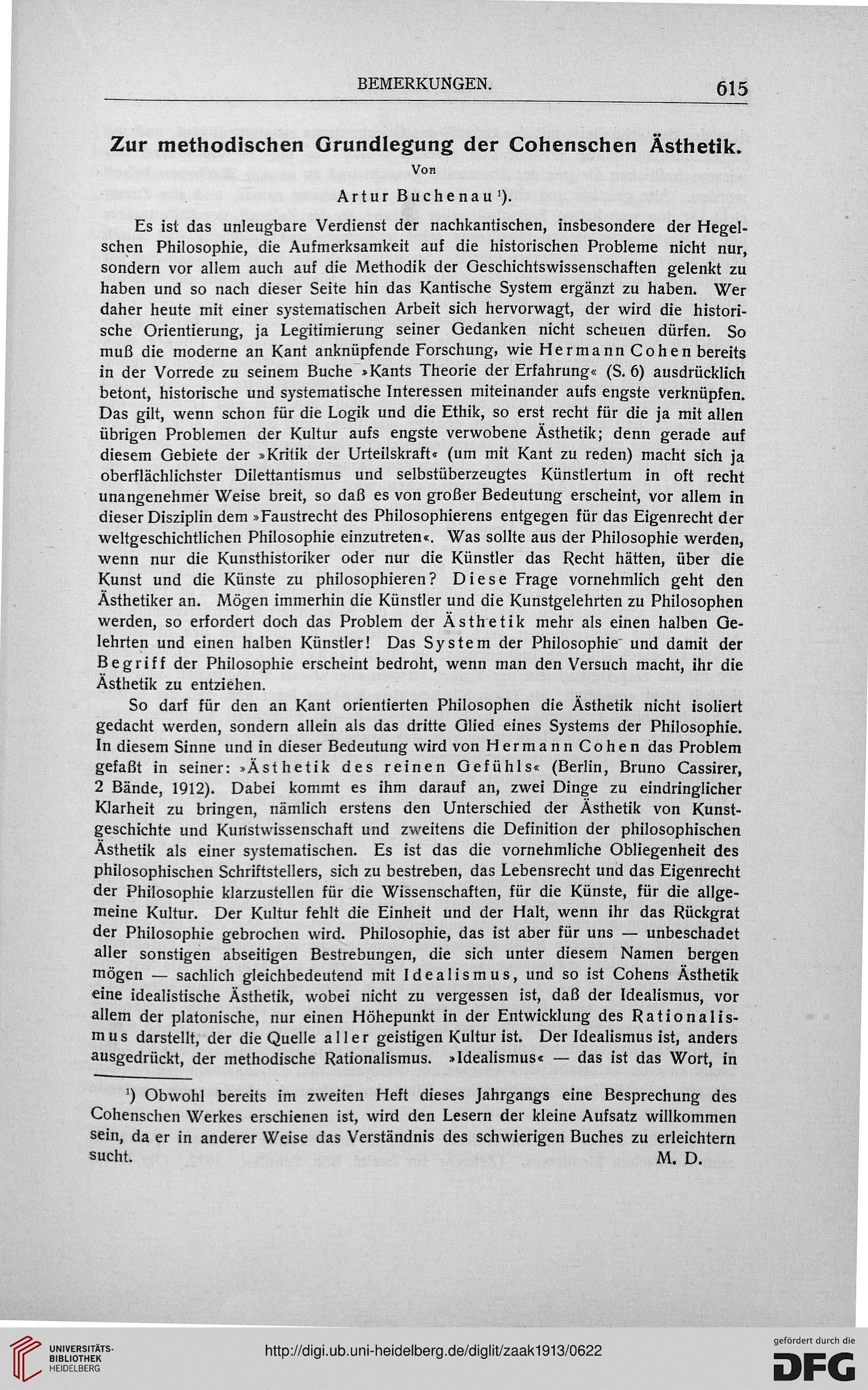BEMERKUNGEN. gl 5
Zur methodischen Grundlegung der Cohenschen Ästhetik.
Von
Artur Buche nau1).
Es ist das unleugbare Verdienst der nachkantischen, insbesondere der Hegel-
schen Philosophie, die Aufmerksamkeit auf die historischen Probleme nicht nur,
sondern vor allem auch auf die Methodik der Geschichtswissenschaften gelenkt zu
haben und so nach dieser Seite hin das Kantische System ergänzt zu haben. Wer
daher heute mit einer systematischen Arbeit sich hervorwagt, der wird die histori-
sche Orientierung, ja Legitimierung seiner Gedanken nicht scheuen dürfen. So
muß die moderne an Kant anknüpfende Forschung, wie Hermann Cohen bereits
in der Vorrede zu seinem Buche »Kants Theorie der Erfahrung« (S. 6) ausdrücklich
betont, historische und systematische Interessen miteinander aufs engste verknüpfen.
Das gilt, wenn schon für die Logik und die Ethik, so erst recht für die ja mit allen
übrigen Problemen der Kultur aufs engste verwobene Ästhetik; denn gerade auf
diesem Gebiete der »Kritik der Urteilskraft« (um mit Kant zu reden) macht sich ja
oberflächlichster Dilettantismus und selbstüberzeugtes Künstlertum in oft recht
unangenehmer Weise breit, so daß es von großer Bedeutung erscheint, vor allem in
dieser Disziplin dem »Faustrecht des Philosophierens entgegen für das Eigenrecht der
weltgeschichtlichen Philosophie einzutreten«. Was sollte aus der Philosophie werden,
wenn nur die Kunsthistoriker oder nur die Künstler das Recht hätten, über die
Kunst und die Künste zu philosophieren? Diese Frage vornehmlich geht den
Ästhetiker an. Mögen immerhin die Künstler und die Kunstgelehrten zu Philosophen
werden, so erfordert doch das Problem der Ästhetik mehr als einen halben Ge-
lehrten und einen halben Künstler! Das System der Philosophie und damit der
Begriff der Philosophie erscheint bedroht, wenn man den Versuch macht, ihr die
Ästhetik zu entziehen.
So darf für den an Kant orientierten Philosophen die Ästhetik nicht isoliert
gedacht werden, sondern allein als das dritte Glied eines Systems der Philosophie.
In diesem Sinne und in dieser Bedeutung wird von Hermann Cohen das Problem
gefaßt in seiner: »Ästhetik des reinen Gefühls« (Berlin, Bruno Cassirer,
2 Bände, 1912). Dabei kommt es ihm darauf an, zwei Dinge zu eindringlicher
Klarheit zu bringen, nämlich erstens den Unterschied der Ästhetik von Kunst-
geschichte und Kunstwissenschaft und zweitens die Definition der philosophischen
Ästhetik als einer systematischen. Es ist das die vornehmliche Obliegenheit des
philosophischen Schriftstellers, sich zu bestreben, das Lebensrecht und das Eigenrecht
der Philosophie klarzustellen für die Wissenschaften, für die Künste, für die allge-
meine Kultur. Der Kultur fehlt die Einheit und der Halt, wenn ihr das Rückgrat
der Philosophie gebrochen wird. Philosophie, das ist aber für uns — unbeschadet
aller sonstigen abseitigen Bestrebungen, die sich unter diesem Namen bergen
mögen — sachlich gleichbedeutend mit Idealismus, und so ist Cohens Ästhetik
eine idealistische Ästhetik, wobei nicht zu vergessen ist, daß der Idealismus, vor
allem der platonische, nur einen Höhepunkt in der Entwicklung des Rationalis-
mus darstellt, der die Quelle aller geistigen Kultur ist. Der Idealismus ist, anders
ausgedrückt, der methodische Rationalismus. »Idealismus« — das ist das Wort, in
') Obwohl bereits im zweiten Heft dieses Jahrgangs eine Besprechung des
Cohenschen Werkes erschienen ist, wird den Lesern der kleine Aufsatz willkommen
sein, da er in anderer Weise das Verständnis des schwierigen Buches zu erleichtern
sucht. M. D.
Zur methodischen Grundlegung der Cohenschen Ästhetik.
Von
Artur Buche nau1).
Es ist das unleugbare Verdienst der nachkantischen, insbesondere der Hegel-
schen Philosophie, die Aufmerksamkeit auf die historischen Probleme nicht nur,
sondern vor allem auch auf die Methodik der Geschichtswissenschaften gelenkt zu
haben und so nach dieser Seite hin das Kantische System ergänzt zu haben. Wer
daher heute mit einer systematischen Arbeit sich hervorwagt, der wird die histori-
sche Orientierung, ja Legitimierung seiner Gedanken nicht scheuen dürfen. So
muß die moderne an Kant anknüpfende Forschung, wie Hermann Cohen bereits
in der Vorrede zu seinem Buche »Kants Theorie der Erfahrung« (S. 6) ausdrücklich
betont, historische und systematische Interessen miteinander aufs engste verknüpfen.
Das gilt, wenn schon für die Logik und die Ethik, so erst recht für die ja mit allen
übrigen Problemen der Kultur aufs engste verwobene Ästhetik; denn gerade auf
diesem Gebiete der »Kritik der Urteilskraft« (um mit Kant zu reden) macht sich ja
oberflächlichster Dilettantismus und selbstüberzeugtes Künstlertum in oft recht
unangenehmer Weise breit, so daß es von großer Bedeutung erscheint, vor allem in
dieser Disziplin dem »Faustrecht des Philosophierens entgegen für das Eigenrecht der
weltgeschichtlichen Philosophie einzutreten«. Was sollte aus der Philosophie werden,
wenn nur die Kunsthistoriker oder nur die Künstler das Recht hätten, über die
Kunst und die Künste zu philosophieren? Diese Frage vornehmlich geht den
Ästhetiker an. Mögen immerhin die Künstler und die Kunstgelehrten zu Philosophen
werden, so erfordert doch das Problem der Ästhetik mehr als einen halben Ge-
lehrten und einen halben Künstler! Das System der Philosophie und damit der
Begriff der Philosophie erscheint bedroht, wenn man den Versuch macht, ihr die
Ästhetik zu entziehen.
So darf für den an Kant orientierten Philosophen die Ästhetik nicht isoliert
gedacht werden, sondern allein als das dritte Glied eines Systems der Philosophie.
In diesem Sinne und in dieser Bedeutung wird von Hermann Cohen das Problem
gefaßt in seiner: »Ästhetik des reinen Gefühls« (Berlin, Bruno Cassirer,
2 Bände, 1912). Dabei kommt es ihm darauf an, zwei Dinge zu eindringlicher
Klarheit zu bringen, nämlich erstens den Unterschied der Ästhetik von Kunst-
geschichte und Kunstwissenschaft und zweitens die Definition der philosophischen
Ästhetik als einer systematischen. Es ist das die vornehmliche Obliegenheit des
philosophischen Schriftstellers, sich zu bestreben, das Lebensrecht und das Eigenrecht
der Philosophie klarzustellen für die Wissenschaften, für die Künste, für die allge-
meine Kultur. Der Kultur fehlt die Einheit und der Halt, wenn ihr das Rückgrat
der Philosophie gebrochen wird. Philosophie, das ist aber für uns — unbeschadet
aller sonstigen abseitigen Bestrebungen, die sich unter diesem Namen bergen
mögen — sachlich gleichbedeutend mit Idealismus, und so ist Cohens Ästhetik
eine idealistische Ästhetik, wobei nicht zu vergessen ist, daß der Idealismus, vor
allem der platonische, nur einen Höhepunkt in der Entwicklung des Rationalis-
mus darstellt, der die Quelle aller geistigen Kultur ist. Der Idealismus ist, anders
ausgedrückt, der methodische Rationalismus. »Idealismus« — das ist das Wort, in
') Obwohl bereits im zweiten Heft dieses Jahrgangs eine Besprechung des
Cohenschen Werkes erschienen ist, wird den Lesern der kleine Aufsatz willkommen
sein, da er in anderer Weise das Verständnis des schwierigen Buches zu erleichtern
sucht. M. D.