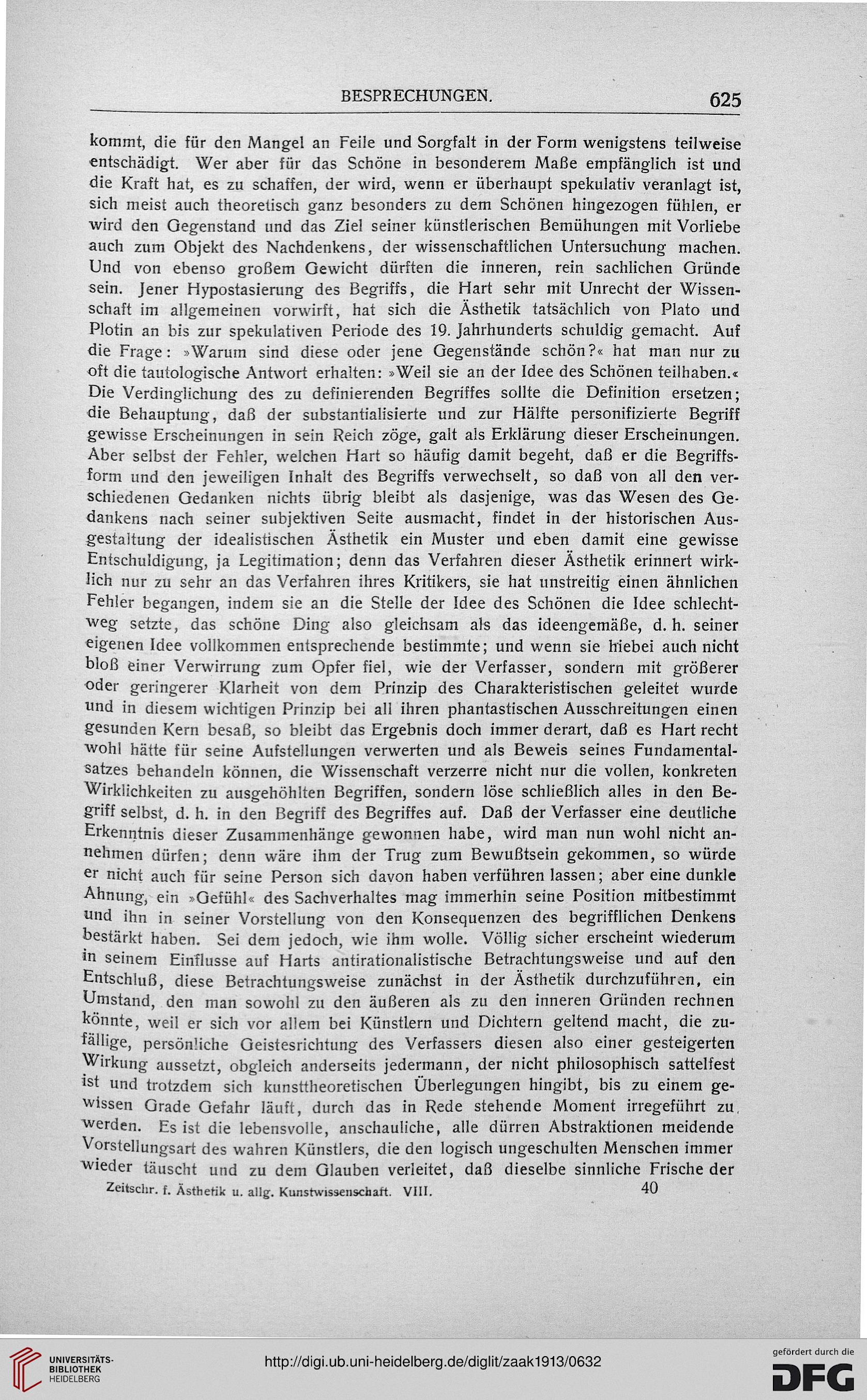BESPRECHUNGEN. 525
kommt, die für den Mangel an Feile und Sorgfalt in der Form wenigstens teilweise
entschädigt. Wer aber für das Schöne in besonderem Maße empfänglich ist und
die Kraft hat, es zu schaffen, der wird, wenn er überhaupt spekulativ veranlagt ist,
sich meist auch theoretisch ganz besonders zu dem Schönen hingezogen fühlen, er
wird den Gegenstand und das Ziel seiner künstlerischen Bemühungen mit Vorliebe
auch zum Objekt des Nachdenkens, der wissenschaftlichen Untersuchung machen.
Und von ebenso großem Gewicht dürften die inneren, rein sachlichen Gründe
sein. Jener Hypostasierung des Begriffs, die Hart sehr mit Unrecht der Wissen-
schaft im allgemeinen vorwirft, hat sich die Ästhetik tatsächlich von Plato und
Plotin an bis zur spekulativen Periode des 19. Jahrhunderts schuldig gemacht. Auf
die Frage: »Warum sind diese oder jene Gegenstände schön?« hat man nur zu
oft die tautologische Antwort erhalten: »Weil sie an der Idee des Schönen teilhaben.«
Die Verdinglichung des zu definierenden Begriffes sollte die Definition ersetzen;
die Behauptung, daß der substantialisierte und zur Hälfte personifizierte Begriff
gewisse Erscheinungen in sein Reich zöge, galt als Erklärung dieser Erscheinungen.
Aber selbst der Fehler, welchen Hart so häufig damit begeht, daß er die Begriffs-
form und den jeweiligen Inhalt des Begriffs verwechselt, so daß von all den ver-
schiedenen Gedanken nichts übrig bleibt als dasjenige, was das Wesen des Ge-
dankens nach seiner subjektiven Seite ausmacht, findet in der historischen Aus-
gestaltung der idealistischen Ästhetik ein Muster und eben damit eine gewisse
Entschuldigung, ja Legitimation; denn das Verfahren dieser Ästhetik erinnert wirk-
lich nur zu sehr an das Verfahren ihres Kritikers, sie hat unstreitig einen ähnlichen
Fehler begangen, indem sie an die Stelle der Idee des Schönen die Idee schlecht-
weg setzte, das schöne Ding also gleichsam als das ideengemäße, d.h. seiner
eigenen Idee vollkommen entsprechende bestimmte; und wenn sie hiebei auch nicht
bloß einer Verwirrung zum Opfer fiel, wie der Verfasser, sondern mit größerer
oder geringerer Klarheit von dem Prinzip des Charakteristischen geleitet wurde
und in diesem wichtigen Prinzip bei all ihren phantastischen Ausschreitungen einen
gesunden Kern besaß, so bleibt das Ergebnis doch immer derart, daß es Hart recht
■wohl hätte für seine Aufstellungen verwerten und als Beweis seines Fundamental-
satzes behandeln können, die Wissenschaft verzerre nicht nur die vollen, konkreten
Wirklichkeiten zu ausgehöhlten Begriffen, sondern löse schließlich alles in den Be-
griff selbst, d. h. in den Begriff des Begriffes auf. Daß der Verfasser eine deutliche
Erkenntnis dieser Zusammenhänge gewonnen habe, wird man nun wohl nicht an-
nehmen dürfen; denn wäre ihm der Trug zum Bewußtsein gekommen, so würde
er nicht auch für seine Person sich davon haben verführen lassen; aber eine dunkle
Ahnung, ein »Gefühl« des Sachverhaltes mag immerhin seine Position mitbestimmt
und ihn in seiner Vorstellung von den Konsequenzen des begrifflichen Denkens
bestärkt haben. Sei dem jedoch, wie ihm wolle. Völlig sicher erscheint wiederum
•n seinem Einflüsse auf Harts antirationalistische Betrachtungsweise und auf den
Entschluß, diese Betrachtungsweise zunächst in der Ästhetik durchzuführen, ein
Umstand, den man sowohl zu den äußeren als zu den inneren Gründen rechnen
könnte, weil er sich vor allem bei Künstlern und Dichtern geltend macht, die zu-
fällige, persönliche Geistesrichtung des Verfassers diesen also einer gesteigerten
Wirkung aussetzt, obgleich anderseits jedermann, der nicht philosophisch sattelfest
ist und trotzdem sich kunsttheoretischen Überlegungen hingibt, bis zu einem ge-
wissen Grade Gefahr läuft, durch das in Rede stehende Moment irregeführt zu
werden. Es ist die lebensvolle, anschauliche, alle dürren Abstraktionen meidende
Vorstellungsart des wahren Künstlers, die den logisch ungeschulten Menschen immer
wieder täuscht und zu dem Glauben verleitet, daß dieselbe sinnliche Frische der
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. VIII. 40
kommt, die für den Mangel an Feile und Sorgfalt in der Form wenigstens teilweise
entschädigt. Wer aber für das Schöne in besonderem Maße empfänglich ist und
die Kraft hat, es zu schaffen, der wird, wenn er überhaupt spekulativ veranlagt ist,
sich meist auch theoretisch ganz besonders zu dem Schönen hingezogen fühlen, er
wird den Gegenstand und das Ziel seiner künstlerischen Bemühungen mit Vorliebe
auch zum Objekt des Nachdenkens, der wissenschaftlichen Untersuchung machen.
Und von ebenso großem Gewicht dürften die inneren, rein sachlichen Gründe
sein. Jener Hypostasierung des Begriffs, die Hart sehr mit Unrecht der Wissen-
schaft im allgemeinen vorwirft, hat sich die Ästhetik tatsächlich von Plato und
Plotin an bis zur spekulativen Periode des 19. Jahrhunderts schuldig gemacht. Auf
die Frage: »Warum sind diese oder jene Gegenstände schön?« hat man nur zu
oft die tautologische Antwort erhalten: »Weil sie an der Idee des Schönen teilhaben.«
Die Verdinglichung des zu definierenden Begriffes sollte die Definition ersetzen;
die Behauptung, daß der substantialisierte und zur Hälfte personifizierte Begriff
gewisse Erscheinungen in sein Reich zöge, galt als Erklärung dieser Erscheinungen.
Aber selbst der Fehler, welchen Hart so häufig damit begeht, daß er die Begriffs-
form und den jeweiligen Inhalt des Begriffs verwechselt, so daß von all den ver-
schiedenen Gedanken nichts übrig bleibt als dasjenige, was das Wesen des Ge-
dankens nach seiner subjektiven Seite ausmacht, findet in der historischen Aus-
gestaltung der idealistischen Ästhetik ein Muster und eben damit eine gewisse
Entschuldigung, ja Legitimation; denn das Verfahren dieser Ästhetik erinnert wirk-
lich nur zu sehr an das Verfahren ihres Kritikers, sie hat unstreitig einen ähnlichen
Fehler begangen, indem sie an die Stelle der Idee des Schönen die Idee schlecht-
weg setzte, das schöne Ding also gleichsam als das ideengemäße, d.h. seiner
eigenen Idee vollkommen entsprechende bestimmte; und wenn sie hiebei auch nicht
bloß einer Verwirrung zum Opfer fiel, wie der Verfasser, sondern mit größerer
oder geringerer Klarheit von dem Prinzip des Charakteristischen geleitet wurde
und in diesem wichtigen Prinzip bei all ihren phantastischen Ausschreitungen einen
gesunden Kern besaß, so bleibt das Ergebnis doch immer derart, daß es Hart recht
■wohl hätte für seine Aufstellungen verwerten und als Beweis seines Fundamental-
satzes behandeln können, die Wissenschaft verzerre nicht nur die vollen, konkreten
Wirklichkeiten zu ausgehöhlten Begriffen, sondern löse schließlich alles in den Be-
griff selbst, d. h. in den Begriff des Begriffes auf. Daß der Verfasser eine deutliche
Erkenntnis dieser Zusammenhänge gewonnen habe, wird man nun wohl nicht an-
nehmen dürfen; denn wäre ihm der Trug zum Bewußtsein gekommen, so würde
er nicht auch für seine Person sich davon haben verführen lassen; aber eine dunkle
Ahnung, ein »Gefühl« des Sachverhaltes mag immerhin seine Position mitbestimmt
und ihn in seiner Vorstellung von den Konsequenzen des begrifflichen Denkens
bestärkt haben. Sei dem jedoch, wie ihm wolle. Völlig sicher erscheint wiederum
•n seinem Einflüsse auf Harts antirationalistische Betrachtungsweise und auf den
Entschluß, diese Betrachtungsweise zunächst in der Ästhetik durchzuführen, ein
Umstand, den man sowohl zu den äußeren als zu den inneren Gründen rechnen
könnte, weil er sich vor allem bei Künstlern und Dichtern geltend macht, die zu-
fällige, persönliche Geistesrichtung des Verfassers diesen also einer gesteigerten
Wirkung aussetzt, obgleich anderseits jedermann, der nicht philosophisch sattelfest
ist und trotzdem sich kunsttheoretischen Überlegungen hingibt, bis zu einem ge-
wissen Grade Gefahr läuft, durch das in Rede stehende Moment irregeführt zu
werden. Es ist die lebensvolle, anschauliche, alle dürren Abstraktionen meidende
Vorstellungsart des wahren Künstlers, die den logisch ungeschulten Menschen immer
wieder täuscht und zu dem Glauben verleitet, daß dieselbe sinnliche Frische der
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. VIII. 40