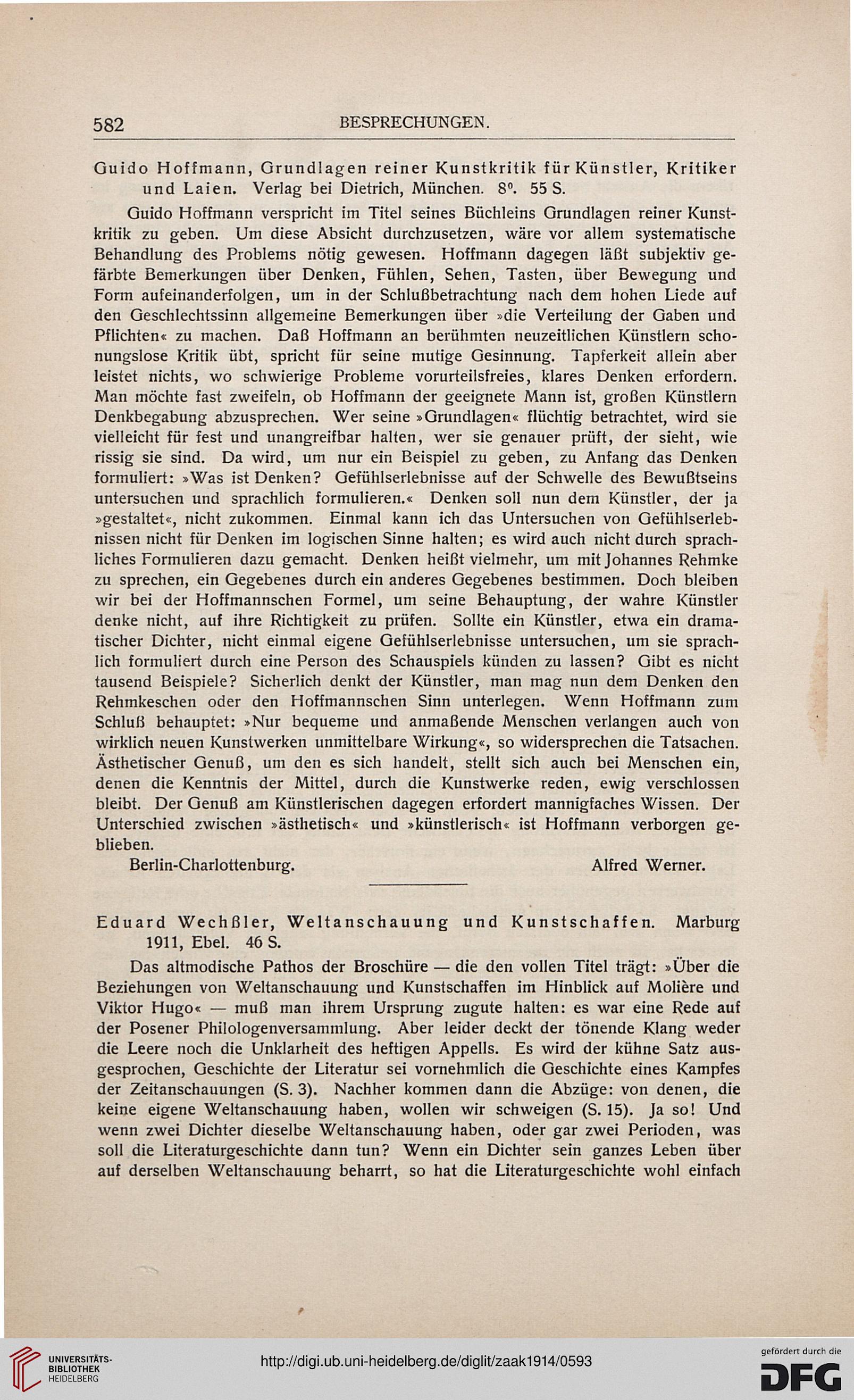582 BESPRECHUNGEN.
Guido Hoffmann, Grundlagen reiner Kunstkritik für Künstler, Kritiker
und Laien. Verlag bei Dietrich, München. 8°. 55 S.
Guido Hoffmann verspricht im Titel seines Büchleins Grundlagen reiner Kunst-
kritik zu geben. Um diese Absicht durchzusetzen, wäre vor allem systematische
Behandlung des Problems nötig gewesen. Hoffmann dagegen läßt subjektiv ge-
färbte Bemerkungen über Denken, Fühlen, Sehen, Tasten, über Bewegung und
Form aufeinanderfolgen, um in der Schlußbetrachtung nach dem hohen Liede auf
den Geschlechtssinn allgemeine Bemerkungen über »die Verteilung der Gaben und
Pflichten« zu machen. Daß Hoffmann an berühmten neuzeitlichen Künstlern scho-
nungslose Kritik übt, spricht für seine mutige Gesinnung. Tapferkeit allein aber
leistet nichts, wo schwierige Probleme vorurteilsfreies, klares Denken erfordern.
Man möchte fast zweifeln, ob Hoffmann der geeignete Mann ist, großen Künstlern
Denkbegabung abzusprechen. Wer seine »Grundlagen« flüchtig betrachtet, wird sie
vielleicht für fest und unangreifbar halten, wer sie genauer prüft, der sieht, wie
rissig sie sind. Da wird, um nur ein Beispiel zu geben, zu Anfang das Denken
formuliert: »Was ist Denken? Gefühlserlebnisse auf der Schwelle des Bewußtseins
untersuchen und sprachlich formulieren.« Denken soll nun dem Künstler, der ja
»gestaltet«, nicht zukommen. Einmal kann ich das Untersuchen von Gefühlserleb-
nissen nicht für Denken im logischen Sinne halten; es wird auch nicht durch sprach-
liches Formulieren dazu gemacht. Denken heißt vielmehr, um mit Johannes Rehmke
zu sprechen, ein Gegebenes durch ein anderes Gegebenes bestimmen. Doch bleiben
wir bei der Hoffmannschen Formel, um seine Behauptung, der wahre Künstler
denke nicht, auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Sollte ein Künstler, etwa ein drama-
tischer Dichter, nicht einmal eigene Gefühlserlebnisse untersuchen, um sie sprach-
lich formuliert durch eine Person des Schauspiels künden zu lassen? Gibt es nicht
tausend Beispiele? Sicherlich denkt der Künstler, man mag nun dem Denken den
Rehmkeschen oder den Hoffmannschen Sinn unterlegen. Wenn Hoffmann zum
Schluß behauptet: »Nur bequeme und anmaßende Menschen verlangen auch von
wirklich neuen Kunstwerken unmittelbare Wirkung«, so widersprechen die Tatsachen.
Ästhetischer Genuß, um den es sich handelt, stellt sich auch bei Menschen ein,
denen die Kenntnis der Mittel, durch die Kunstwerke reden, ewig verschlossen
bleibt. Der Genuß am Künstlerischen dagegen erfordert mannigfaches Wissen. Der
Unterschied zwischen »ästhetisch« und »künstlerisch« ist Hoffmann verborgen ge-
blieben.
Berlin-Charlottenburg. Alfred Werner.
Eduard Wechßler, Weltanschauung und Kunstschaffen. Marburg
1911, Ebel. 46 S.
Das altmodische Pathos der Broschüre — die den vollen Titel trägt: »Über die
Beziehungen von Weltanschauung und Kunstschaffen im Hinblick auf Moliere und
Viktor Hugo« — muß man ihrem Ursprung zugute halten: es war eine Rede auf
der Posener Philologenversammlung. Aber leider deckt der tönende Klang weder
die Leere noch die Unklarheit des heftigen Appells. Es wird der kühne Satz aus-
gesprochen, Geschichte der Literatur sei vornehmlich die Geschichte eines Kampfes
der Zeitanschauungen (S. 3). Nachher kommen dann die Abzüge: von denen, die
keine eigene Weltanschauung haben, wollen wir schweigen (S. 15). Ja so! Und
wenn zwei Dichter dieselbe Weltanschauung haben, oder gar zwei Perioden, was
soll die Literaturgeschichte dann tun? Wenn ein Dichter sein ganzes Leben über
auf derselben Weltanschauung beharrt, so hat die Literaturgeschichte wohl einfach