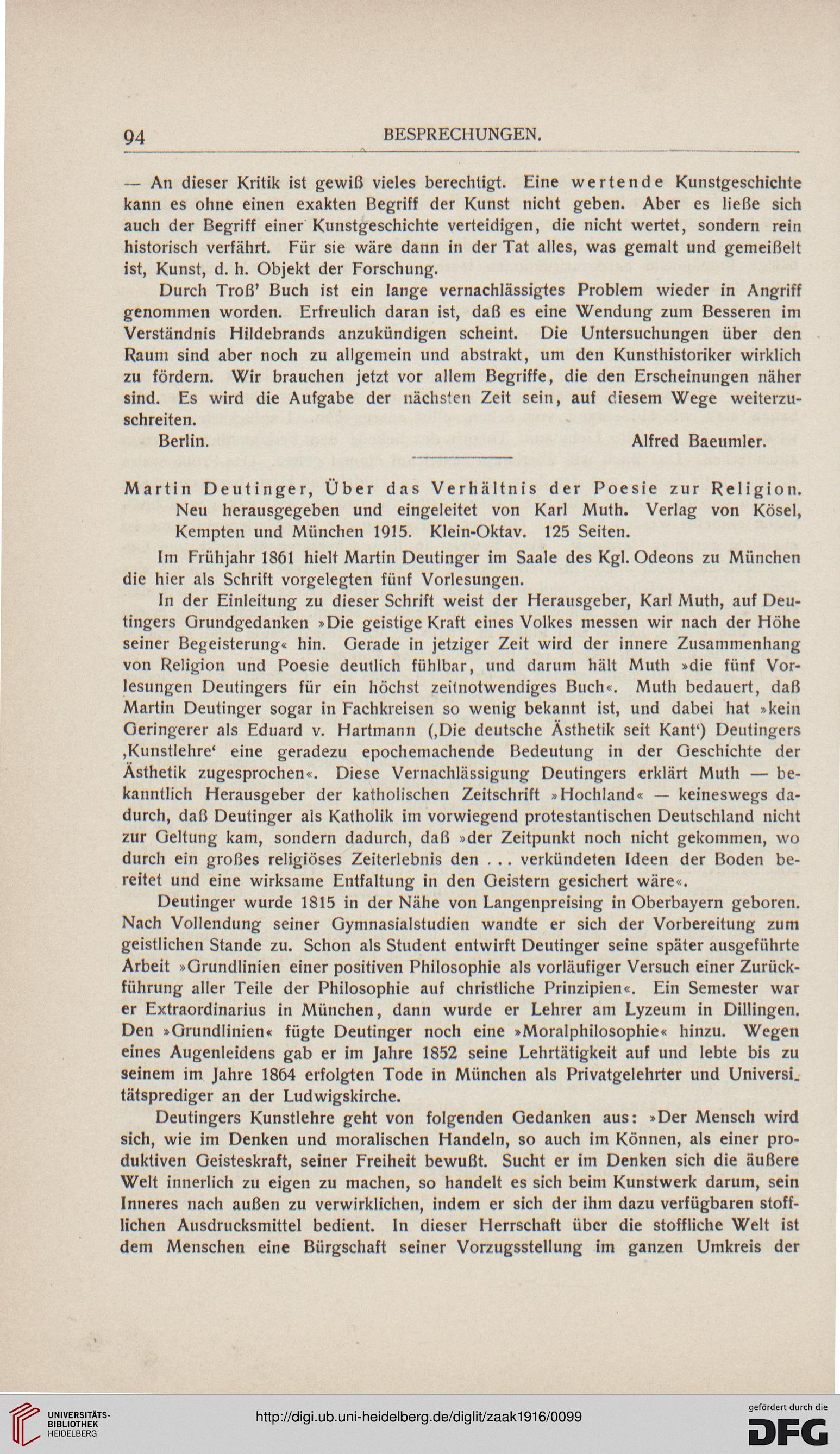94 BESPRECHUNGEN.
— An dieser Kritik ist gewiß vieles berechtigt. Eine wertende Kunstgeschichte
kann es ohne einen exakten Begriff der Kunst nicht geben. Aber es ließe sich
auch der Begriff einer Kunstgeschichte verteidigen, die nicht wertet, sondern rein
historisch verfährt. Für sie wäre dann in der Tat alles, was gemalt und gemeißelt
ist, Kunst, d. h. Objekt der Forschung.
Durch Troß' Buch ist ein lange vernachlässigtes Problem wieder in Angriff
genommen worden. Erfreulich daran ist, daß es eine Wendung zum Besseren im
Verständnis Hildebrands anzukündigen scheint. Die Untersuchungen über den
Raum sind aber noch zu allgemein und abstrakt, um den Kunsthistoriker wirklich
zu fördern. Wir brauchen jetzt vor allem Begriffe, die den Erscheinungen näher
sind. Es wird die Aufgabe der nächsten Zeit sein, auf diesem Wege weiterzu-
schreiten.
Berlin. Alfred Baeumler.
Martin Deutinger, Über das Verhältnis der Poesie zur Religion.
Neu herausgegeben und eingeleitet von Karl Muth. Verlag von Kösel,
Kempten und München 1915. Klein-Oktav. 125 Seiten.
Im Frühjahr 1861 hielt Martin Deutinger im Saale des Kgl. Odeons zu München
die hier als Schrift vorgelegten fünf Vorlesungen.
In der Einleitung zu dieser Schrift weist der Herausgeber, Karl Muth, auf Deu-
tingers Grundgedanken »Die geistige Kraft eines Volkes messen wir nach der Höhe
seiner Begeisterung« hin. Gerade in jetziger Zeit wird der innere Zusammenhang
von Religion und Poesie deutlich fühlbar, und darum hält Muth »die fünf Vor-
lesungen Deutingers für ein höchst zeitnotwendiges Buch«. Muth bedauert, daß
Martin Deutinger sogar in Fachkreisen so wenig bekannt ist, und dabei hat »kein
Geringerer als Eduard v. Hartmann (,Die deutsche Ästhetik seit Kant') Deutingers
,Kunstlehre' eine geradezu epochemachende Bedeutung in der Geschichte der
Ästhetik zugesprochen«. Diese Vernachlässigung Deutingers erklärt Muth — be-
kanntlich Herausgeber der katholischen Zeitschrift »Hochland« — keineswegs da-
durch, daß Deutinger als Katholik im vorwiegend protestantischen Deutschland nicht
zur Geltung kam, sondern dadurch, daß »der Zeitpunkt noch nicht gekommen, wo
durch ein großes religiöses Zeiterlebnis den . .. verkündeten Ideen der Boden be-
reitet und eine wirksame Entfaltung in den Geistern gesichert wäre«.
Deutinger wurde 1815 in der Nähe von Langenpreising in Oberbayern geboren.
Nach Vollendung seiner Gymnasialstudien wandte er sich der Vorbereitung zum
geistlichen Stande zu. Schon als Student entwirft Deutinger seine später ausgeführte
Arbeit »Grundlinien einer positiven Philosophie als vorläufiger Versuch einer Zurück-
führung aller Teile der Philosophie auf christliche Prinzipien«. Ein Semester war
er Extraordinarius in München, dann wurde er Lehrer am Lyzeum in Dillingen.
Den »Grundlinien« fügte Deutinger noch eine »Moralphilosophie« hinzu. Wegen
eines Augenleidens gab er im Jahre 1852 seine Lehrtätigkeit auf und lebte bis zu
seinem im Jahre 1864 erfolgten Tode in München als Privatgelehrter und Universi.
tätsprediger an der Ludwigskirche.
Deutingers Kunstlehre geht von folgenden Gedanken aus: »Der Mensch wird
sich, wie im Denken und moralischen Handeln, so auch im Können, als einer pro-
duktiven Geisteskraft, seiner Freiheit bewußt. Sucht er im Denken sich die äußere
Welt innerlich zu eigen zu machen, so handelt es sich beim Kunstwerk darum, sein
Inneres nach außen zu verwirklichen, indem er sich der ihm dazu verfügbaren stoff-
lichen Ausdrucksmittel bedient. In dieser Herrschaft über die stoffliche Welt ist
dem Menschen eine Bürgschaft seiner Vorzugsstellung im ganzen Umkreis der
— An dieser Kritik ist gewiß vieles berechtigt. Eine wertende Kunstgeschichte
kann es ohne einen exakten Begriff der Kunst nicht geben. Aber es ließe sich
auch der Begriff einer Kunstgeschichte verteidigen, die nicht wertet, sondern rein
historisch verfährt. Für sie wäre dann in der Tat alles, was gemalt und gemeißelt
ist, Kunst, d. h. Objekt der Forschung.
Durch Troß' Buch ist ein lange vernachlässigtes Problem wieder in Angriff
genommen worden. Erfreulich daran ist, daß es eine Wendung zum Besseren im
Verständnis Hildebrands anzukündigen scheint. Die Untersuchungen über den
Raum sind aber noch zu allgemein und abstrakt, um den Kunsthistoriker wirklich
zu fördern. Wir brauchen jetzt vor allem Begriffe, die den Erscheinungen näher
sind. Es wird die Aufgabe der nächsten Zeit sein, auf diesem Wege weiterzu-
schreiten.
Berlin. Alfred Baeumler.
Martin Deutinger, Über das Verhältnis der Poesie zur Religion.
Neu herausgegeben und eingeleitet von Karl Muth. Verlag von Kösel,
Kempten und München 1915. Klein-Oktav. 125 Seiten.
Im Frühjahr 1861 hielt Martin Deutinger im Saale des Kgl. Odeons zu München
die hier als Schrift vorgelegten fünf Vorlesungen.
In der Einleitung zu dieser Schrift weist der Herausgeber, Karl Muth, auf Deu-
tingers Grundgedanken »Die geistige Kraft eines Volkes messen wir nach der Höhe
seiner Begeisterung« hin. Gerade in jetziger Zeit wird der innere Zusammenhang
von Religion und Poesie deutlich fühlbar, und darum hält Muth »die fünf Vor-
lesungen Deutingers für ein höchst zeitnotwendiges Buch«. Muth bedauert, daß
Martin Deutinger sogar in Fachkreisen so wenig bekannt ist, und dabei hat »kein
Geringerer als Eduard v. Hartmann (,Die deutsche Ästhetik seit Kant') Deutingers
,Kunstlehre' eine geradezu epochemachende Bedeutung in der Geschichte der
Ästhetik zugesprochen«. Diese Vernachlässigung Deutingers erklärt Muth — be-
kanntlich Herausgeber der katholischen Zeitschrift »Hochland« — keineswegs da-
durch, daß Deutinger als Katholik im vorwiegend protestantischen Deutschland nicht
zur Geltung kam, sondern dadurch, daß »der Zeitpunkt noch nicht gekommen, wo
durch ein großes religiöses Zeiterlebnis den . .. verkündeten Ideen der Boden be-
reitet und eine wirksame Entfaltung in den Geistern gesichert wäre«.
Deutinger wurde 1815 in der Nähe von Langenpreising in Oberbayern geboren.
Nach Vollendung seiner Gymnasialstudien wandte er sich der Vorbereitung zum
geistlichen Stande zu. Schon als Student entwirft Deutinger seine später ausgeführte
Arbeit »Grundlinien einer positiven Philosophie als vorläufiger Versuch einer Zurück-
führung aller Teile der Philosophie auf christliche Prinzipien«. Ein Semester war
er Extraordinarius in München, dann wurde er Lehrer am Lyzeum in Dillingen.
Den »Grundlinien« fügte Deutinger noch eine »Moralphilosophie« hinzu. Wegen
eines Augenleidens gab er im Jahre 1852 seine Lehrtätigkeit auf und lebte bis zu
seinem im Jahre 1864 erfolgten Tode in München als Privatgelehrter und Universi.
tätsprediger an der Ludwigskirche.
Deutingers Kunstlehre geht von folgenden Gedanken aus: »Der Mensch wird
sich, wie im Denken und moralischen Handeln, so auch im Können, als einer pro-
duktiven Geisteskraft, seiner Freiheit bewußt. Sucht er im Denken sich die äußere
Welt innerlich zu eigen zu machen, so handelt es sich beim Kunstwerk darum, sein
Inneres nach außen zu verwirklichen, indem er sich der ihm dazu verfügbaren stoff-
lichen Ausdrucksmittel bedient. In dieser Herrschaft über die stoffliche Welt ist
dem Menschen eine Bürgschaft seiner Vorzugsstellung im ganzen Umkreis der