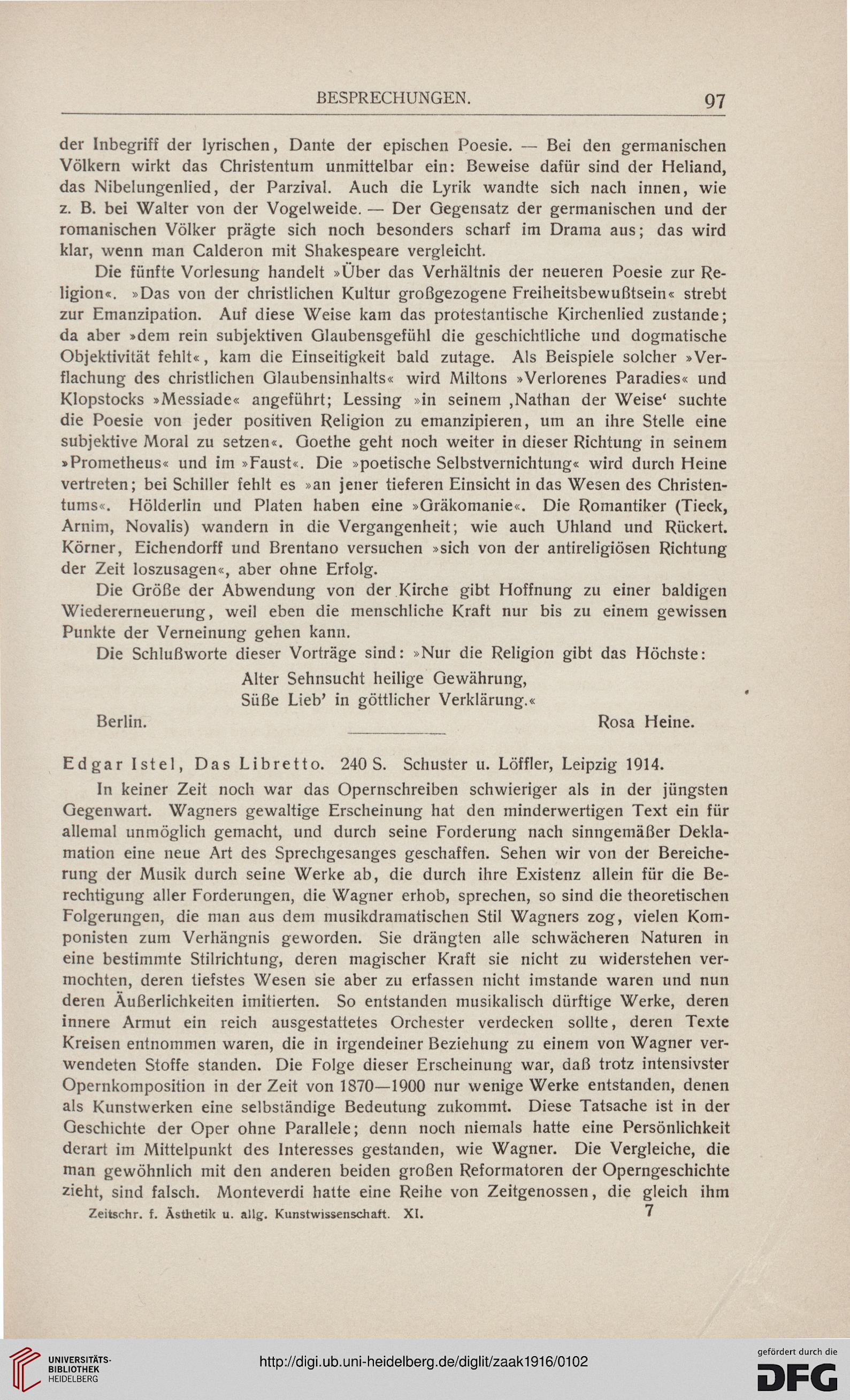BESPRECHUNGEN. QJ
der Inbegriff der lyrischen, Dante der epischen Poesie. — Bei den germanischen
Völkern wirkt das Christentum unmittelbar ein: Beweise dafür sind der Heliand,
das Nibelungenlied, der Parzival. Auch die Lyrik wandte sich nach innen, wie
z. B. bei Walter von der Vogelweide. — Der Gegensatz der germanischen und der
romanischen Völker prägte sich noch besonders scharf im Drama aus; das wird
klar, wenn man Calderon mit Shakespeare vergleicht.
Die fünfte Vorlesung handelt »Über das Verhältnis der neueren Poesie zur Re-
ligion«. »Das von der christlichen Kultur großgezogene Freiheitsbewußtsein« strebt
zur Emanzipation. Auf diese Weise kam das protestantische Kirchenlied zustande;
da aber »dem rein subjektiven Glaubensgefühl die geschichtliche und dogmatische
Objektivität fehlt«, kam die Einseitigkeit bald zutage. Als Beispiele solcher »Ver-
flachung des christlichen Glaubensinhalts« wird Miltons »Verlorenes Paradies« und
Klopstocks »Messiade« angeführt; Lessing »in seinem ,Nathan der Weise' suchte
die Poesie von jeder positiven Religion zu emanzipieren, um an ihre Stelle eine
subjektive Moral zu setzen«. Goethe geht noch weiter in dieser Richtung in seinem
»Prometheus« und im »Faust«. Die »poetische Selbstvernichtung« wird durch Heine
vertreten; bei Schiller fehlt es »an jener tieferen Einsicht in das Wesen des Christen-
tums«. Hölderlin und Platen haben eine »Gräkomanie«. Die Romantiker (Tieck,
Arnim, Novalis) wandern in die Vergangenheit; wie auch Uhland und Rückert.
Körner, Eichendorff und Brentano versuchen »sich von der antireligiösen Richtung
der Zeit loszusagen«, aber ohne Erfolg.
Die Größe der Abwendung von der Kirche gibt Hoffnung zu einer baldigen
Wiedererneuerung, weil eben die menschliche Kraft nur bis zu einem gewissen
Punkte der Verneinung gehen kann.
Die Schlußworte dieser Vorträge sind: »Nur die Religion gibt das Höchste:
Alter Sehnsucht heilige Gewährung,
Süße Lieb' in göttlicher Verklärung.«
Berlin. Rosa Heine.
Edgar Istel, Das Libretto. 240 S. Schuster u. Löffler, Leipzig 1914.
In keiner Zeit noch war das Opernschreiben schwieriger als in der jüngsten
Gegenwart. Wagners gewaltige Erscheinung hat den minderwertigen Text ein für
allemal unmöglich gemacht, und durch seine Forderung nach sinngemäßer Dekla-
mation eine neue Art des Sprechgesanges geschaffen. Sehen wir von der Bereiche-
rung der Musik durch seine Werke ab, die durch ihre Existenz allein für die Be-
rechtigung aller Forderungen, die Wagner erhob, sprechen, so sind die theoretischen
Folgerungen, die man aus dem musikdramatischen Stil Wagners zog, vielen Kom-
ponisten zum Verhängnis geworden. Sie drängten alle schwächeren Naturen in
eine bestimmte Stilrichtung, deren magischer Kraft sie nicht zu widerstehen ver-
mochten, deren tiefstes Wesen sie aber zu erfassen nicht imstande waren und nun
deren Äußerlichkeiten imitierten. So entstanden musikalisch dürftige Werke, deren
innere Armut ein reich ausgestattetes Orchester verdecken sollte, deren Texte
Kreisen entnommen waren, die in irgendeiner Beziehung zu einem von Wagner ver-
wendeten Stoffe standen. Die Folge dieser Erscheinung war, daß trotz intensivster
Opernkomposition in der Zeit von 1870—1900 nur wenige Werke entstanden, denen
als Kunstwerken eine selbständige Bedeutung zukommt. Diese Tatsache ist in der
Geschichte der Oper ohne Parallele; denn noch niemals hatte eine Persönlichkeit
derart im Mittelpunkt des Interesses gestanden, wie Wagner. Die Vergleiche, die
man gewöhnlich mit den anderen beiden großen Reformatoren der Operngeschichte
zieht, sind falsch. Monteverdi hatte eine Reihe von Zeitgenossen, die gleich ihm
Zeitechr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. XI. 7
der Inbegriff der lyrischen, Dante der epischen Poesie. — Bei den germanischen
Völkern wirkt das Christentum unmittelbar ein: Beweise dafür sind der Heliand,
das Nibelungenlied, der Parzival. Auch die Lyrik wandte sich nach innen, wie
z. B. bei Walter von der Vogelweide. — Der Gegensatz der germanischen und der
romanischen Völker prägte sich noch besonders scharf im Drama aus; das wird
klar, wenn man Calderon mit Shakespeare vergleicht.
Die fünfte Vorlesung handelt »Über das Verhältnis der neueren Poesie zur Re-
ligion«. »Das von der christlichen Kultur großgezogene Freiheitsbewußtsein« strebt
zur Emanzipation. Auf diese Weise kam das protestantische Kirchenlied zustande;
da aber »dem rein subjektiven Glaubensgefühl die geschichtliche und dogmatische
Objektivität fehlt«, kam die Einseitigkeit bald zutage. Als Beispiele solcher »Ver-
flachung des christlichen Glaubensinhalts« wird Miltons »Verlorenes Paradies« und
Klopstocks »Messiade« angeführt; Lessing »in seinem ,Nathan der Weise' suchte
die Poesie von jeder positiven Religion zu emanzipieren, um an ihre Stelle eine
subjektive Moral zu setzen«. Goethe geht noch weiter in dieser Richtung in seinem
»Prometheus« und im »Faust«. Die »poetische Selbstvernichtung« wird durch Heine
vertreten; bei Schiller fehlt es »an jener tieferen Einsicht in das Wesen des Christen-
tums«. Hölderlin und Platen haben eine »Gräkomanie«. Die Romantiker (Tieck,
Arnim, Novalis) wandern in die Vergangenheit; wie auch Uhland und Rückert.
Körner, Eichendorff und Brentano versuchen »sich von der antireligiösen Richtung
der Zeit loszusagen«, aber ohne Erfolg.
Die Größe der Abwendung von der Kirche gibt Hoffnung zu einer baldigen
Wiedererneuerung, weil eben die menschliche Kraft nur bis zu einem gewissen
Punkte der Verneinung gehen kann.
Die Schlußworte dieser Vorträge sind: »Nur die Religion gibt das Höchste:
Alter Sehnsucht heilige Gewährung,
Süße Lieb' in göttlicher Verklärung.«
Berlin. Rosa Heine.
Edgar Istel, Das Libretto. 240 S. Schuster u. Löffler, Leipzig 1914.
In keiner Zeit noch war das Opernschreiben schwieriger als in der jüngsten
Gegenwart. Wagners gewaltige Erscheinung hat den minderwertigen Text ein für
allemal unmöglich gemacht, und durch seine Forderung nach sinngemäßer Dekla-
mation eine neue Art des Sprechgesanges geschaffen. Sehen wir von der Bereiche-
rung der Musik durch seine Werke ab, die durch ihre Existenz allein für die Be-
rechtigung aller Forderungen, die Wagner erhob, sprechen, so sind die theoretischen
Folgerungen, die man aus dem musikdramatischen Stil Wagners zog, vielen Kom-
ponisten zum Verhängnis geworden. Sie drängten alle schwächeren Naturen in
eine bestimmte Stilrichtung, deren magischer Kraft sie nicht zu widerstehen ver-
mochten, deren tiefstes Wesen sie aber zu erfassen nicht imstande waren und nun
deren Äußerlichkeiten imitierten. So entstanden musikalisch dürftige Werke, deren
innere Armut ein reich ausgestattetes Orchester verdecken sollte, deren Texte
Kreisen entnommen waren, die in irgendeiner Beziehung zu einem von Wagner ver-
wendeten Stoffe standen. Die Folge dieser Erscheinung war, daß trotz intensivster
Opernkomposition in der Zeit von 1870—1900 nur wenige Werke entstanden, denen
als Kunstwerken eine selbständige Bedeutung zukommt. Diese Tatsache ist in der
Geschichte der Oper ohne Parallele; denn noch niemals hatte eine Persönlichkeit
derart im Mittelpunkt des Interesses gestanden, wie Wagner. Die Vergleiche, die
man gewöhnlich mit den anderen beiden großen Reformatoren der Operngeschichte
zieht, sind falsch. Monteverdi hatte eine Reihe von Zeitgenossen, die gleich ihm
Zeitechr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. XI. 7