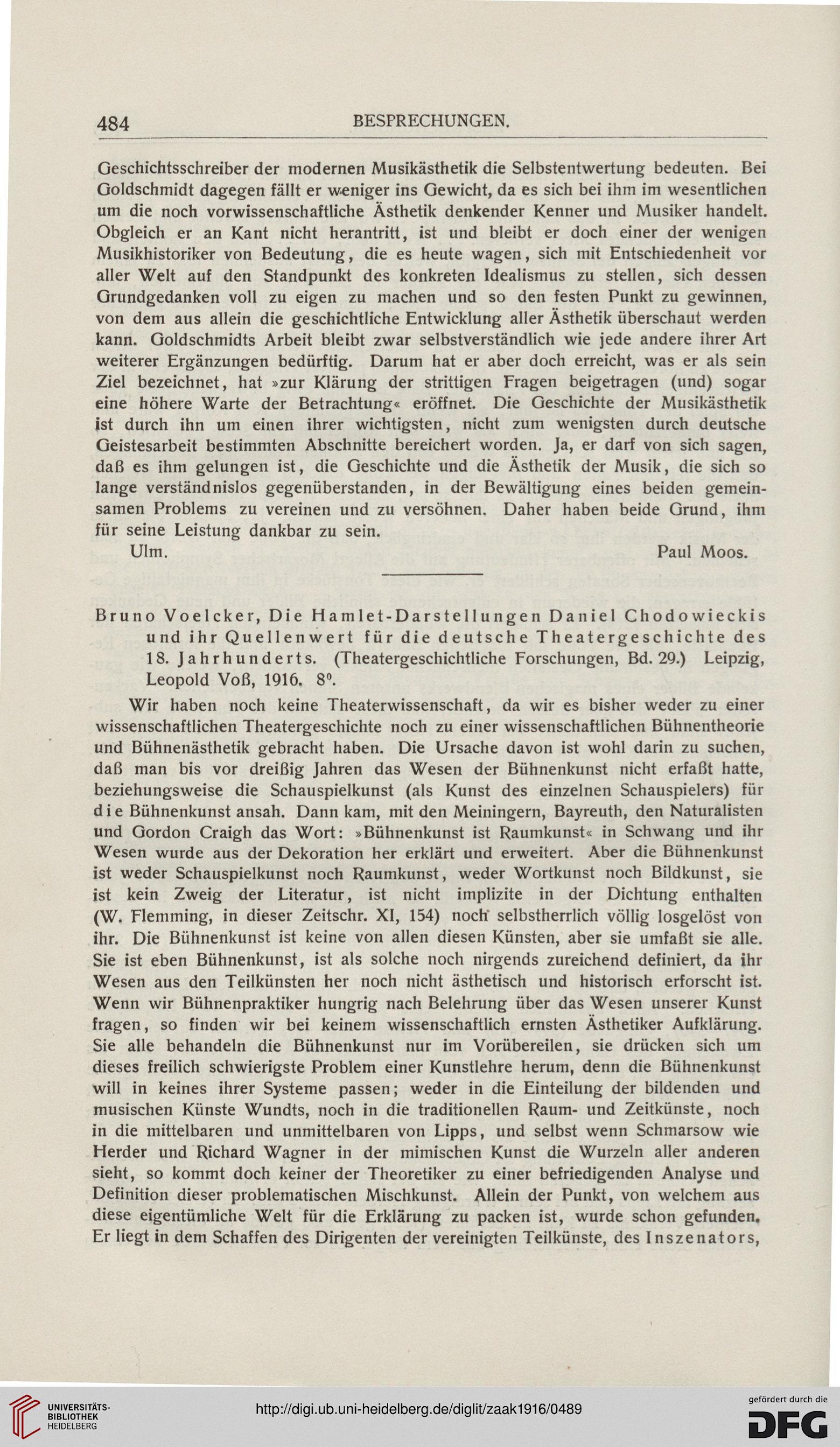484 BESPRECHUNGEN.
Geschichtsschreiber der modernen Musikästhetik die Selbstentwertung bedeuten. Bei
Goldschmidt dagegen fällt er weniger ins Gewicht, da es sich bei ihm im wesentlichen
um die noch vorwissenschaftliche Ästhetik denkender Kenner und Musiker handelt.
Obgleich er an Kant nicht herantritt, ist und bleibt er doch einer der wenigen
Musikhistoriker von Bedeutung, die es heute wagen, sich mit Entschiedenheit vor
aller Welt auf den Standpunkt des konkreten Idealismus zu stellen, sich dessen
Grundgedanken voll zu eigen zu machen und so den festen Punkt zu gewinnen,
von dem aus allein die geschichtliche Entwicklung aller Ästhetik überschaut werden
kann. Goldschmidts Arbeit bleibt zwar selbstverständlich wie jede andere ihrer Art
weiterer Ergänzungen bedürftig. Darum hat er aber doch erreicht, was er als sein
Ziel bezeichnet, hat »zur Klärung der strittigen Fragen beigetragen (und) sogar
eine höhere Warte der Betrachtung« eröffnet. Die Geschichte der Musikästhetik
ist durch ihn um einen ihrer wichtigsten, nicht zum wenigsten durch deutsche
Geistesarbeit bestimmten Abschnitte bereichert worden. Ja, er darf von sich sagen,
daß es ihm gelungen ist, die Geschichte und die Ästhetik der Musik, die sich so
lange verständnislos gegenüberstanden, in der Bewältigung eines beiden gemein-
samen Problems zu vereinen und zu versöhnen. Daher haben beide Grund, ihm
für seine Leistung dankbar zu sein.
Ulm. Paul Moos.
Bruno Voelcker, Die Hamlet-Darstellungen Daniel Chodowieckis
und ihr Quellenwert für die deutsche Theatergeschichte des
18. Jahrhunderts. (Theatergeschichtliche Forschungen, Bd. 29.) Leipzig,
Leopold Voß, 1916. 8".
Wir haben noch keine Theaterwissenschaft, da wir es bisher weder zu einer
wissenschaftlichen Theatergeschichte noch zu einer wissenschaftlichen Bühnentheorie
und Bühnenästhetik gebracht haben. Die Ursache davon ist wohl darin zu suchen,
daß man bis vor dreißig Jahren das Wesen der Bühnenkunst nicht erfaßt hatte,
beziehungsweise die Schauspielkunst (als Kunst des einzelnen Schauspielers) für
die Bühnenkunst ansah. Dann kam, mit den Meiningern, Bayreuth, den Naturalisten
und Gordon Craigh das Wort: »Bühnenkunst ist Raumkunst« in Schwang und ihr
Wesen wurde aus der Dekoration her erklärt und erweitert. Aber die Bühnenkunst
ist weder Schauspielkunst noch Raumkunst, weder Wortkunst noch Bildkunst, sie
ist kein Zweig der Literatur, ist nicht implizite in der Dichtung enthalten
(W. Flemming, in dieser Zeitschr. XI, 154) noch' selbstherrlich völlig losgelöst von
ihr. Die Bühnenkunst ist keine von allen diesen Künsten, aber sie umfaßt sie alle.
Sie ist eben Bühnenkunst, ist als solche noch nirgends zureichend definiert, da ihr
Wesen aus den Teilkünsten her noch nicht ästhetisch und historisch erforscht ist.
Wenn wir Bühnenpraktiker hungrig nach Belehrung über das Wesen unserer Kunst
fragen, so finden wir bei keinem wissenschaftlich ernsten Ästhetiker Aufklärung.
Sie alle behandeln die Bühnenkunst nur im Vorübereilen, sie drücken sich um
dieses freilich schwierigste Problem einer Kunstlehre herum, denn die Bühnenkunst
will in keines ihrer Systeme passen; weder in die Einteilung der bildenden und
musischen Künste Wundts, noch in die traditionellen Raum- und Zeitkünste, noch
in die mittelbaren und unmittelbaren von Lipps, und selbst wenn Schmarsow wie
Herder und Richard Wagner in der mimischen Kunst die Wurzeln aller anderen
sieht, so kommt doch keiner der Theoretiker zu einer befriedigenden Analyse und
Definition dieser problematischen Mischkunst. Allein der Punkt, von welchem aus
diese eigentümliche Welt für die Erklärung zu packen ist, wurde schon gefunden.
Er liegt in dem Schaffen des Dirigenten der vereinigten Teilkünste, des Inszenators,
Geschichtsschreiber der modernen Musikästhetik die Selbstentwertung bedeuten. Bei
Goldschmidt dagegen fällt er weniger ins Gewicht, da es sich bei ihm im wesentlichen
um die noch vorwissenschaftliche Ästhetik denkender Kenner und Musiker handelt.
Obgleich er an Kant nicht herantritt, ist und bleibt er doch einer der wenigen
Musikhistoriker von Bedeutung, die es heute wagen, sich mit Entschiedenheit vor
aller Welt auf den Standpunkt des konkreten Idealismus zu stellen, sich dessen
Grundgedanken voll zu eigen zu machen und so den festen Punkt zu gewinnen,
von dem aus allein die geschichtliche Entwicklung aller Ästhetik überschaut werden
kann. Goldschmidts Arbeit bleibt zwar selbstverständlich wie jede andere ihrer Art
weiterer Ergänzungen bedürftig. Darum hat er aber doch erreicht, was er als sein
Ziel bezeichnet, hat »zur Klärung der strittigen Fragen beigetragen (und) sogar
eine höhere Warte der Betrachtung« eröffnet. Die Geschichte der Musikästhetik
ist durch ihn um einen ihrer wichtigsten, nicht zum wenigsten durch deutsche
Geistesarbeit bestimmten Abschnitte bereichert worden. Ja, er darf von sich sagen,
daß es ihm gelungen ist, die Geschichte und die Ästhetik der Musik, die sich so
lange verständnislos gegenüberstanden, in der Bewältigung eines beiden gemein-
samen Problems zu vereinen und zu versöhnen. Daher haben beide Grund, ihm
für seine Leistung dankbar zu sein.
Ulm. Paul Moos.
Bruno Voelcker, Die Hamlet-Darstellungen Daniel Chodowieckis
und ihr Quellenwert für die deutsche Theatergeschichte des
18. Jahrhunderts. (Theatergeschichtliche Forschungen, Bd. 29.) Leipzig,
Leopold Voß, 1916. 8".
Wir haben noch keine Theaterwissenschaft, da wir es bisher weder zu einer
wissenschaftlichen Theatergeschichte noch zu einer wissenschaftlichen Bühnentheorie
und Bühnenästhetik gebracht haben. Die Ursache davon ist wohl darin zu suchen,
daß man bis vor dreißig Jahren das Wesen der Bühnenkunst nicht erfaßt hatte,
beziehungsweise die Schauspielkunst (als Kunst des einzelnen Schauspielers) für
die Bühnenkunst ansah. Dann kam, mit den Meiningern, Bayreuth, den Naturalisten
und Gordon Craigh das Wort: »Bühnenkunst ist Raumkunst« in Schwang und ihr
Wesen wurde aus der Dekoration her erklärt und erweitert. Aber die Bühnenkunst
ist weder Schauspielkunst noch Raumkunst, weder Wortkunst noch Bildkunst, sie
ist kein Zweig der Literatur, ist nicht implizite in der Dichtung enthalten
(W. Flemming, in dieser Zeitschr. XI, 154) noch' selbstherrlich völlig losgelöst von
ihr. Die Bühnenkunst ist keine von allen diesen Künsten, aber sie umfaßt sie alle.
Sie ist eben Bühnenkunst, ist als solche noch nirgends zureichend definiert, da ihr
Wesen aus den Teilkünsten her noch nicht ästhetisch und historisch erforscht ist.
Wenn wir Bühnenpraktiker hungrig nach Belehrung über das Wesen unserer Kunst
fragen, so finden wir bei keinem wissenschaftlich ernsten Ästhetiker Aufklärung.
Sie alle behandeln die Bühnenkunst nur im Vorübereilen, sie drücken sich um
dieses freilich schwierigste Problem einer Kunstlehre herum, denn die Bühnenkunst
will in keines ihrer Systeme passen; weder in die Einteilung der bildenden und
musischen Künste Wundts, noch in die traditionellen Raum- und Zeitkünste, noch
in die mittelbaren und unmittelbaren von Lipps, und selbst wenn Schmarsow wie
Herder und Richard Wagner in der mimischen Kunst die Wurzeln aller anderen
sieht, so kommt doch keiner der Theoretiker zu einer befriedigenden Analyse und
Definition dieser problematischen Mischkunst. Allein der Punkt, von welchem aus
diese eigentümliche Welt für die Erklärung zu packen ist, wurde schon gefunden.
Er liegt in dem Schaffen des Dirigenten der vereinigten Teilkünste, des Inszenators,