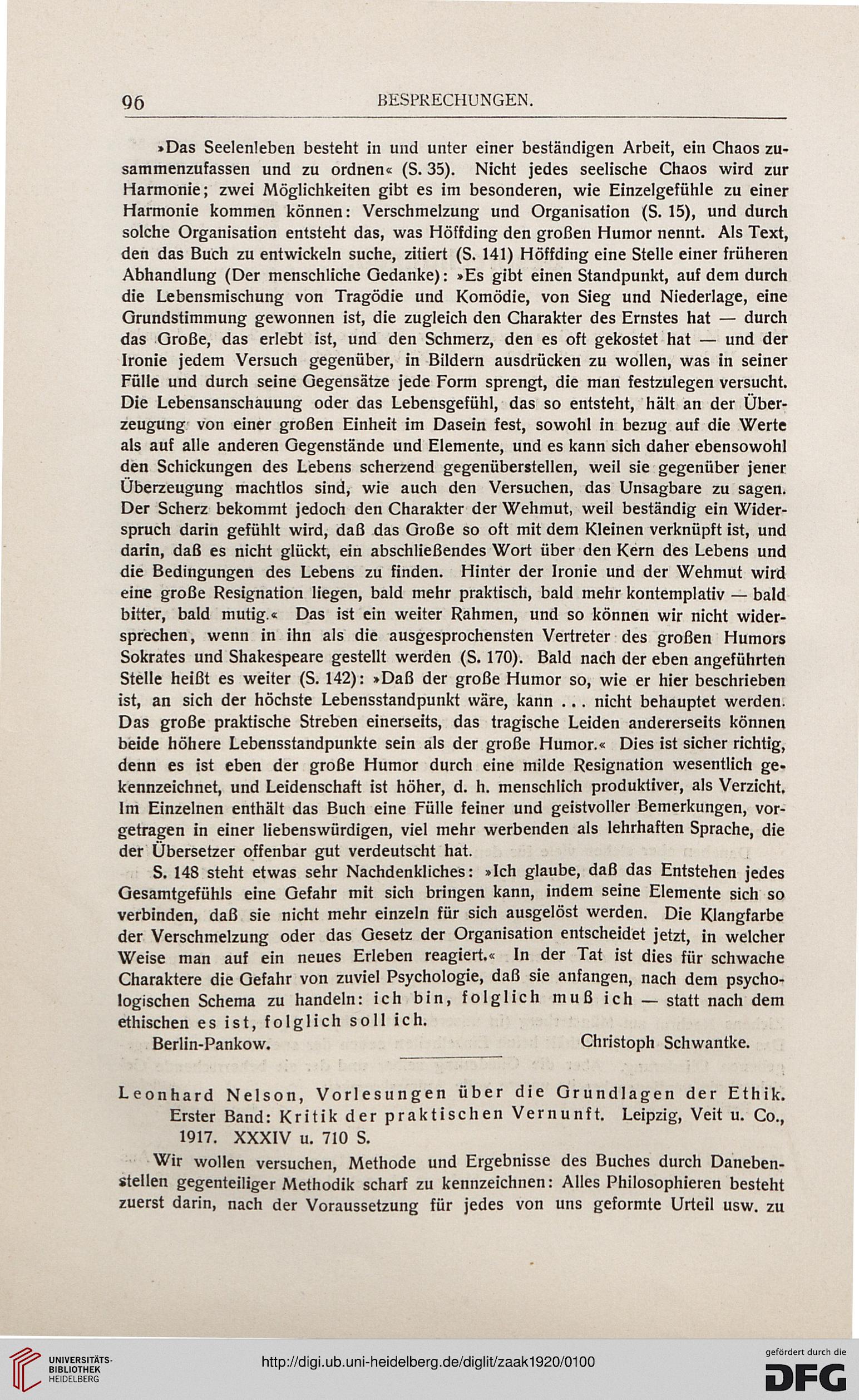Q6 BESPRECHUNGEN.
»Das Seelenleben besteht in und unter einer beständigen Arbeit, ein Chaos zu-
sammenzufassen und zu ordnen« (S. 35). Nicht jedes seelische Chaos wird zur
Harmonie; zwei Möglichkeiten gibt es im besonderen, wie Einzelgefühle zu einer
Harmonie kommen können: Verschmelzung und Organisation (S. 15), und durch
solche Organisation entsteht das, was Höffding den großen Humor nennt. Als Text,
den das Buch zu entwickeln suche, zitiert (S. 141) Höffding eine Stelle einer früheren
Abhandlung (Der menschliche Gedanke): »Es gibt einen Standpunkt, auf dem durch
die Lebensmischung von Tragödie und Komödie, von Sieg und Niederlage, eine
Orundstimmung gewonnen ist, die zugleich den Charakter des Ernstes hat — durch
das Große, das erlebt ist, und den Schmerz, den es oft gekostet hat — und der
Ironie jedem Versuch gegenüber, in Bildern ausdrücken zu wollen, was in seiner
Fülle und durch seine Gegensätze jede Form sprengt, die man festzulegen versucht.
Die Lebensanschauung oder das Lebensgefühl, das so entsteht, hält an der Über-
zeugung von einer großen Einheit im Dasein fest, sowohl in bezug auf die Werte
als auf alle anderen Gegenstände und Elemente, und es kann sich daher ebensowohl
den Schickungen des Lebens scherzend gegenüberstellen, weil sie gegenüber jener
Überzeugung machtlos sind, wie auch den Versuchen, das Unsagbare zu sagen.
Der Scherz bekommt jedoch den Charakter der Wehmut, weil beständig ein Wider-
spruch darin gefühlt wird, daß das Große so oft mit dem Kleinen verknüpft ist, und
darin, daß es nicht glückt, ein abschließendes Wort über den Kern des Lebens und
die Bedingungen des Lebens zu finden. Hinter der Ironie und der Wehmut wird
eine große Resignation liegen, bald mehr praktisch, bald mehr kontemplativ — bald
bitter, bald mutig.« Das ist ein weiter Rahmen, und so können wir nicht wider-
sprechen, wenn in ihn als die ausgesprochensten Vertreter des großen Humors
Sokrates und Shakespeare gestellt werden (S. 170). Bald nach der eben angeführten
Stelle heißt es weiter (S. 142): »Daß der große Humor so, wie er hier beschrieben
ist, an sich der höchste Lebensstandpunkt wäre, kann ... nicht behauptet werden.
Das große praktische Streben einerseits, das tragische Leiden andererseits können
beide höhere Lebensstandpunkte sein als der große Humor.« Dies ist sicher richtig,
denn es ist eben der große Humor durch eine milde Resignation wesentlich ge-
kennzeichnet, und Leidenschaft ist höher, d. h. menschlich produktiver, als Verzicht,
Im Einzelnen enthält das Buch eine Fülle feiner und geistvoller Bemerkungen, vor-
getragen in einer liebenswürdigen, viel mehr werbenden als lehrhaften Sprache, die
der Übersetzer offenbar gut verdeutscht hat.
S. 148 steht etwas sehr Nachdenkliches: »Ich glaube, daß das Entstehen jedes
Gesamtgefühls eine Gefahr mit sich bringen kann, indem seine Elemente sich so
verbinden, daß sie nicht mehr einzeln für sich ausgelöst werden. Die Klangfarbe
der Verschmelzung oder das Gesetz der Organisation entscheidet jetzt, in welcher
Weise man auf ein neues Erleben reagiert.« In der Tat ist dies für schwache
Charaktere die Gefahr von zuviel Psychologie, daß sie anfangen, nach dem psycho-
logischen Schema zu handeln: ich bin, folglich muß ich — statt nach dem
ethischen es ist, folglich soll ich.
Berlin-Pankow. Christoph Schwantke.
Leonhard Nelson, Vorlesungen über die Grundlagen der Ethik.
Erster Band: Kritik der praktischen Vernunft. Leipzig, Veit u. Co.,
1917. XXXIV u. 710 S.
Wir wollen versuchen, Methode und Ergebnisse des Buches durch Daneben-
stellen gegenteiliger Methodik scharf zu kennzeichnen: Alles Philosophieren besteht
zuerst darin, nach der Voraussetzung für jedes von uns geformte Urteil usw. zu
»Das Seelenleben besteht in und unter einer beständigen Arbeit, ein Chaos zu-
sammenzufassen und zu ordnen« (S. 35). Nicht jedes seelische Chaos wird zur
Harmonie; zwei Möglichkeiten gibt es im besonderen, wie Einzelgefühle zu einer
Harmonie kommen können: Verschmelzung und Organisation (S. 15), und durch
solche Organisation entsteht das, was Höffding den großen Humor nennt. Als Text,
den das Buch zu entwickeln suche, zitiert (S. 141) Höffding eine Stelle einer früheren
Abhandlung (Der menschliche Gedanke): »Es gibt einen Standpunkt, auf dem durch
die Lebensmischung von Tragödie und Komödie, von Sieg und Niederlage, eine
Orundstimmung gewonnen ist, die zugleich den Charakter des Ernstes hat — durch
das Große, das erlebt ist, und den Schmerz, den es oft gekostet hat — und der
Ironie jedem Versuch gegenüber, in Bildern ausdrücken zu wollen, was in seiner
Fülle und durch seine Gegensätze jede Form sprengt, die man festzulegen versucht.
Die Lebensanschauung oder das Lebensgefühl, das so entsteht, hält an der Über-
zeugung von einer großen Einheit im Dasein fest, sowohl in bezug auf die Werte
als auf alle anderen Gegenstände und Elemente, und es kann sich daher ebensowohl
den Schickungen des Lebens scherzend gegenüberstellen, weil sie gegenüber jener
Überzeugung machtlos sind, wie auch den Versuchen, das Unsagbare zu sagen.
Der Scherz bekommt jedoch den Charakter der Wehmut, weil beständig ein Wider-
spruch darin gefühlt wird, daß das Große so oft mit dem Kleinen verknüpft ist, und
darin, daß es nicht glückt, ein abschließendes Wort über den Kern des Lebens und
die Bedingungen des Lebens zu finden. Hinter der Ironie und der Wehmut wird
eine große Resignation liegen, bald mehr praktisch, bald mehr kontemplativ — bald
bitter, bald mutig.« Das ist ein weiter Rahmen, und so können wir nicht wider-
sprechen, wenn in ihn als die ausgesprochensten Vertreter des großen Humors
Sokrates und Shakespeare gestellt werden (S. 170). Bald nach der eben angeführten
Stelle heißt es weiter (S. 142): »Daß der große Humor so, wie er hier beschrieben
ist, an sich der höchste Lebensstandpunkt wäre, kann ... nicht behauptet werden.
Das große praktische Streben einerseits, das tragische Leiden andererseits können
beide höhere Lebensstandpunkte sein als der große Humor.« Dies ist sicher richtig,
denn es ist eben der große Humor durch eine milde Resignation wesentlich ge-
kennzeichnet, und Leidenschaft ist höher, d. h. menschlich produktiver, als Verzicht,
Im Einzelnen enthält das Buch eine Fülle feiner und geistvoller Bemerkungen, vor-
getragen in einer liebenswürdigen, viel mehr werbenden als lehrhaften Sprache, die
der Übersetzer offenbar gut verdeutscht hat.
S. 148 steht etwas sehr Nachdenkliches: »Ich glaube, daß das Entstehen jedes
Gesamtgefühls eine Gefahr mit sich bringen kann, indem seine Elemente sich so
verbinden, daß sie nicht mehr einzeln für sich ausgelöst werden. Die Klangfarbe
der Verschmelzung oder das Gesetz der Organisation entscheidet jetzt, in welcher
Weise man auf ein neues Erleben reagiert.« In der Tat ist dies für schwache
Charaktere die Gefahr von zuviel Psychologie, daß sie anfangen, nach dem psycho-
logischen Schema zu handeln: ich bin, folglich muß ich — statt nach dem
ethischen es ist, folglich soll ich.
Berlin-Pankow. Christoph Schwantke.
Leonhard Nelson, Vorlesungen über die Grundlagen der Ethik.
Erster Band: Kritik der praktischen Vernunft. Leipzig, Veit u. Co.,
1917. XXXIV u. 710 S.
Wir wollen versuchen, Methode und Ergebnisse des Buches durch Daneben-
stellen gegenteiliger Methodik scharf zu kennzeichnen: Alles Philosophieren besteht
zuerst darin, nach der Voraussetzung für jedes von uns geformte Urteil usw. zu